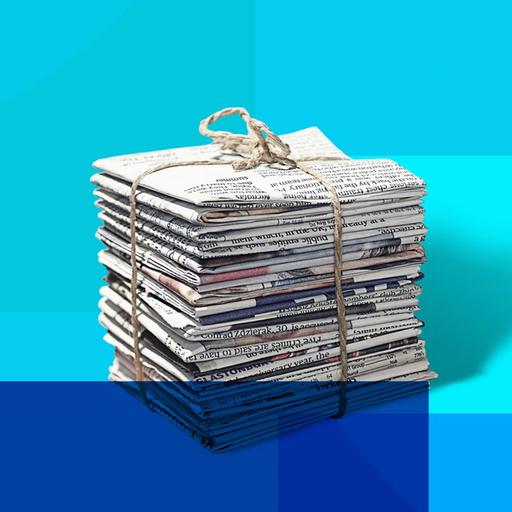"Das Urteil dürfte das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung haben", vermutet RZECZPOSPOLITA aus Warschau: "Richterin de Perthuis hörte letztlich auf niemanden. Das Verfassungsgericht hatte vor wenigen Tagen empfohlen, den politischen Kontext zu berücksichtigen: Jeder Angeklagte habe das Recht, Berufung einzulegen. Mit dem sofortigen Wahl-Ausschluss von Le Pen verhängt das Gericht nun eine unumkehrbare Strafe. Dazu kommt die politische Lage: Einer der Minister der aktuellen Regierung erklärte anonym: Wenn das Gericht Le Pen ausschließe, werde die Partei Rassemblement National die Präsidentschaftswahl 2027 'mit Sicherheit' gewinnen. Denn in den Augen der Anhänger der verurteilten Partei bestätigt sich die These einer 'Verschwörung' der Eliten, die die extreme Rechte ausschließen wollen. Jüngste Umfragen bestätigen derartige Befürchtungen", hält die polnische RZECZPOSPOLITA fest.
Der österreichische STANDARD nennt das Urteil "kurzsichtig": "Die Opferrolle trägt Le Pen nun die Stimmen all jener zu, die sich selbst als Opfer sehen. Es ist zu hoffen, dass die zweite Instanz Le Pens Teilnahme an der Präsidentschaftswahl 2027 ermöglichen wird. Damit sie an den Wahlurnen von Millionen Stimmberechtigten geschlagen wird, nicht nur durch ein Urteil."
LA VANGUARDIA aus Barcelona erläutert: "Für die französische Demokratie ergibt sich eine heikle Situation. Das Erstarken der Ultrarechten und die omnipräsenten Falschnachrichten polarisieren die Gesellschaft immer weiter und unterminieren den Rechtsstaat. Dazu gehört, dass Vertreter der Populisten ständig die Justiz hinterfragen, sobald sie nicht von ihr profitieren. Aber es gibt keine Demokratie ohne Gewaltenteilung, und es ist bedauerlich, dass US-Präsident Trump immer mehr Nachahmer findet. Es mag sein, dass das Urteil die Aussichten des Rassemblement National bei den nächsten Wahlen stärkt, aber das fällt dann nicht mehr in die Zuständigkeit des Gerichts. Seine Aufgabe ist es, unparteiisch und ohne Rücksicht auf wechselhafte politische Stimmungen zu entscheiden", unterstreicht die spanische LA VANGUARDIA.
Das europäische Nachrichtenportal EURACTIV notiert: "Die Angriffe auf die Unabhängigkeit der französischen Justiz haben schon vor dem Urteil begonnen. Ein Abgeordneter des Rassemblement National sprach am Wochenende davon, dass die Justiz manchmal dafür genutzt werde, um politische Karrieren zu zerstören. Es ist die klassische Vorgehensweise von Populisten und Autokraten. Richterin de Perthuis erinnerte bei der Urteilsverkündung daran, dass gewählte Politiker und normale Bürger vor dem Gesetz gleich seien. Das hat die französische Politik aber nicht aufgehalten, das System insgesamt zu attackieren und den Rechtsaußen genau das zu geben, was sie wollen: Eine weitere Schwächung der Justiz." So weit das Nachrichtenportal EURACTIV mit Sitz in Brüssel.
Die französische Online-Zeitung MEDIAPART mit Sitz in Paris vermerkt: "Bei Drogenhandel, Einbrüchen und Terrorismus sind Drogenhändler, Einbrecher und Terroristen das Problem. Aber bei Straftaten von Politikern ist plötzlich die Justiz das Problem. Genauer gesagt, diejenigen, die im Namen des Volkes urteilen: Richter und Staatsanwälte. Nach der Verurteilung von Le Pen wurden ihnen in zahlreichen politischen und medialen Kommentaren vorgeworfen, zur demokratischen Destabilisierung beizutragen. Es ist ein Wahnsinn, hinter dem sich eine zutiefst gefährliche Absicht verbirgt: Der Wunsch nach einer Rückkehr der Privilegien für die Eliten - also das Feudalsystem, das 1789 während der Französischen Revolution abgeschafft worden war", erinnert MEDIAPART.
LE MONDE aus Paris vergleicht die Verurteilung Le Pens mit der des früheren Präsidenten Sarkozy: "Beide Fälle haben etwas gemeinsam: die medialen und politischen Attacken gegen die Gerichte. Der Widerstand gegen Urteile ist kein Zeichen für eine gesunde Demokratie."
Die WASHINGTON POST stellt einen Vergleich mit den USA auf: "Le Pens Partei bezeichnete den Prozess als Hexenjagd - etwas, was auch Donald Trump hätte sagen können. Scham und Reue sind altmodische Eigenschaften aus einer längst vergangenen Zeit. Auch Trump ist ein Verbrecher, aber seine Verurteilung im Jahr 2024 war kein Hindernis auf dem Weg ins Weiße Haus. Es gibt keine roten Linien mehr", betont die WASHINGTON POST.
Kommentiert wird weiter die zuletzt öffentlich geäußerte Kritik des US-Präsidenten am russischen Staatschef Putin. Dazu schreibt die japanische NIHON KEIZAI SHIMBUN: "Man muss stets darauf achten, dass Donald Trump einfach zu viel redet und die Distanz zwischen ihm und den Medien zu kurz ist. Derzeit berichtet der US-Präsident fast wie ein Live-Kommentator einer Sport-Übertragung über aktuelle Entwicklungen, ob bei Verhandlungen mit anderen Staaten oder in der Inlandspolitik. Manche Beobachter könnten dies als erhöhte Transparenz begrüßen – aber ehrlich gesagt, ist sein Kommunikationsstil amateurhaft", kritisiert NIHON KEIZAI SHIMBUN aus Tokio.
Die chinesische Zeitung WENHUIBAO notiert: "Wegen ausbleibender Zugeständnisse von Seiten Russlands in den Friedensverhandlungen mit der Ukraine hat sich der US-Präsident erzürnt gegeben und sogenannte 'Sekundärzölle' angedroht. Damit sind offenbar Währungssanktionen und ein Handelsembargo gemeint. Der Kreml hat dies sogleich heruntergespielt und als Sensationshascherei der Medien abgetan. Ungeachtet dieser jüngsten Breitseite gegen Putin scheint Trump nach wie vor auch Druck auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auszuüben, weil dieser sich weigert, das Mineralienabkommen mit den USA in der vorliegenden Form zu unterzeichnen", hebt die Zeitung WENHUIBAO aus Shanghai hervor.
Die Zeitung MÜSAVAT aus Aserbaidschan blickt auf den ukrainischen Präsidenten: "Wolodymyr Selenskyj ist derzeit alles andere als gewillt, dem Weißen Haus einen Gefallen zu tun. Selenskyj will nicht als das Staatsoberhaupt in die Geschichte eingehen, das ein Abkommen unterzeichnet hat, das die Ukraine in eine US-Kolonie verwandelt. Aus diesem Grund und um die Unterzeichnung des Rohstoff-Abkommens zu verhindern, will er im Sommer Präsidentschaftswahlen abhalten. Doch das könnte den US-Interessen einen vernichtenden Schlag versetzen. An einem Machtwechsel in der Ukraine ist das Weiße Haus in der gegenwärtigen Situation überhaupt nicht interessiert", meint MÜSAVAT aus Baku.
"Präsident Selenskyj steht vor einem Dilemma", heißt es in der ukrainischen KYIV POST: "Entweder er spielt mit US-Präsident Trump mit oder er verliert die amerikanischen Militärhilfen und Geheimdienstinformationen. Oder er kann geradlinig und direkt sein und muss sich ausschließlich auf die Europäer verlassen. Amerika kann nicht als Außenseiter oder Feind behandelt werden. Es muss wie ein Freund behandelt und respektiert werden, auch wenn es das derzeit nicht verdient."
US-Präsident Trump hat Spekulationen über eine dritte Amtszeit genährt. Dazu schreibt die schwedische Zeitung DAGENS NYHETER aus Stockholm: "Wenn uns die letzten Monate etwas gelehrt haben, dann ist es, dass man Trump Glauben schenken sollte, wenn er verrückte Dinge sagt. Wenn Trump jetzt auch noch mitteilt, dass er über eine dritte Amtszeit nachdenkt, obwohl das gegen die Verfassung ist, unterstreicht er, dass er es ernst meint. Es mag politisch betrachtet grotesk sein, ist aber zugleich die logische Fortsetzung des eingeschlagenen Wegs. Die Trump-Regierung fordert ununterbrochen das Grundgesetz heraus und rafft Macht an sich, die laut Verfassung eigentlich beim Kongress liegt. Aus europäischer Perspektive können wir nur hoffen, dass sich der Supreme Court dem Abbau der Demokratie widersetzt, aber auch hier sind Zweifel angebracht."