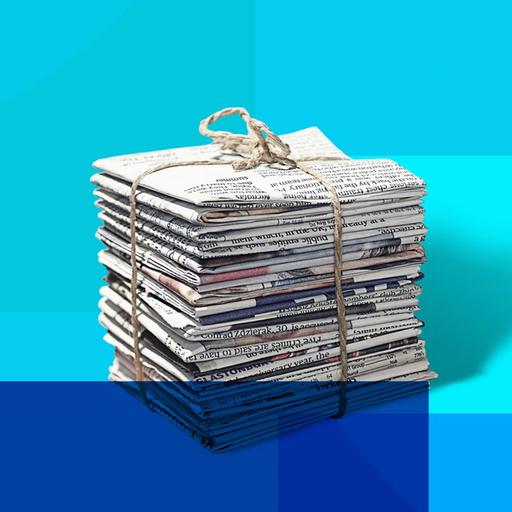"Donald Trump wirbelt mit seiner Handelspolitik die Weltwirtschaft durcheinander", lautet das Urteil in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG. "Im Kern verfolgt er damit eine Idee: Es sei notwendig, dass möglichst viele Güter wieder in den USA selbst hergestellt werden. Das hieße im Extremfall: keine Spielzeuge und Smartphones mehr aus China, keine Computerchips aus Taiwan, kein Wein aus Frankreich, keine Autos aus Deutschland, keine Medikamente aus der Schweiz. Trump huldigt der Vorstellung, dass nur einheimische Güter gute Produkte seien. Doch dieses Denken ist eine fundamentale Gefahr für den Wohlstand. Es spiegelt ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Prinzip der Arbeitsteilung, das große Teile der Welt in den vergangenen Jahrzehnten reicher gemacht hat. Wenn jedes einzelne Land alles selbst machen will, gibt es nichts mehr zu exportieren. Der Handel kommt zum Erliegen. Wer exportieren will, muss notwendigerweise akzeptieren, dass dies auch andere Länder tun", meint die NZZ aus der Schweiz.
"Am gefährlichsten für die Welt und vor allem für die USA ist, dass die Zollpolitik der Regierung so ideologisiert ist", glaubt die polnische RZECZPOSPOLITA. "In diesem Sinne beruft sich der von Trump genannte 'Tag der Befreiung' weniger auf die harten Regeln der Ökonomie als auf seine obsessive Überzeugung, dass Protektionismus für die USA heilsam sein wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ideologisierung der Zollfrage mit etwas einhergeht, was in der Geschäftswelt absolut untragbar ist: Chaos und Unberechenbarkeit. Die Märkte warten ungläubig auf Trumps Entscheidungen, als hätten sie es mit der Gruppenauslosung für die WM oder mit einer billigen Lotterie zu tun. Es ist unmöglich, in einer Welt mit unsicheren Regeln Geschäfte zu machen", vermerkt die RZECZPOSPOLITA aus Warschau.
"Am 'Tag der Befreiung' fragt man sich, wie viele Menschen die Gefangenen von Trumps Zöllen sein werden", heißt es in der italienischen Zeitung CORRIERE DELLA SERA aus Rom. "Wer wird eigentlich die Rechnung bezahlen? Und vor allem: Wie lange wird es dauern, bis sich viele Amerikaner gefangen fühlen von den Entscheidungen ihrer Regierung? Seit jeher stellen Zölle, und schlimmer noch ein Handelskrieg, einen Teufelskreis dar, ein negatives Summenspiel."
Und die portugiesische Zeitung CORREIO DA MANHA aus Lissabon erwartet: "Die Opfer werden zunächst die Amerikaner selbst sein, die mit Inflation für die Maßnahmen des Präsidenten bezahlen müssen. Aber auch die gesamte Weltwirtschaft wird leiden, weil die Grenzschließungen in Amerika eine globale Abkühlung zur Folge haben werden. Weniger BIP bedeutet weniger Arbeitsplätze, und mit der durch die Steuererhöhung verursachten Inflation, die die Zölle mit sich bringen, riskiert die Welt, in eine neue Stagflation zu geraten - mit geringem Wirtschaftswachstum, hoher Arbeitslosigkeit und hohen Preisen. Der Versuch des amerikanischen Isolationismus ist eine globale Tragödie."
Das chinesische Militär hat sein Manöver rund um Taiwan ausgeweitet. Die taiwanesische Zeitung ZHONGGUO SHIBAO analysiert: "Die Militärübung ist eindeutig ein erster Schritt in Richtung Kampfhandlungen. Die chinesischen Streitkräfte betrachten die gesamte Taiwanstraße inzwischen als chinesische Binnengewässer, denn die stillschweigende Verständigung auf eine Demarkationslinie in der Mitte der Meerenge ist von Peking seit dem vergangenen Jahr immer wieder gebrochen worden. Taiwan bleibt somit immer weniger Zeit, um zu erkennen, ob es sich um einen simulierten oder einen echten Angriff handelt. Weite Teile der Bevölkerung Taiwans haben leider immer noch nicht verstanden, dass sich Chinas Säbelrasseln nicht nur gegen die Unabhängigkeitsbefürworter in unserem Land richtet, sondern gegen unser gesamtes Gemeinwesen", meint ZHONGGUO SHIBAO aus Taipeh.
In der chinesischen Zeitung HUANQIU SHIBAO wird das Manöver folgendermaßen gerechtfertigt: "Diesmal nehmen auch chinesische Strafverfolgungsbehörden teil. Damit will man den separatistischen Kräften auf der Insel unmissverständlich zu verstehen geben, dass der Würgegriff umso fester sein wird, je heftiger sie sich gebärden. Die Verfechter der Unabhängigkeit Taiwans sollen wissen, dass es ihnen später nicht gelingen wird, von dort zu fliehen. Bei der Militärübung handelt sich um eine notwendige Maßnahme, um die Souveränität und Einheit des Landes zu schützen." Sie hörten einen Auszug aus der Zeitung HUANQIU SHIBAO, die in Schanghai erscheint.
"Das gestiegene Aggressionsniveau passt in die neue Weltordnung", resümmiert die schwedische Zeitung SYDSVENSKAN. "In ihr dominieren Großmächte wie die USA, China und Russland über das, was sie für ihre Interessensphäre halten. Dem zufolge darf der Kreml seinen Krieg in der Ukraine führen, und eine solche multipolare Weltordnung wird auch von China angestrebt. Bislang hat Washington fast kein Wort zu Taiwan verloren. Aber natürlich zieht Peking seine Schlüsse aus dem radikal veränderten Ton der USA gegenüber Russland und der Ukraine und aus Trumps Drohungen, Territorien anderer Länder zu erobern. So sieht sie aus, die neue Welt. Wir werden uns daran gewöhnen müssen", vermutet SYDSVENSKAN aus Malmö.
In Frankreich soll die Gerichtsentscheidung über die Berufung der verurteilten Rechtnationalistin Le Pen deutlich vor der Präsidentschaftswahl 2027 fallen. Die niederländische Zeitung DE VOLKSKRANT wirft ein: "Es ist gut, dass das Pariser Gericht angekündigt hat, das Berufungsverfahren bis zum Sommer 26 abzuschließen. Sollte der Ausschluss Le Pens dann bestätigt werden, hätte er eine solidere juristische Grundlage. Problematisch ist nämlich, dass Le Pens Ausschluss von Wahlen sofort in Kraft tritt, sodass ihre Teilnahme an der Präsidentschaftswahl 27 ungewiss ist. Dies ist ein tiefer Eingriff in den demokratischen Prozess: Rund 30 Prozent der Franzosen würden dadurch daran gehindert werden, für ihre Wunschkandidatin zu stimmen", gibt DE VOLKSKRANT aus Amsterdam zu bedenken.
Die Zeitung KRISTELIGT DAGBLAD aus Kopenhagen bemerkt: "Auch aus dem Ausland kommt Kritik daran, dass man die ultrarechte Politikerin mit juristischen Mitteln mundtot gemacht hat. Tatsächlich ist der Demokratie am besten gedient, wenn man solche Entscheidungen der Bevölkerung in der Form von Wahlen überlässt. Rein politisch betrachtet besteht kein Grund zu der Annahme, dass durch das Urteil in Frankreich irgendetwas einfacher wird. Die Bevölkerung ist nach wie vor polarisiert. Dafür aber könnte eine neue Dynamik im ultrarechten Lager entstehen und noch radikalere Kräfte als den Rassemblement National beflügeln", mahnt das KRISTELIGT DAGBLAD aus Kopenhagen.
In der französischen Zeitung LE FIGARO aus Paris lesen wir: "Die Strategie von Le Pen besteht nicht darin, den Schlachtplan schnell anzupassen. Sie besteht im Gegenteil darin, den Kampf fortzusetzen; solange es eine, wenn auch noch so kleine Aussicht auf eine Korrektur des Urteils in erster Instanz gibt. Das ist politisch logisch. Le Pen befindet sich in der Position eines Tennisspielers, der drei Matchbälle gegen sich hat, aber fest entschlossen ist, den Verlauf des Spiels umzukehren."
Die brasilianische Zeitung FOLHA DE SÃO PAULO mumaßt: "Noch steht zwar nicht fest, welche Auswirkungen die Verurteilung für den RN haben wird. Vermutlich wird aber Jordan Bardella die Führung übernehmen. Er gefällt der jüngeren Generation, auch wenn Kritiker auf seinen Mangel an Erfahrung verweisen."
Und im britischen GUARDIAN aus London hebt der Gastkommentator hervor: "Der kometenhafte Aufstieg von Bardella in den Umfragen erfordert eine rasche Reaktion der französischen Linken. Der Chef der Linkspartei, Mélenchon, muss in aufstrebende Talente investieren, die bei jüngeren Wählern Anklang finden - ähnlich wie Die Linke in Deutschland."