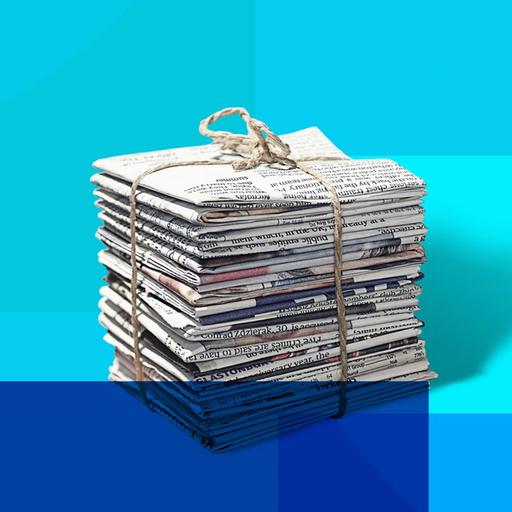Die polnische Zeitung RZECZPOSPOLITA vermutet: "Einer der Vorteile Chinas besteht darin, dass die Amerikaner – ähnlich wie Drogenabhängige – süchtig nach billigen chinesischen Produkten geworden sind, für die es in absehbarer Zukunft keinen Ersatz geben wird. Die Regale von Walmart und anderen großen Einzelhandelsketten sind voll davon. Sollten ihre Preise dramatisch steigen, würde dies zu einem Zusammenbruch des Lebensstandards derjenigen führen, die bislang Trumps Kernwählerschaft bildeten. Der Präsident kann dies nicht ignorieren", mahnt die RZECZPOSPOLITA aus Warschau.
Die türkische Zeitung YENI ŞAFAK erwartet, dass die US-Zölle auch die amerikanische Wirtschaft beeinflussen werden: "Es ist unmöglich, dass Washingtons Maßnahmen gegen China keine Auswirkungen auf den US-Handel, die Produktion internationaler Unternehmen, die Exporte, die Beschäftigung und die Kreditaufnahmekapazität haben werden. Die Erhöhung der Zölle auf ein irrationales Niveau ist keine umfassende Strategie, um all diesen Risiken zu begegnen und eine wirklich autarke US-Wirtschaft zu schaffen, die auch ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft bewahrt. Die Tatsache, dass Trump seinen Handelskrieg nicht nur gegen China, sondern auch gegen fast alle anderen Länder führt, macht seine Ziele noch unerreichbarer", hebt die in Istanbul erscheinende Zeitung YENI ŞAFAK hervor.
Der CORRIERE DELLA SERA betrachtet die Perspektive Europas im Handelskonflikt mit den USA: "Es heißt, dass Europa in dieser Konfrontation zerrieben wird. Verfolgt es die gleiche Politik wie Peking und Washington - Zölle und eine Einschränkung der Marktfreiheiten -, wird es wahrscheinlich so enden. Die große Frage ist, ob es stattdessen in der Lage sein wird, sich als ein Pol der Offenheit und des freien Unternehmertums zu präsentieren, die Handelsbeziehungen in der Welt auszubauen sowie die Reformen und die Deregulierung durchzuführen, von denen es seit Jahren spricht. Es ist nicht leicht zu glauben, dass dies gelingen wird. Aber vielleicht gibt es dazu wenig Alternativen", heißt es im CORRIERE DELLA SERA aus Mailand.
Die britische Zeitung THE GUARDIAN analysiert am Beispiel Vietnams die Folgen der US-Zölle auf Länder in Südostasien: "Vietnam hat versucht, Trump entgegenzukommen, hat Zölle auf US-Waren reduziert, hat Elon Musks Starlink-Projekt in dem Land zugelassen. Aber diese Strategie hat offensichtlich keinen Erfolg gehabt: Trump hat einen außerordentlichen Zoll von 46 Prozent auf Waren aus Vietnam verhängt, der die Wachstumspläne des Landes bedroht und die Beziehung beider Länder untergräbt. Amerikas Ruf als verlässlicher Partner in der Region ist beschädigt. Die südostasiatischen Regierungschefs müssen sich nun an Europa oder Japan halten – und gleichzeitig mit den USA verhandeln. Doch es ist unklar, was Länder wie Vietnam anbieten können, um Washington zu besänftigen." Das war der GUARDIAN aus London.
Für die dänische Zeitung POLITIKEN geht es gar nicht um einen Zollkrieg: "Vielmehr scheint das eigentliche Ziel von Trump zu sein, den Dollar zu schwächen. Das könnte China und andere Länder hart treffen. Ein billigerer Dollar könnte erst einmal die Wettbewerbsfähigkeit der USA stärken und die Handelsbilanz verbessern. Es würde billiger für das Ausland, amerikanische Waren zu kaufen. Und es würde teurer für die Amerikaner, im Ausland einzukaufen. Dieser Theorie nach würden auch wieder neue Industriearbeitsplätze in den USA entstehen, nachdem der zunehmende Freihandel der letzten Jahrzehnte zur Schließung von Fabriken führte. Aber das ist ein höchst riskantes Spiel, denn der Dollar würde seine Rolle als Reservewährung verlieren", warnt POLITIKEN aus Kopenhagen.
Aus Sicht der schwedischen Zeitung DAGENS NYHETER macht Trump einen Denkfehler: "Er versteht nicht, dass unterschiedliche Voraussetzungen in anderen Ländern dazu führen können, dass Käufer und Verkäufer von dem Ungleichgewicht profitieren. Wäre Apple gezwungen, sein Iphone in den USA zu produzieren, würde es mindestens 30.000 Dollar kosten. Es gäbe so wenige Käufer, dass es sich nicht lohnen würden. Selbst wenn es bei den asiatischen Zulieferern bessere Arbeitsbedingungen gäbe, wäre der Unterschied enorm", gibt DAGENS NYHETER aus Stockholm zu bedenken.
Themenwechsel. Die chinesische Zeitung MINGPAO geht ein auf eine Mitteilung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Demnach hat die Ukraine an der Front chinesische Soldaten festgenommen, die für Russland gekämpft haben sollen. "Selenskyj versucht jetzt, das Ganze an die große Glocke zu hängen. Dabei ist es gar kein Geheimnis, dass chinesische Staatsbürger in der Ukraine kämpfen, und zwar sowohl für die russischen Streitkräfte als auch auf der ukrainischen Seite. Der ukrainische Präsident will mit dieser aufgebauschten Nachricht die Aufmerksamkeit des Westens wieder auf sein Land lenken. Da es sich bei chinesischen Kämpfern ausnahmslos um Freiwillige handelt, ist es müßig, Verbindungen zur chinesischen Regierung konstruieren zu wollen", meint MINGPAO mit Sitz in Hongkong.
NIHON KEIZAI SHIMBUN aus Japan konstatiert einen Kurswechsel des ukrainischen Präsidenten im Umgang mit China: "Selenskyj vermeidet zwar eine direkte Kritik an Peking, aber er nimmt jetzt eine gewisse Distanz zu China ein. Grund dafür ist die aktuelle Lage an der Front, wo die Ukraine stark unter Druck steht. Wegen der stagnierenden Verhandlungen für eine Waffenruhe ist für das angegriffene Land weitere Hilfe aus den USA unabdingbar. China wiederum strebt Aufträge für Großprojekte im Rahmen des Wiederaufbaus der Infrastruktur in der Ukraine an. Allerdings wird die Führung in Peking möglicherweise ihre außenpolitische Strategie ändern müssen, wenn die Beziehungen zur Ukraine durch die Festnahme ihrer Soldaten Risse bekommen", vermutet NIHON KEIZAI SHIMBUN aus Tokio.
Die palästinensische Zeitung AL AYYAM beschäftigt sich mit dem Besuch des israelischen Premiers in Washington: "Benjamin Netanjahu prahlte damit, er sei der erste ausländische Staatschef, den Präsident Donald Trump nach seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus traf. Doch das Treffen der beiden Politiker verlief für Netanjahu enttäuschend. Es scheint, als kehrte er mit leeren Händen nach Hause zurück. Das ist insofern nicht erstaunlich, als die beiden Politiker einander sehr ähneln. Beide denken nur an sich selbst, die Kosten für andere sind ihnen gleichgültig. Insofern ist ihre Beziehung ein va-banque-Spiel: Mal decken sich ihre Interessen, mal kollidieren sie miteinander, und der jeweils andere nimmt darauf keinerlei Rücksicht. Allerdings ist Netanjahu in dieser Beziehung der deutlich Schwächere. Er weiß, dass seine Handlungsmöglichkeiten gegenüber Trump äußerst begrenzt sind", schreibt AL AYYAM aus Ramallah.
Die spanische Zeitung LA VANGUARDIA aus Barcelona verweist auf Proteste von Palästinensern, die ein Ende des Gazakriegs verlangen: "Ziel des Generalstreiks war es auch, die Untätigkeit der Weltgemeinschaft anzuprangern, die es in den vergangenen 18 Monaten nicht geschafft hat, den Konflikt zu beenden und Sanktionen gegen Israel zu verhängen: Die Welt interessiert sich zurzeit mehr für die wirtschaftlichen Auswirkungen der von Trump verhängten Zölle. Nachdem Israel am 18. März den Waffenstillstand in Gaza gebrochen hat, kann dieser de facto als beendet gelten. Seither hat die israelische Armee wieder angegriffen, Gebiete besetzt und Bewohner in die Flucht getrieben. Jeden Tag gibt es Todesopfer und die humanitäre Lage verschärft sich. Die Welt scheint sich daran gewöhnt zu haben, und das nutzt Netanjahu aus – trotz interner Kritik und den Forderungen, der Rückkehr der Geiseln den Vorrang vor der vollständigen Zerschlagung der Hamas zu geben", findet LA VANGUARDIA.