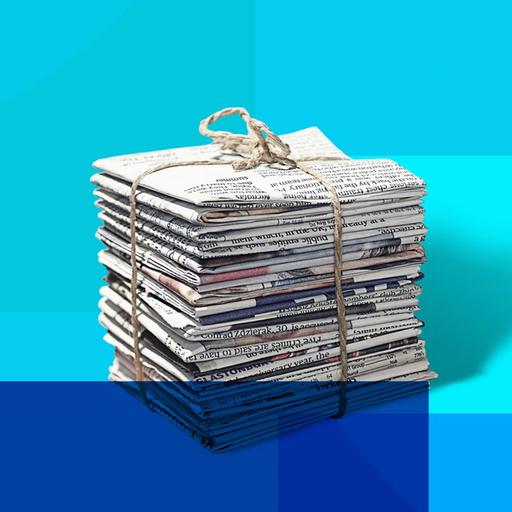Die NEW YORK TIMES erinnert an den Handlungsbedarf bei der deutschen Infrastruktur: "CDU-Chef Merz ermöglicht zwar höhere Ausgaben für das deutsche Militär. Beobachter wiesen aber darauf hin, dass jeder neue deutsche Panzer es schwer haben würde, eine deutsche Brücke zu überqueren. Das Land, einst gerühmt für seine industrielle Stärke, seine Autobahnen und seine grenzenlose Effizienz, bröckelt. Die Koalitionspartner haben sich verpflichtet, Planung, Genehmigung und Ausschreibungsverfahren zu beschleunigen. Die neue Regierung hofft, dass die Projekte die Wirtschaft ankurbeln und für diese langfristig auch bessere Grundbedingungen geschaffen werden", heißt es in der New York Times.
Die spanische Zeitung LA VANGUARDIA aus Barcelona notiert: "Deutschland kehrt zu der sogenannten großen Koalition zurück. Die Arithmetik nach den vorgezogenen Neuwahlen lässt keine andere Möglichkeit zu, wenn es eine stabile Regierung und eine Brandmauer gegen die Ultrarechten geben soll. Jetzt muss die neue Regierung zügig die größte europäische Volkswirtschaft wieder in Gang bringen und die seit zwei Jahren dauernde Rezession überwinden – und die europäische Verteidigung stärken helfen", mahnt LA VANGUARDIA aus Spanien.
Die tschechische Zeitung MLADÁ FRONTA DNES kritisiert: "Die neue Regierung von Merz kann als politikwissenschaftliches Handbuch dafür dienen, was vermieden werden sollte. In einer Gesellschaft, in der schon das Wort 'rechts' den Klang von Extremismus, ja fast Faschismus hat, verschwindet das Wettbewerbsmodell. Das Ideal besteht in einer sterilen Mitte und als einzige wirkliche Opposition betrachten viele die AfD, die durch eine 'Brandmauer' von jeglicher politischen und sozialen Zusammenarbeit abgetrennt ist. Es ist daher nicht verwunderlich, dass am Tag der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags die AfD - wenn auch nur um Haaresbreite - in Umfragen stärkste Partei wurde", ist in MLADÁ FRONTA DNES aus Prag zu lesen.
Die in Dublin erscheinende IRISH TIMES schreibt: "Angesichts von Donald Trumps offenkundiger Abkopplung von der Verteidigung Europas und seiner Zollpolitik braucht die schwächelnde deutsche Wirtschaft dringend eine starke Medizin. Und die EU braucht ein starkes Deutschland. Größere Sorgen dürfte den europäischen Verbündeten die Migrationspolitik machen, mit der die beiden Parteien auf die unheilvolle Bedrohung durch die nationalistische extreme Rechte reagieren. Sie versprechen, die Grenzkontrollen so lange aufrechtzuerhalten, bis Brüssel eine dauerhafte Form von funktionierenden Kontrollen der EU-Außengrenzen gefunden hat", hält die IRISH TIMES fest.
Die estnische Zeitung POSTIMEES hebt hervor: "Die deutsche Verteidigungspolitik ist für uns von besonders großem Interesse, und es scheint, als werde das Land in Windeseile aufrüsten. Noch vor wenigen Jahren hätte niemand eine solche Entwicklung vorausgesehen, und das übrige Europa wäre darüber auch alles andere als erfreut gewesen. Jetzt aber wird die Stärkung der deutschen Streitkräfte auf dem gesamten übrigen Kontinent begeistert begrüßt. Es lässt sich schon jetzt absehen, dass die Verteidigungsindustrie zum Motor der deutschen Wirtschaft wird", meint POSTIMEES aus Tallinn.
Die Zollpolitik von US-Präsident Trump ist Thema in der slowakischen Tageszeitung PRAVDA: "Trump und seine Wirtschaftsberater haben wohl absichtlich die Zölle in so maßlose Höhen getrieben, um die anderen Länder zu Verhandlungen mit den USA zu bringen. Und diese haben auch schon begonnen. Die Gespräche über eine 'Neuregelung' der Zölle werden nicht einfach. Eines aber wissen wir schon: Einen politischen Selbstmord und einen 'Mord' an der Wirtschaft der USA selbst zu begehen, hat Trump nicht vor", glaubt PRAVDA aus Bratislava.
Die japanische Zeitung YOMIURI SHIMBUN erklärt: "Durch die Turbulenzen der vergangenen Tage ist das Vertrauen in die USA massiv beschädigt, was es für ausländische Unternehmen unmöglich macht, in den USA sorgenfrei zu investieren. US-Finanzminister Bessent sagte, dass Japan als Erster in der Schlange der Staaten steht, die auf die Verhandlungen mit den USA warten. Die Regierung in Tokio sollte aber darauf achten, sich nicht vom Hin und Her aus Washington beeinflussen zu lassen und sich mit einer langfristigen Strategie an den Verhandlungstisch zu setzen. Wichtig ist ein enger Austausch mit der EU, Großbritannien oder dem südostasiatischen Staatenbund", empfiehlt YOMIURI SHIMBUN aus Tokio.
Die britische Zeitung GUARDIAN unterstreicht: "Trump behauptet, er habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil mehr als 75 Länder Bereitschaft gezeigt hätten, zu verhandeln. Das ist Nonsens. Der Zollkrieg hat ihm nichts gebracht. Er hat nicht gewonnen. Keiner hat verhandelt. Trump bemüht sich wie üblich, einen weiteren Triumph zu verkünden. Die schlichte Wahrheit ist, dass er einen Rückzieher gemacht hat, weil er dazu gezwungen war."
Die niederländische Zeitung DE VOLKSKRANT betont: "Jahrelang haben Anhänger der Demokratie ihre Hoffnungen auf 'die Institutionen' gesetzt, die als Gegengewicht zu Trumps Impulsen dienen könnten, nun ist endlich eine aufgetaucht: Die Wall Street. Der Kapitalismus hat rebelliert. Denn nach abstürzenden Aktienkursen, einer drohenden Rezession, Fernsehbildern von klagenden Verbrauchern und heftiger Kritik von den Milliardären, die Trump geholfen haben, dorthin zu kommen, wo er heute ist, musste er etwas tun, was er selten tut: Er zog einen schlecht durchdachten Plan zurück", folgert DE VOKSKRANT aus Amsterdam.
Die französische Zeitung LE FIGARO analysiert: "China hat seinen großen Colt auf den Tisch gelegt, gut sichtbar für den Cowboy aus Washington. Das Ergebnis: ein Fieberschub der amerikanischen Finanzwelt und Trumps Salto rückwärts. Die Europäer wie der künftige deutsche Bundeskanzler Merz sollten sich nichts vormachen: Der Rückzieher der USA erfolgte nicht als Reaktion auf ihre 'Entschlossenheit'. Wenn Europa vorübergehend von Trumps Maschinengewehrfeuer verschont bleibt, so ist dies vor allem der chinesischen Artillerie zu verdanken", stellt LE FIGARO aus Paris heraus.
Die in Taipeh erscheindende LIANHE BAO bemerkt: "Trump könnte China falsch eingeschätzt haben. Zum einen ist der Handel mit Amerika, der 16 Prozent im chinesischen Außenhandel ausmacht, für das Reich der Mitte gar nicht von existenzieller Bedeutung. Im Gegenteil kann China amerikanischen Industrien und Verbrauchern mit seinen seltenen Erden und Batterie-Materialen durchaus Schwierigkeiten machen. Zum anderen ist die chinesische Wirtschaft global so weit integriert, dass sie nicht mehr zu isolieren ist. In der heutigen Welt gewinnt ein Land an Einfluss, das vertrauenswürdig ist und zur globalen Stabilität beitragen kann. Trump hat mit seiner Unberechenbarkeit bisher nur das Gegenteil bewiesen", bemängelt LIANHE BAO aus Taipeh.
Die norwegische Zeitung AFTENPOSTEN erläutert: "China verkauft alles zwischen Himmel und Erde zu Niedrigpreisen in die USA. Es wird lange dauern, bis die USA das alles selbst produzieren oder anderswo erwerben können. Das kommunistische Regime hat einen großen Vorteil: Der Staat hat die Wirtschaft viel stärker im Griff und damit den längeren Atem. Der Plan ist, die Lücken zu füllen, die der Rückzug der USA aus allen möglichen Bereichen hinterlässt – von der Entwicklungshilfe für den globalen Süden über die Klimazusammenarbeit bis zum Krieg in der Ukraine. China ist vorbereitet auf einen Handelskrieg und hat nicht vor, zu kapitulieren – vielmehr nutzt es die Gelegenheit, sich mit anderen Staaten zu verbünden. Und dazu gibt es dank der wirtschaftliche Schläge Trumps gegen die ganze Welt allerhand Möglichkeiten."