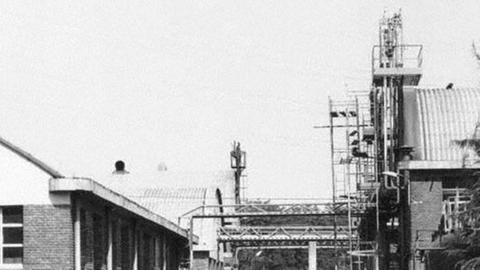Der ehemalige Sperrbezirk A in Seveso ist heute ein Naherholungsgebiet mit Wiesen, Bäumen und Parkbänken. Auf Schautafeln wird erklärt, was hier am 10. Juli 1976 geschah. Doch darüber reden will kaum einer mehr. Auch nicht der heutige Bürgermeister Clemente Galbiate.
"In Seveso lebt man gut, es ist ein ganz normaler Ort. Die Leute hier wollen einfach nicht mehr über das sprechen, was passiert ist. Heute, aber eigentlich schon seit 10 Jahren, haben sie keine Lust mehr, von dieser Sache zu reden."
Anders Max Fratter: Der 36-Jährige redet über den Dioxinunfall sogar gerne. Für ihn sind die Entseuchungsmaßnahmen, die Seveso vom Dioxin befreit haben, ein Paradebeispiel für Umweltschutz und ein Grund, stolz zu sein auf seine Heimatstadt. Der studierte Soziologe arbeitet im Umweltamt von Seveso und führt regelmäßig Schulklassen durch den Park.
"Alles, was damals verseucht wurde, liegt hier unter unseren Füßen. In zwei Metern Tiefe stößt man auf eine Plastikplane, dann auf eine Art künstliche Gesteinsschicht, und schließlich auf zwei riesige Wannen, in denen zuoberst die nicht so stark verseuchte Erde liegt und ganz im Inneren dann die Reste des Reaktors 101 aus der ICMESA-Fabrik, der noch einmal extra in einen Beton-Sarkophag eingeschlossen ist."
Die gesamte Fabrik ruht, in ihre Einzelteile zerlegt, unter dem grünen Rasen. Auch der Schutt der abgerissenen Häuser mit allem, was in ihnen war zum Zeitpunkt der Katastrophe.
Max Fratter verlässt den geschwungenen Spazierweg und steigt einen kleinen Hügel hinauf, der seltsam wirkt in der flachen Landschaft.
"Wir nennen ihn den "Hügel der Erinnerungen". Technisch gesehen ist er eine Giftmüllhalde, weil unter ihm eine der Wannen mit dem dioxinverseuchtem Material liegt, aber für uns enthält er nicht nur Müll. In den Häusern, die damals abgerissen werden mussten, waren die persönlichen Sachen der Bewohner, die Spielsachen der Kinder, die Bücher und Fotoalben der Familien, das alles liegt in dieser riesigen Wanne. Die Wanne mit der Fabrik aus Meda ist dagegen kleiner."
Max Fratter bleibt stehen und holt tief Luft. Er erinnert sich, als wäre der Unfall gestern passiert.
"”Wir wussten nichts am Anfang, absolut nichts. Erst 13 Tage später gab die "Givaudan" zu, dass in der Giftwolke Dioxin enthalten war. Zu dem Zeitpunkt hatten auch die italienischen Gesundheitsbehörden festgestellt, dass Dioxin ausgetreten war.""
Dramatische Tage waren das, im Juli 1976 in Seveso.
"Die Wolke ist am Samstag ausgetreten, am Dienstag oder Mittwoch darauf bekam meine Schwester Alice die ersten Pusteln. Eine Woche später hatte auch ich diese Pusteln. In der Zwischenzeit waren bereits einige Tiere gestorben und es wurde klar, dass etwas Schlimmes passiert war in der Gegend."
Stefania Senno ist heute 33 Jahre alt. Von dem aggressiven Hautausschlag, ausgelöst durch die Dioxinwolke, sind ihr Narben, fein und rund wie Stecknadeleinstiche, geblieben.
"Ich habe mein Leiden für mich behalten, es gab keine Freundinnen, mit denen ich hätte reden können und auch in meiner Familie durfte ich nicht darüber sprechen. Wehe, wenn ich das Thema anschnitt! Meine Schwester wollte nichts davon hören, meine Mutter auch nicht. Ich wurde ein Störfaktor, wenn ich zu reden begann oder auch wenn ich zu weinen begann."
Der Wunsch, zu vergessen, ist groß in Seveso.
Auch Denizia Auletta hat versucht, einen Strich zu ziehen unter die Tragödie von 1976. Als ihre jüngste Tochter fünf Monate nach dem Dioxinunfall, entgegen ärztlicher Befürchtungen, gesund zur Welt kam, dachte sie, die von Medizinern vorausgesagten Gesundheitsschäden seien nur ein böser Spuk, und alles gar nicht so schlimm, wie die Wissenschaftler behauptet hatten. Der Toxikologe Paolo Mocarelli, der die Einwohner von Seveso 15 Jahre lang regelmäßig auf Folgeschäden untersuchte, stimmt dem nicht zu.
"”Dioxin hat eine Wirkung auf den Menschen. Es stimmt nicht, dass es gar nichts anrichtet. Dioxin ist krebserregend. Und in der Tat: es hat einen Anstieg von Tumoren gegeben in Seveso. Ein Anstieg heißt: einige Tumore mehr als im Durchschnitt, keine hundert mehr.""
Mocarellis neuste Studien beweisen, dass Dioxin das menschliche Erbgut verändert. In Seveso werden seit dem Unfall mehr Mädchen geboren als Jungen. Auf welche Weise Dioxin wirkt, ist aber selbst heute, 30 Jahre nach dem Seveso-Unfall, noch nicht exakt entschlüsselt.
"In Seveso lebt man gut, es ist ein ganz normaler Ort. Die Leute hier wollen einfach nicht mehr über das sprechen, was passiert ist. Heute, aber eigentlich schon seit 10 Jahren, haben sie keine Lust mehr, von dieser Sache zu reden."
Anders Max Fratter: Der 36-Jährige redet über den Dioxinunfall sogar gerne. Für ihn sind die Entseuchungsmaßnahmen, die Seveso vom Dioxin befreit haben, ein Paradebeispiel für Umweltschutz und ein Grund, stolz zu sein auf seine Heimatstadt. Der studierte Soziologe arbeitet im Umweltamt von Seveso und führt regelmäßig Schulklassen durch den Park.
"Alles, was damals verseucht wurde, liegt hier unter unseren Füßen. In zwei Metern Tiefe stößt man auf eine Plastikplane, dann auf eine Art künstliche Gesteinsschicht, und schließlich auf zwei riesige Wannen, in denen zuoberst die nicht so stark verseuchte Erde liegt und ganz im Inneren dann die Reste des Reaktors 101 aus der ICMESA-Fabrik, der noch einmal extra in einen Beton-Sarkophag eingeschlossen ist."
Die gesamte Fabrik ruht, in ihre Einzelteile zerlegt, unter dem grünen Rasen. Auch der Schutt der abgerissenen Häuser mit allem, was in ihnen war zum Zeitpunkt der Katastrophe.
Max Fratter verlässt den geschwungenen Spazierweg und steigt einen kleinen Hügel hinauf, der seltsam wirkt in der flachen Landschaft.
"Wir nennen ihn den "Hügel der Erinnerungen". Technisch gesehen ist er eine Giftmüllhalde, weil unter ihm eine der Wannen mit dem dioxinverseuchtem Material liegt, aber für uns enthält er nicht nur Müll. In den Häusern, die damals abgerissen werden mussten, waren die persönlichen Sachen der Bewohner, die Spielsachen der Kinder, die Bücher und Fotoalben der Familien, das alles liegt in dieser riesigen Wanne. Die Wanne mit der Fabrik aus Meda ist dagegen kleiner."
Max Fratter bleibt stehen und holt tief Luft. Er erinnert sich, als wäre der Unfall gestern passiert.
"”Wir wussten nichts am Anfang, absolut nichts. Erst 13 Tage später gab die "Givaudan" zu, dass in der Giftwolke Dioxin enthalten war. Zu dem Zeitpunkt hatten auch die italienischen Gesundheitsbehörden festgestellt, dass Dioxin ausgetreten war.""
Dramatische Tage waren das, im Juli 1976 in Seveso.
"Die Wolke ist am Samstag ausgetreten, am Dienstag oder Mittwoch darauf bekam meine Schwester Alice die ersten Pusteln. Eine Woche später hatte auch ich diese Pusteln. In der Zwischenzeit waren bereits einige Tiere gestorben und es wurde klar, dass etwas Schlimmes passiert war in der Gegend."
Stefania Senno ist heute 33 Jahre alt. Von dem aggressiven Hautausschlag, ausgelöst durch die Dioxinwolke, sind ihr Narben, fein und rund wie Stecknadeleinstiche, geblieben.
"Ich habe mein Leiden für mich behalten, es gab keine Freundinnen, mit denen ich hätte reden können und auch in meiner Familie durfte ich nicht darüber sprechen. Wehe, wenn ich das Thema anschnitt! Meine Schwester wollte nichts davon hören, meine Mutter auch nicht. Ich wurde ein Störfaktor, wenn ich zu reden begann oder auch wenn ich zu weinen begann."
Der Wunsch, zu vergessen, ist groß in Seveso.
Auch Denizia Auletta hat versucht, einen Strich zu ziehen unter die Tragödie von 1976. Als ihre jüngste Tochter fünf Monate nach dem Dioxinunfall, entgegen ärztlicher Befürchtungen, gesund zur Welt kam, dachte sie, die von Medizinern vorausgesagten Gesundheitsschäden seien nur ein böser Spuk, und alles gar nicht so schlimm, wie die Wissenschaftler behauptet hatten. Der Toxikologe Paolo Mocarelli, der die Einwohner von Seveso 15 Jahre lang regelmäßig auf Folgeschäden untersuchte, stimmt dem nicht zu.
"”Dioxin hat eine Wirkung auf den Menschen. Es stimmt nicht, dass es gar nichts anrichtet. Dioxin ist krebserregend. Und in der Tat: es hat einen Anstieg von Tumoren gegeben in Seveso. Ein Anstieg heißt: einige Tumore mehr als im Durchschnitt, keine hundert mehr.""
Mocarellis neuste Studien beweisen, dass Dioxin das menschliche Erbgut verändert. In Seveso werden seit dem Unfall mehr Mädchen geboren als Jungen. Auf welche Weise Dioxin wirkt, ist aber selbst heute, 30 Jahre nach dem Seveso-Unfall, noch nicht exakt entschlüsselt.