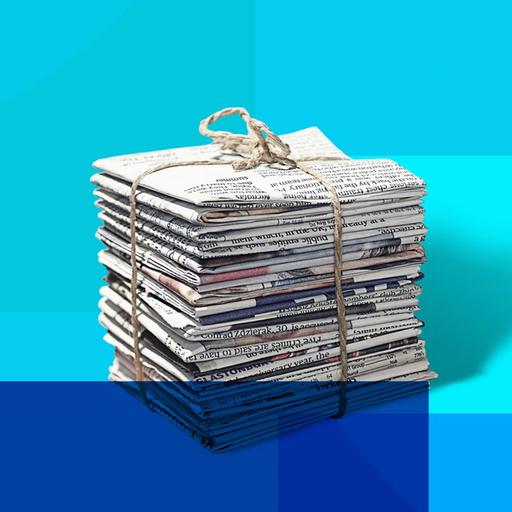Der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER kommentiert: "In der Tat hat sich Habecks mächtiger Staatssekretär Patrick Graichen einen groben Fehler erlaubt. Er saß in der Auswahlkommission für die bundeseigene Energie-Agentur und hat sich angeblich nichts dabei gedacht, dass sein Trauzeuge Kandidat für den Top-Job war. Das ist eine Torheit, die man Patrick Graichen nicht zugetraut hätte. Dennoch ist es übertrieben, daraus gleich einen Korruptionsskandal zu konstruieren. Es wurde niemand geschädigt, es wurden keine Milliardenaufträge ohne Kontrolle vergeben oder neue Posten geschaffen, um Günstlinge unterzubringen", bemerkt der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER.
Die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg notiert: "Es ist nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Patrick Graichen ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck von den Grünen. Graichens Bruder Jakob arbeitet für das Öko-Institut, das vom Ministerium Millionen für Projekte erhält. Auch die gemeinsame Schwester Verena arbeitet dort. Sie ist verheiratet mit Michael Kellner, auch von den Grünen und Staatssekretär im Ministerium. Nun wurde bekannt, dass Graichens Trauzeuge Michael Schäfer Geschäftsführer bei der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur werden soll. Dass familiäre und persönliche Bindungen bestehen, ist per se nicht anrüchig. Dennoch wirft der Fall Fragen auf wie diese: Gibt es in Deutschland niemanden, der sich in der Klimapolitik auskennt, aber nicht mit den Graichens verwandt, verschwägert oder eng befreundet ist?" Sie hörten die BADISCHE ZEITUNG.
Die FRANKENPOST aus Hof führt aus: "Graichen habe ein regelrechtes Familienministerium eingerichtet, kritisiert die Union, andere Teile der Opposition sprechen gar von 'Clan-Strukturen'. Diese Vorwürfe gilt es aufzuklären – mit allen Konsequenzen. Wer den Verdacht in Kauf nimmt, Vetternwirtschaft zu betreiben und mit Kalkül Posten zu besetzen, die die eigene Legislaturperiode überdauern, schadet der Demokratie, stärkt die politischen Ränder und fördert massiv die Politikverdrossenheit."
Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg sieht die Verantwortung beim Ressortchef selbst: "Das hatten wir lange nicht: Ein Bundesminister durchsetzt sein Ressort neben den üblichen Parteigängern auch noch mit Familienangehörigen und persönlichen Buddies. Auf höchster Ebene wohlgemerkt und nicht als Aktentaschenträger. Das entsprechende Salär garantiert, beim Misslingen politischer Vorhaben ganz weich zu fallen. Damit lässt es sich auch gut über Moral schwadronieren, was bei Verantwortungsträgern der Grünen unbedingt dazugehört. Habeck muss seinen Laden schnellstens aufräumen. Sonst kann er die Sachen packen", ist die VOLKSSTIMME überzeugt.
Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG hebt hervor: "Der Vertrauensbruch wiegt umso schwerer, als dass Graichen und Habeck mit der Energiewende und dem Heizungstauschgesetz gerade tief in das Leben der Menschen eingreifen. Von den Bürgern Opfer verlangen und zugleich den Eindruck erwecken, Macht und Posten zum eigenen Vorteil zu nutzen: Das ist eine toxische Mischung. Das zerstört Akzeptanz, anstatt sie zu schaffen. Das verstärkt das Gefühl vieler von 'die da oben und wir hier unten'."
Nun zur Wahl des neuen Regierenden Bürgermeisters in Berlin. Drei Wahlgänge waren nötig, bis eine Mehrheit für CDU-Politiker Wegner zustande kam. Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG fragt: "Was bedeutet der verunglückte Start für die Perspektive der schwarz-roten Koalition und damit der Hauptstadt? Im besten Fall ist der Schrecken in beiden Parteien so groß, dass es die konstruktiven Kräfte auf beiden Seiten zusammenschweißt. Die Koalition hätte dann mehr Stabilität, als es ihr Start vermuten lässt. Viel für einen Erfolg des Senats wird von der inneren Stabilität der Partner abhängen. Die SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh haben drei von fünf Senatsposten ihrer Partei an pragmatische Parteilinke vergeben. Das könnte dazu beitragen, dass die Pläne im linken Flügel, die Führung zu stürzen, vielleicht doch nicht zum Erfolg führen", meint die F.A.Z.
Der TAGESSPIEGEL aus Berlin stellt heraus: "Dass es entweder die Stimmen oder die Angst vor der AfD brauchte, ist als destruktives Misstrauensvotum aus beiden Fraktionen gegenüber dem neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und den beiden SPD-Vorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh zu verstehen. Bei der SPD rächt es sich jetzt, dass die Gründe für den seit Jahren anhaltenden Verfall nie aufgearbeitet wurden. Dass sich die Partei trotz immer schlechterer Ergebnisse mit wechselnden Partnern in immer neue Koalitionen retten konnte, begünstigte den Selbstbetrug – und einen Hochmut, dessen vorläufiger Höhepunkt erreicht war, als Giffey nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags erklärte: 'Ich glaube, jetzt steht an, dass Berlin mich braucht.' Tatsächlich brauchte Giffey die CDU: Das Bündnis war ihre einzige Chance, in einer führenden Position zu bleiben. Wie stark der Ärger darüber ist, hat die Basisabstimmung gezeigt. Das war keine vorbildliche demokratische Auseinandersetzung, sondern eine teils brutal geführte Abrechnung untereinander", unterstreicht der TAGESSPIEGEL.
Der KÖLNER STADT-ANZEIGER schreibt über Wegner: "Seine Wahl ist ein Menetekel. Nicht weil der CDU-Politiker erst im dritten Wahlgang gewählt wurde, sondern weil er einer schwarz-roten Koalition vorsteht, die von wesentlichen Teilen zumindest der SPD gar nicht gewollt wird - und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass Wegner mit Stimmen der AfD ins Amt kam. Der Vorgang hat überregionale Bedeutung. Er zeigt abermals, wie brüchig die Demokratie geworden ist. Der Eindruck, bei uns sei im Kern noch alles stabil: Er täuscht", befindet der KÖLNER STADT-ANZEIGER.
Abschließend zum Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Die FRANKFURTER RUNDSCHAU erläutert: "Die Gewerkschaft EVG denkt im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn laut über wochenlange Streiks nach. Um den großen Stillstand zu vermeiden, wird sich die Bahn bewegen müssen. Denn die EVG ist in diesem Jahr wild entschlossen. Sie will eine zeitnahe Lohnerhöhung möglichst ohne Einmalzahlungen und Garantien, dass die Löhne in den untersten Gehaltsklassen kräftig steigen. Dass Bahn-Verhandler gebetsmühlenartig vom 'historisch höchsten Angebot in der Geschichte der Bahn' reden, macht bestenfalls in der Öffentlichkeit Eindruck. Die Bahner wissen, dass sie auch unter einer der höchsten Inflationsraten in der Geschichte des Landes leiden. Dass insbesondere die Lohnuntergrenzen für die vergleichsweise wenigen Geringstverdiener bei der Bahn für Streit sorgen, wirkt nicht, als sei man dort an einer Lösung interessiert, sondern eher an einem Stillstand", kritisiert die FRANKFURTER RUNDSCHAU.
Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG schreibt über die Tarifparteien: "Es wirkt, als säßen da zwei Trotzköpfe im Kinderabteil, die nicht miteinander können. Sie sollten sich jetzt endlich zusammenreißen. Das gebietet einerseits der Respekt vor den 180.000 Bahn-Beschäftigten, von denen viele schnell höhere Löhne brauchen. Und andererseits der Respekt vor den Millionen Menschen in Deutschland, die mit der Bahn zur Arbeit, zur Familie oder in den Urlaub fahren. Sie sollten nicht monatelang mit Streiks traktiert werden. EVG und Bahn müssen jetzt zeigen, dass auch bei ihnen die Sozialpartnerschaft noch funktioniert", notiert die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.
Die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG aus Heidelberg konstatiert: "Bei den Bahn-Tarifverhandlungen liegt ein Kompromiss zum Greifen nahe. Diese Situation rechtfertigt keinen weiteren Ausstand. Das, was jetzt passiert, ist deshalb leider die beste Werbung gegen die Schiene - und für das Auto. Lieber im Stau etwas verspätet ans Ziel, als nie abfahren."