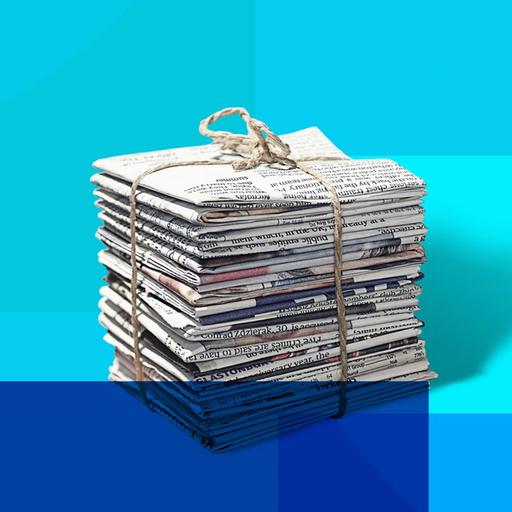Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG schreibt: "Die Ampel hat sich auf einen Haushalt geeinigt, mit dem alle irgendwie leben können, trotz diverser Kürzungen. Darauf, angesichts knapperer Mittel wirkliche Prioritäten zu setzen, konnte sie sich jedoch nicht einigen. Aber die Aussichten sind zu düster für eine unentschiedene Politik. Die Wirtschaft schwächelt, die nächste Steuerschätzung dürfte eher neue Sorgen als Erleichterungen bringen, und der Gestaltungsspielraum der Regierung schrumpft in dem Maße, in dem die Zinslasten im Haushalt steigen. Die Auseinandersetzungen um den Haushalt 2024 dürften deshalb schon bald als putzig empfunden werden, wenn der Haushalt 2025 aufgestellt werden muss", warnt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.
Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG notiert: "Lindners Rede, die Regierungserklärung eines imaginären Kabinetts, passte mehr zu einer schwarz-gelben Koalition als zur real existierenden Ampel. Er sah künftige Regierungen auf hoher See vor vielen gefährlichen Eisbergen. Was anderes sollte das heißen als: Wir sind auf der Titanic unterwegs, wenn wir nicht schnell und gründlich korrigieren. In seiner Traumregierung ist das sicher möglich. Doch schon am Morgen erlebte der Bundestag, wie die wirkliche ist. Wenn Wunsch und Wirklichkeit wieder übereinstimmen sollen, ist klar, was Lindner tun müsste. Aber noch spielt er die erste Geige in einem Orchester, das dem Dampfer bis zum bitteren Ende die Treue hielt", stellt die F.A.Z. fest.
DIE TAGESZEITUNG mahnt: "Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau schätzt die Kosten der Transformation auf 5 Billionen Euro bis Mitte des Jahrhunderts. Was fehlt, ist ein langfristiger politischer Plan, wie diese gemeistert werden kann. Derzeit stranguliert sich die Ampel selbst, indem sie zwar einerseits keine Schulden machen will, aber andererseits darauf verzichtet, riesige Vermögen und Gewinne abzuschöpfen. Lindner agiert wie die Hausfrau im Reihenhäuschen, die das Geld zusammenhält, während die Nachbar:innen anbauen und das Dach mit Photovoltaik pflastern. Dafür werden sie ihn belächeln. Aber nicht bewundern", prophezeit die TAZ.
Die SÜDWEST-PRESSE aus Ulm vermerkt: "Spätestens dann, wenn die Steuereinnahmen nicht mehr so üppig ausfallen wie in den letzten Jahren und dieser Trend anhält, muss langfristig auch das Fass 'Steuererhöhungen' aufgemacht werden, auch wenn Finanzminister Lindner davon nichts wissen will. Denn zum Argument 'Generationengerechtigkeit' gehört, dass nicht nur möglichst wenig Schulden angehäuft werden. Dazu gehört auch, dass schon jetzt mehr Einnahmemöglichkeiten genutzt werden - beispielsweise durch eine Reform der Erbschaftsteuer", schlägt die SÜDWEST-PRESSE vor.
Die PFORZHEIMER ZEITUNG kritisiert: "Es wird für die nächsten Regierungen und Generationen immer schwieriger werden, das den Jüngeren zu verklickern. Daher ist ein Sparhaushalt nicht nur eine Bürde. Sondern auch die Chance zum Ehrlichmachen. Der Bundeszuschuss zur Rente wird auf Dauer nicht zu halten sein. Der geplante schuldenfinanzierte Ausbau der Aktienrente kann diese Mehrbelastung nicht auffangen. Die Pflege und Krankenversicherung pfeift trotz Reformen finanziell aus dem letzten Loch. Die Wirtschaft schwächelt. Das Anspruchsdenken, das auch die Krisen der vergangenen Jahre bestimmt hat, wird nicht mehr aufgehen", glaubt die PFORZHEIMER ZEITUNG.
Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG fragt: "Wollte diese Koalition nicht genauer hinsehen, vieles auf den Prüfstand stellen? Fehlanzeige. Auch beim versprochenen Abbau von klimaschädlichen Subventionen ist die Ampel sich nicht einig – und deshalb noch keinen Schritt weitergekommen. Investitionen in Sicherheit und Klimaschutz werden im Etat nicht abgebildet, sondern in sogenannten Sondervermögen versteckt. Ehrlicher wäre es, von Sonderschulden zu sprechen. Christian Lindner ist also in Wirklichkeit nicht der Sparfuchs der Nation. Sein Etat beschreibt überwiegend den Status quo. Ein Zukunftskonzept ist er nicht", kommentiert die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG.
CDU-Chef Friedrich Merz sagte bei einem Auftritt in Bayern, dass der Ort Gillamoos Deutschland sei - Berlin-Kreuzberg aber nicht. Die DITHMARSCHER LANDESZEITUNG aus Heide stellt fest: "Manchmal braucht man keine Parteifreunde mehr, wenn man solche politischen Gegner hat. Da bringt CDU-Chef Merz den Vorwurf, die Ampel mache Politik für urbane Szenemilieus statt für die Mehrheit der Deutschen, auf einen bierzeltgemäßen Punkt - und die getroffene Bezirksbürgermeisterin reagiert mit Empörung in Gendersprech und dem ritualisierten Loblied auf die Vielfalt. So ganz falsch kann Merz wohl nicht gelegen haben", ist in der DITHMARSCHER LANDESZEITUNG zu lesen.
Die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg argumentiert: "Offenbar war Merz der Meinung, zum Lodenjanker passe besser ein populistischer Zungenschlag als die ernsten Töne, die die Unionsfraktion unter seiner Führung bei der Klausur im sauerländischen Schmallenberg in der vergangenen Woche angeschlagen hatte. Dieses erratische Hin-und-Herschlingern zwischen Stammtisch-Jargon und staatstragender Analyse zeigt, wie sehr die Union eine grundsätzliche Besinnung nötig hat", konstatiert die BADISCHE ZEITUNG.
Der MANNHEIMER MORGEN hält fest: "Merz scheint sich jedoch für die Vielfalt Kreuzbergs so wenig zu interessieren wie für die Diversität Niederbayerns. Und auch letztere ist vermutlich bereits heute größer als er denkt. Vielleicht muss Merz noch länger beim Gillamoos bleiben, bis er erkennt, dass in Niederbayern im Jahr 2023 ziemlich viel Kreuzberg steckt."
Die Eröffnung der Internationale Automobilausstellung in München ist Thema in der MITTELDEUTSCHEN ZEITUNG aus Halle: "So zeigt die Messe nicht wie früher den Vorsprung, sondern vor allem den enormen Zugzwang, unter dem Deutschlands wichtigste Industriebranche steht. Fairerweise muss man sagen: Das gilt für alle traditionellen Autohersteller. Ob Ford in den USA, Toyota in Japan oder Renault in Frankreich - alle sehen buchstäblich alt aus neben Tesla oder BYD. Diese neuen Konkurrenten sind direkt in die Elektromobilität gestartet. Ein Verbrennererbe in Form von Maschinen und tausenden Mitarbeitern haben sie nicht, Transformation brauchen sie nicht. So ist es zwar oft berechtigt, aber immer auch ein bisschen billig, der Autoindustrie die Dauer dieser Transformation vorzuwerfen", befindet die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG.
Die STUTTGARTER NACHRICHTEN bemängeln: "Schon heute sind die Anteile der Deutschen an Chinas E-Auto-Absatz verschwindend gering. Sie haben den angriffslustigen Herstellern dort bisher zu wenig entgegenzusetzen. Inzwischen zeigen chinesische Hersteller großes Selbstbewusstsein, auch auf der IAA in München, wo vor allem BYD stark vertreten ist. Sie merken, dass die einst unangefochtenen Technologieführer aus Deutschland mit der Elektromobilität angreifbar geworden sind. Und sie sind entschlossen, diese Schwäche zu nutzen", vermuten die STUTTGARTER NACHRICHTEN.
Die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG analysiert: "Die größte Stärke der Automobilhersteller ist auch die größte Schwäche: Systeme werden akribisch perfektioniert – bis andere Lösungen undenkbar sind. Heraus kommen phänomenale Einspritzdüsen, die ein E-Motor nicht braucht. Die deutsche und europäische Politik ist bei diesem Systemwechsel leider selten eine Hilfe, weil sie die Zukunft auch nicht früher erkennt, den Weg dorthin aber gern kompliziert gestaltet. So ist jede große Veränderung quälend – aber wenn der Hebel umgelegt ist, wird es gut."