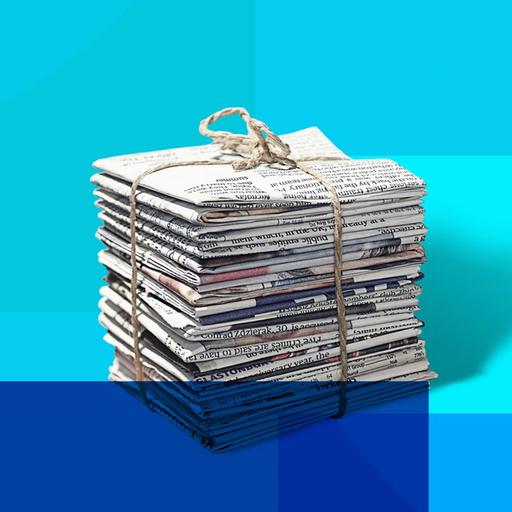Die FRANKFURTER RUNDSCHAU spricht von einer "Historischen Stunde im deutschen Parlament": "Erstmals hält ein Bundeskanzler eine zweite Antrittsrede - und das knapp zwei Jahre nach Beginn seiner Regierungszeit. Dabei wirbt er zugleich um eine ganz große Koalition: In einem Deutschland-Pakt sollen Bund, Länder, Kommunen und gerne auch die Opposition im Bundestag daran arbeiten, dieses Land voranzubringen. Eine wunderbare Idee, käme sie nicht von jemandem, der schon seit fast zwei Jahren als Chef im Bundeskanzleramt sitzt. Er muss die Reformen, die dieses Land nötig hat, nicht alleine durchführen. Doch es ist seine Aufgabe, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen", ist die FRANKFURTER RUNDSCHAU überzeugt.
Für den Berliner TAGESSPIEGEL liegt ein "Hauch von Groko in der Luft": "Scholz umgarnt und umarmt die Union. Er appelliert an eine 'nationale Kraftanstrengung', Kooperation statt Streiterei. Das Schattenboxen im Bundestag müsse ein Ende haben. Auch in der Regierung, seiner Ampelkoalition, sei zu viel gestritten worden. Ist das so? Wird in Deutschland, in der deutschen Politik, zu viel gestritten? Streit ist ein Wesensmerkmal der Demokratie. Eine Regierung braucht eine starke Opposition. Dem Igitt-Reflex auf Kontroverse, Widerspruch und Dissens haftet oft ein demokratieferner Widerwille gegen offene Debatten an. In der Ampel wird mitunter heftig gestritten. Allerdings muss es konstruktiv sein und Ergebnisse zeitigen", fordert der TAGESSPIEGEL.
Die RHEINISCHE POST aus Düsseldorf schreibt: "Den Streit in der Ampel bekommt der Kanzler nicht in den Griff, wenn er das überhaupt will. Also sucht er sein Heil jetzt zusätzlich bei anderen. Der 'Deutschlandpakt' ist somit auch ein Misstrauensvotum gegen die eigene Koalition. Denn vieles von dem, was Scholz beschleunigen und endlich entfesseln will, könnten die Partner mit ihrer Mehrheit schlichtweg machen oder auf den Weg bringen. Für anderes braucht man in der Tat die Länder und die Kommunen.Aber: Es ist und bleibt halt schwierig in der Ampel, weil sich alle Beteiligten angewöhnt haben, sich möglichst über Gegensätze zu profilieren", analysiert die RHEINISCHE POST.
Der REUTLINGER GENERALANZEIGER fragt: "Was hätte die Opposition davon, wenn Olaf Scholz mit dem Angebot Erfolg hätte? Nichts. Das weiß der Bundeskanzler. Deshalb ist der Deutschland-Pakt eher ein rhetorischer Trick. Um von der Uneinigkeit in der eigenen Regierung abzulenken, geht er nun mit offenen Armen auf seine Gegner zu. Immerhin kann Scholz dann behaupten, er habe alles versucht."
Die MEDIENGRUPPE BAYERN, zu der unter anderem die PASSAUER NEUE PRESSE gehört, hält nicht viel von Scholz' Idee: "Es mag ja sein, dass Regierung und Opposition sich in absoluten Ausnahmefällen zusammenkuscheln, wenn es z. B. darum geht, eine akute Gefahr für die Nation abzuwenden. Aber insgesamt ist diese Träumerei einfach zu schön, um wahr zu werden. Es wäre wohl eine gute Übung, liegt aber - leider - nicht im Wesen des demokratischen Wettbewerbs, von Machterhalt und -eroberung, dass die Opposition der Regierung dauerhaft aus der Patsche hilft. Davor muss der Kanzler seine Koalition auf Vordermann bringen und sich mehr einfallen lassen als den Versuchsballon eines Deutschlandpakts", meint die MEDIENGRUPPE BAYERN.
Ganz anders sieht es die TAZ: "War das die beste Rede, die Olaf Scholz jemals gehalten hat? Möglicherweise. Es war auf jeden Fall die richtige Rede am richtigen Ort, im richtigen Tonfall. Souverän parierte der Kanzler die erwartbaren Attacken der Opposition, indem er auf diese im Detail gar nicht allzu sehr einging. Dabei wirkte er wie ein gutmütiger Vater, der großzügig über das rüpelhafte Verhalten eines trotzigen Kindes hinwegsieht. Merz muss sich dazu nun verhalten. Gibt er den Staatsmann, der sich kooperativ zeigt? Oder will er weiter in der Trotzecke verharren? So oder so, Scholz hat ihn unterZugzwang gesetzt", heißt es in der TAZ.
Die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG aus Halle ergänzt: "Ob der 'Deutschland-Pakt' gelingen wird, hängt nicht nur davon ab, wie gut sich die Union einbringen will. Es ist auch entscheidend, wie Scholz sich ihr gegenüber verhält. Es ist nicht dienlich, wenn er Unionsfraktionschef Merz nach berechtigter Kritik 'Popanze' vorhält. Falls Scholz diesen Pakt wirklich will, muss er die Union stärker einbinden. Denn hält die AfD ihr Umfragehoch, wird sich Deutschland an Koalitionen mit vielen Partnern gewöhnen müssen. Der 'Deutschland-Pakt' wäre dafür eine gute Übung."
Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG notiert mit Blick auf die Augenklappe des Kanzlers: "Eingeschränkt blieb Scholz' Sichtfeld auch bei einem der wichtigsten Themen, das besonders Länder und Kommunen seit Monaten beschäftigt und seine Ampel-Regierung sträflich vernachlässigt. Die ungesteuerte Zuwanderung von Menschen ohne Anspruch auf Asyl muss gestoppt werden, weil sie von der Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wird. Solange die demokratischen Parteien sich dabei als nicht handlungsfähig erweisen, wird die AfD weiter an Zuspruch gewinnen."
Und der KÖLNER STADT-ANZEIGER schreibt: "Das ist ein mutiger Schritt. Und er ist bitter nötig. Doch der Weg wird steinig. Noch erscheint unklar, wie Scholz diesen Pakt aufsetzen will. Wenn von der Bundesministerin bis zum Bürgermeister alle demokratischen Parteien zusammenfinden sollen, müssen sie an einen riesengroßen Tisch gebracht werden. Der Kanzler greift den Ärger der Bürgerinnen und Bürger über die 'Jahre des Stillstands' im Land auf, den 'Mehltau', der die Wirtschaft lähmt. Er ist wahrhaftig nicht für alles verantwortlich. Aber wer, wenn nicht der Kanzler und seine Regierung haben es in der Hand, kraftvoll voranzugehen. Die Koalition aber streitet munter vor sich hin. Und davon haben die Menschen die Nase voll", konstatiert der KÖLNER STADT-ANZEIGER.
Und damit zum zweiten Thema, der Forderung der IG-Metall nach einer Vier-Tage-Woche plus Lohnerhöhung. Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG ist der Meinung: "Wenn das nicht mutig ist, was dann? Die Beschäftigten sollen weniger arbeiten, das aber für deutlich höhere Löhne - nur noch 32 Stunden je Woche für 8,5 Prozent mehr Geld. Ausgerechnet eine Branche, die unter den Bedingungen der neuen wackligen Energiepolitik einen historischen Umbau schaffen muss, soll also zum Versuchslabor für die angeblich moderne Vier-Tage-Woche werden. Und das mit nicht minder wackliger Begründung: Die kürzere Arbeitszeit sei gleichzeitig ein Rezept gegen Personalüberhänge und eines gegen Personalmangel, behauptet sie. Gute Werbung für noch mehr Mitgefühl der Steuerzahler ist das eher nicht. Tarifpolitisch bleibt indes ein Hoffnungswert: Bei aller Härte im Auftreten ist die IG Metall auch eine erfahrene Gewerkschaft - die in aller Regel irgendwann merkt, wo der Übermut beginnt", ist sich die F.A.Z. sicher.
Und die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG stellt die Frage: "Ob es so weise ist, als erste Branche die Stahlindustrie in einer Tarifrunde damit zu traktieren? Die immensen Energiepreise sind derzeit eine von mehreren Bedrohungen für den Stahlstandort Deutschland. Wer ihm nun die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich zumuten will, könnte in nicht allzu ferner Zukunft die Null-Tage-Woche bekommen; jedenfalls für viele der dort noch Beschäftigten. Es mag Branchen und Betriebe geben, in denen eine Vier-Tage-Woche sinnvoll ist. Etwa dort, wo die Beschäftigten entweder ein Gehaltsminus in Kauf nehmen oder an vier Tagen die Arbeit von fünf schaffen. Aber niemand sollte spekulieren, dass ein Durchbruch in der Frage just aus der Stahlindustrie kommt." Mit diesem Zitat aus der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG endet die Presseschau.