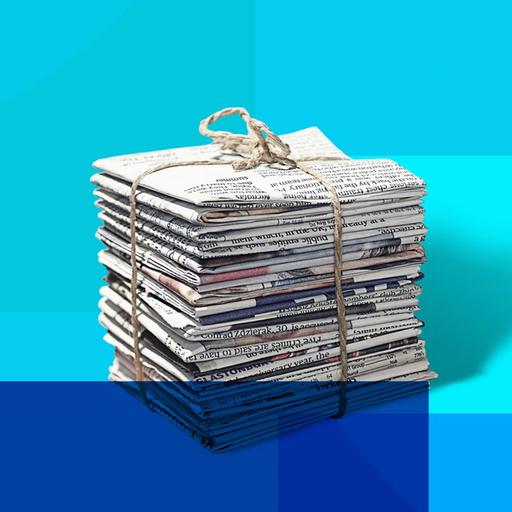Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG erläutert: "Dobrindt treibt mit seinem Vorschlag die Migrationsdebatte weiter und kennt wie die Politiker anderer Parteien nur ein Ziel: Die Zahl der ankommenden Menschen muss runter. Der Fokus darauf beschränkt die Perspektive. Man fragt sich, was passierte, wenn mit ähnlicher Kreativität und Durchschlagskraft drängende Reformen in der Migrationspolitik angegangen würden, die wirklich zu mehr Arbeitsverhältnissen führen könnten. Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang lauten: Wie können Berufsabschlüsse anerkannt werden? Wie können genügend Deutschkurse zur Verfügung gestellt werden? Dobrindt trägt nichts zu einer konstruktiven Debatte darüber bei. Er zeigt höchstens seine bittere Definition von Solidarität und die lautet: Wenn es unbequem wird, hört sie auf", urteilt die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG.
Dobrindts Forderung sei realitätsfremd und zynisch, findet die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: "Das beginnt bereits bei den angeblich sicheren Gebieten, die Dobrindt im Westen der Ukraine vermutet. Zwar schlagen dort vergleichsweise selten russische Drohnen und Marschflugkörper ein, aber auch Lwiw und andere Städte in dieser Region sind regelmäßig Ziel von Luftangriffen, bei denen Zivilisten getötet werden. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass geflüchtete Ukrainer im besten Fall einer Beschäftigung nachgehen sollten. In etlichen Branchen werden Arbeitskräfte auch dringend gesucht. Dazu muss man aber die Realität beachten: Von den 730.000 nach Deutschland geflüchteten Ukrainern im erwerbsfähigen Alter sind laut Bundesregierung zwei Drittel Frauen. Diese sind oft mit ihren Kindern geflohen, während der Mann nicht aus der Ukraine ausreisen darf, an der Front kämpft oder tot ist. Solchen Familien droht man schon aus Prinzip nicht mit Ausweisung", notiert die SÜDDEUTSCHE.
Die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG aus Heidelberg ist sich sicher: "Dobrindt fischt mit seinem 'Plan' nach Wählern, die glauben, es müsse jetzt mal gut sein mit der Solidarität. Es ist der Versuch, vor den Ost-Wahlen Stimmen von den Rechts- und Linkspopulisten zur Union zu ziehen. Mit seinem Vorschlag vergiftet er aber den Diskurs. Er macht Menschen, die vor Tod und Kriegsterror geflohen sind, zu einem Problem, dessen man sich aus wirtschaftlichen Gründen entledigen müsse. Damit entmenschlicht er die Geflohenen und relativiert das Leid in der Ukraine", argumentiert die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG.
Der SÜDKURIER aus Konstanz spricht von Stimmungsmache auf dem Rücken vor allem von Frauen aus der Ukraine und ihren Kindern: "Nichts anderes ist die Abschiebe-Forderung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der immer mal wieder gern den harten Hund gibt, um die rechte Flanke seiner Partei zu decken. Was er dabei unterschlägt: Aus der Tatsache, dass im europäischen Vergleich die vor Putins Krieg geflüchteten Ukrainerinnen in Deutschland in geringerem Maß einer Arbeit nachgehen, kann man keine Arbeitsunwilligkeit herleiten, die sich angeblich aus der Bürgergeld-Versorgung ergibt. Es war politischer Wille, diese Frauen nicht in Putzhilfen-Jobs zu vermitteln, sondern ihre Integration durch eine hochwertigere Beschäftigung zu ermöglichen", vermerkt der SÜDKURIER.
Die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG stellt fest, der CSU-Landesgruppenchef erwecke "den Eindruck, die zu uns geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer seien allesamt nicht gewillt, zu arbeiten. Aus der AfD, die so russlandfreundlich wie flüchtlingsfeindlich ist, ist man solche Äußerungen gewohnt. Aus den Unionsparteien kommend lassen sie Zweifel daran aufkommen, wie ernst es manche in CDU und CSU mit der Unterstützung der Ukraine und der Ukrainer meinen. In Migrationsfragen muss in Deutschland einiges geklärt werden und vieles besser laufen als bisher. Mit Populismus, Verkürzungen und Falschdarstellungen lässt sich jedoch nichts zum Besseren wenden", kritisiert die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG.
Dagegen meint die WESTDEUTSCHE ZEITUNG aus Wuppertal: "Tatsächlich steckt auch in den Forderungen des Ex-Verkehrsministers Wahres: Für die Arbeitsaufnahme von so vielen Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland muss mehr getan werden. Und das auf beiden Seiten. Eine Quote von nur rund 20 Prozent derer, die aus der Ukraine geflüchtet sind und hier einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen, ist deutlich länger als zwei Jahre nach Kriegsbeginn keine gute. Das hat mit zögerlich aufgelegten Integrations- und Sprachkursen zu tun auf der Angebotsseite, aber oft auch mit der Bereitschaft zur Teilnahme unter den Geflüchteten, die an eine schnellere Rückkehr in ihr Heimatland geglaubt hatten." So weit die WESTDEUTSCHE ZEITUNG und so viel zu diesem Thema.
Die MEDIENGRUPPE BAYERN, zu der unter anderem der DONAUKURIER gehört, geht ein auf die China-Reise von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Dieser sei nicht "als diplomatischer Duckmäuser aufgetreten, sondern hat durchaus deutliche Worte gewählt. Zum Beispiel, als er betonte, dass die chinesische Unterstützung für Russland die Beziehungen mit Europa belaste. Habeck warnte die Gegenseite vor wirtschaftlicher Abschottung und vor unfairem Wettbewerb. Dafür erhielt er verbal Kontra, so etwas wird im Nachhinein gern als 'ehrlicher, konstruktiver Meinungsaustausch' bezeichnet. Im Streit um mögliche EU-Zölle auf chinesische Elektroautos gab der Grünen-Politiker den Vermittler. Offenbar mit gewissem Erfolg, denn die Chinesen erklärten sich zu Verhandlungen mit Brüssel bereit", schreibt die MEDIENGRUPPE BAYERN.
Die TAGESZEITUNG beobachtet: "Kanzler Scholz brachte bei seiner letzten Reise im April die wahren Konfliktpunkte nur kaum über die Lippen und spricht sich aus Angst vor Vergeltung auch jetzt gegen Zölle auf chinesische E-Auto-Importe aus. Außenministerin Baerbock wiederum prangerte während ihres Pekingbesuchs ein Jahr zuvor zwar die Menschenrechtslage an, bat aber zugleich um Zusammenarbeit im Klimaschutz. Habeck hat das anders gemacht. Er hat mit klaren Worten aufgeführt, welche wirtschaftlichen Konsequenzen Pekings Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben werden." Sie hörten einen Kommentar der taz.
Nun noch Meinungen zum Besuch des argentinischen Präsidenten Milei in Berlin. Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG führt aus: "Javier Milei ist in Europa das Feindbild vieler Linken. Doch es ist zu billig, den argentinischen Präsidenten pauschal zu verteufeln. Womöglich sind seine ultraliberalen Reformen ein probates Mittel, um Argentinien von Hyperinflation und Klientelpolitik zu befreien. Sollte ihm das gelingen, könnte das Millionen Menschen ein besseres Leben ermöglichen. Genauso vorschnell wie die Verteufelung Mileis sind aber auch die Lobpreisungen, mit denen die Berliner Hayek-Gesellschaft den Politiker am Wochenende überschüttet hat. Seine Nähe zu Rechtspopulisten in Europa disqualifiziert ihn als Maskottchen der Liberalen. Milei in eine Reihe mit Politikern wie Ludwig Erhard zu stellen, könnte sich als schwerer Fehler erweisen", mahnt die F.A.Z.
Die AUGSBURGER ALLGEMEINE zieht einen Vergleich: "Javier Milei hat, was Olaf Scholz nicht hat – Popularitätswerte von deutlich über 50 Prozent und einen Ruf wie Donnerhall. Wahlweise als libertär oder rechtspopulistisch beschrieben, ist der argentinische Präsident der denkbar größte Gegenentwurf zum deutschen Kanzler: Laut, polarisierend, von der globalen Linken geächtet, in der Sache aber durchaus erfolgreich. Die Inflation in Argentinien ist unter ihm von 25 auf vier Prozent gesunken und der Staatshaushalt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ausgeglichen. Die etwas verschämte Art, mit der Milei im politischen Berlin empfangen wurde, sagt allerdings mehr über Scholz aus als über seinen umstrittenen Gast", folgert die AUGSBURGER ALLGEMEINE zum Ende der Presseschau.