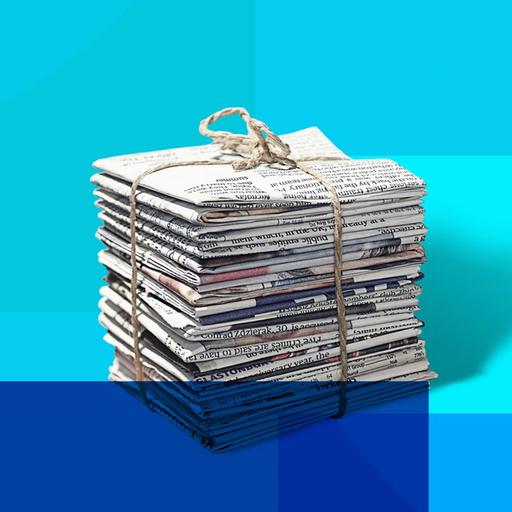Dazu schreibt das HANDELSBLATT: "Was fehlt, ist der Blick nach vorn. Warum Merz und Scholz nicht von sich aus über Bildung, Innovation, Künstliche Intelligenz und Forschung sprachen, bleibt ein Rätsel. Ein Kanzler sollte eine Vision für das Land entwickeln und die geopolitischen Entwicklungen in den Blick nehmen. Unsere Autoindustrie sucht Wege aus der Krise, und andere verdienen bald viel Geld mit Biotechnologie, Robotik oder Quantencomputern. So kann es nicht weitergehen. Doch während US-Präsident Trump voll auf KI setzt, ist sie Merz und Scholz in einer so wichtigen Debatte kein Wort wert. Ebenso wenig geben sie eine Antwort auf die Frage, wie wir all die klugen Köpfe aus dem Ausland dafür gewinnen wollen, in Deutschland zu arbeiten", kritisiert das HANDELSBLATT aus Düsseldorf.
Die VOLKSSTIMME führt aus: "Die Standpunkte von Herausforderer und Kanzler sind sattsam bekannt, bei den Umfragen gibt es seit Wochen keine wirkliche Bewegung mehr. Dieser 90-Minuten-Schlagabtausch ohne schmerzhafte Schläge dürfte vielmehr der erste Baustein für eine schwarz-rote Koalition nach dem 23. Februar gewesen sein", vermutet die VOLKSSTIMME aus Magdeburg.
Die FREIE PRESSE hält fest: "Auch wenn Scholz laut einer Umfrage das TV-Duell gegen Merz knapp für sich entschieden hat, weiß mittlerweile vermutlich sogar sein Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt: Es bräuchte ein echtes Wunder, damit Scholz Kanzler bleibt. Merz muss also bereits jetzt intensiv über den Tag nach der Bundestagswahl nachdenken – und darüber, wie er Brücken zur SPD in der Zeit nach Olaf Scholz bauen möchte", gibt die FREIE PRESSE aus Chemnitz zu bedenken.
Das Magazin CICERO beobachtet: "Die SPD versucht verzweifelt, den Wahlkampf auf die Auseinandersetzung zwischen Scholz und Merz zu reduzieren. Scholz benutzte bewusst Begriffe wie 'doof' oder 'lächerlich' für Merz-Positionen. Das Kalkül: Der Herausforderer könnte sich so ärgern, dass er aus der Haut fährt. Doch diese Rechnung ging nicht auf: Merz bewahrte die Contenance. Das wiederum ließ den Titelverteidiger wie einen aggressiven Herausforderer aussehen, dessen wilde Schläge an der Deckung des Gegners abprallten."
Die FRANKFURTER RUNDSCHAU lobt den Umgang der beiden Kandidaten miteinander: "Man kann hart diskutieren, ohne sich gegenseitig herabzuwürdigen. Auch wenn die Krawallmacher:innen von der AfD das gerne anders hätten: Es ist möglich, in diesem Land hart, aber sachlich zu streiten. Auch dann, wenn es um etwas geht. Die Bundesrepublik ist weit von einem Populismus-Wahlkampf US-amerikanischer Art entfernt."
Ähnlich argumentiert die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: "Die Deutschen sollten froh sein, vor einer solchen Alternative zu stehen: Scholz oder Merz. Beiden lässt sich Kompetenz nicht absprechen, dem einen, Scholz, weil er so lange schon in Regierungsverantwortung ist, dem anderen, Merz, weil er nicht nur die Welt der Politik kennt, sondern auch die der Wirtschaft und Finanzen. Beiden lässt sich ebenso wenig absprechen, eine Vorstellung davon zu haben, wie es mit Deutschland weitergehen soll. Dass sie dabei keine Wolkenkuckucksheime oder Barrikaden aufbauen, ist der dritte Grund, warum selbst ein Schlagabtausch zwischen den beiden wie der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine beruhigende Wirkung hat", konstatiert die F.A.Z.
Die Zeitung DIE WELT notiert: "Es ist eher nicht zu erwarten, dass just dieses TV-Duell viel an den Umfragen verändern wird, aber immerhin ist nun einmal mehr klar, welche Positionen sich hier gegenüberstehen. Eindämmung der illegalen Migration, Fastenkur für den fetten Sozialstaat, keine Steuererhöhungen – das wäre dann Team Merz. Wer allerdings Spitzenverdiener höher besteuert sehen will, kein Problem mit weiteren Schulden hat und gegen Gendersternchen immun ist, wäre wohl bei Scholz besser aufgehoben."
Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG fasst zusammen: "90 Minuten lang musste der Kanzler nicht nur gegen Merz andiskutieren, sondern gegen die eigene Bilanz. Im Streit über die Migrationspolitik reihte Scholz wie gewohnt Zahl an Zahl, was am Gefühl einer großen Mehrheit im Land nichts ändert, dass der Staat die Kontrolle verloren hat und so Mitverantwortung trägt für die Toten von Aschaffenburg, Magdeburg und anderen Orten. Mindestens so schwer wiegt die schlechte wirtschaftliche Lage. Scholz verwies auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die zunächst explodierenden Energiepreise und die folgende Inflation. Das konnte Merz parieren mit Verweis auf Länder, die ebenfalls unter den Folgen des Angriffskriegs leiden und trotzdem besser dastehen." Das war die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.
Nun zum Deutschlandticket, dessen Finanzierung in Frage gestellt wird. Der bayerische Verkehrsminister und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bernreiter, fordert den Bund auf, die staatlichen Zuschüsse künftig ganz zu übernehmen. Das STRAUBINGER TAGBLATT mahnt eine grundsätzliche Reform an, denn: "Die meisten Menschen auf dem Land haben davon nichts. Sie finanzieren mit ihren Steuern das 58-Euro-Ticket, können von einem ÖPNV-Angebot wie in den Ballungsräumen jedoch nur träumen. Viele haben keine Alternative zum Auto. Für eine Verbesserung der Infrastruktur fehlt oft das Geld. Auch wegen des Günstig-Fahrscheins. Schlimmer noch: Vielerorts muss das Angebot wegen knapper Kassen sogar ausgedünnt werden. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Die künftige Regierung wird mit den Ländern nicht nur über die Zukunft des Tickets reden müssen, sondern darüber, wie der ÖPNV insgesamt verbessert werden kann. Denn der Preis ist längst nicht alles", unterstreicht das STRAUBINGER TAGBLATT.
Die TAZ bezeichnet die Vorschläge aus Bayern als Querschüsse. "Der Freistaat will die erst nach zähen Verhandlungen zwischen Bundund Ländern vereinbarte Finanzierung nicht länger mittragen. Das hängtmit dem schlechten Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in TeilenBayerns zusammen, aber auch mit einer klaren Präferenz der Landesregierungfür den Autoverkehr. Die Ankündigung stellt einen verkehrspolitischenErfolg fahrlässig in Frage. Besser wäre es, den Nahverkehr so auszubauen,dass auch die Bayern mehr vom D-Ticket profitieren können", findet die TAZ.
Auf einem sogenannten Aktionsgipfel zur Künstlichen Intelligenz in Paris haben sich mehr als 60 Unternehmen zu einer Initiative zusammengeschlossen, um die Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz in Europa voranzubringen. Die STUTTGARTER NACHRICHTEN mahnen: "Die EU und ihre Mitglieder müssen versuchen, mit den USA und China Schritt zu halten, ohne die KI-Regulierung aus den Augen zu verlieren. Zudem muss die Politik verhindern, dass weiterhin nur eine kleine Elite von den Produktivitätsfortschritten durch KI profitiert, während andere um ihre Jobs bangen müssen. Um dafür praktikable Regelungen zu finden, braucht es eine Menge natürliche Intelligenz."
Die Zeitungen der MEDIENGRUPPE BAYERN attestieren Deutschland und seinen europäischen Nachbarn eine latente Innovationsskepsis. "Während die USA entwickeln und investieren, China klaut und kopiert – hat sich Europa erst einmal ein Gesetz gegeben. Der AI Act gilt auch in Deutschland seit 1. Februar. Er beinhaltet Gutes, etwa, dass Mitarbeiter, die mit KI-Technik arbeiten, fortgebildet werden müssen. Doch Europa droht erneut den Anschluss zu verlieren. Mit 450 Millionen Bürgern ist die EU größer als USA und Kanada zusammen. Doch die allermeisten KI-Erfindungen kommen aus Übersee. Wenn die Deindustrialisierung Deutschlands voranschreitet, wer zahlt all die sozialen Wohltaten, wer das immer größere Heer der Rentner? Bislang wurde das durch stetig steigendes Wirtschaftswachstum und höhere Produktivität gestemmt", heißt es in den Zeitungen der MEDIENGRUPPE BAYERN.