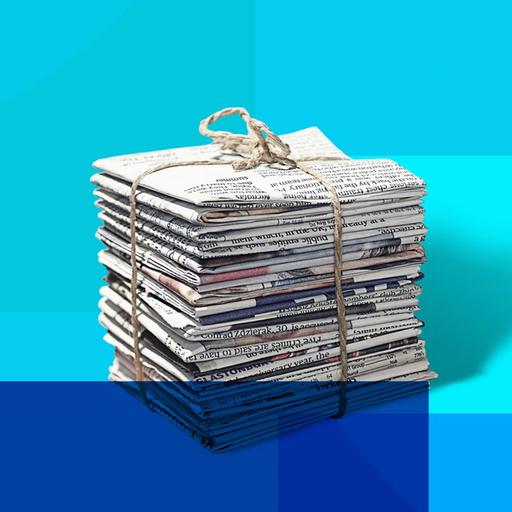"Politiker und Parteien sind hart miteinander ins Gericht gegangen. Der Ton war rau, nicht immer fair und respektvoll. Aber auch das macht Demokratie aus. Streiten um Positionen und Ziele, unterschiedliche Rechtsauffassungen und Überzeugungen. Selten haben so viele Menschen über Politik diskutiert, darüber, was sie darf, wie weit Befugnisse gehen sollen, was sie durchsetzen muss. Nach Resignation und Politikverdrossenheit ist durch das vorzeitige Ampel-Aus wieder etwas in Bewegung geraten", beobachtet DIE GLOCKE.
Nach Ansicht der MEDIENGRUPPE BAYERN war es etwas zu viel des Guten: "Hochemotionale Plenumsdebatten, Massendemos mit Hunderttausenden auf der Straße, gefolgt von einer bisher nicht gekannten Armada aus TV-Duellen, Quadrellen und Wahlarenen. Mehr davon hätt’s wahrlich nicht gebraucht – zumal US-Präsident Trump parallel eine Schockwelle nach der anderen aussendet."
Die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg überlegt: "Vielleicht hätte ein sogenannter Schlafwagen-Wahlkampf funktioniert, hätten die Anschläge von Magdeburg, Aschaffenburg und zuletzt München nicht das Streitthema Migration nach oben ins Bewusstsein katapultiert. All das, was zunächst eher zögerlich adressiert worden war, ergoss sich nun wie Ketchup aus der Flasche in die öffentliche Debatte."
Der WESER-KURIER aus Bremen moniert: "Die Frage, wie künftig soziale Gerechtigkeit gewährleistet bleiben kann, hätte mehr Menschen interessiert als Migration. Aber auch darüber ist in den vergangenen Wochen kaum gesprochen worden. Ebenso wenig wie über die Zukunft der Sozialsysteme, die Sanierung der Infrastruktur, die Digitalisierung des Land, über den Klimaschutz und, und, und."
Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG meint, die künftige Bundesregierung sollte sich folgende Aufgaben vornehmen: "Da ist zum einen die Wirtschaft. Das Land der Ingenieure braucht neue Ideen und Technologien, ein auf die digitale Zukunft ausgerichtetes Geschäftsmodell. Gelingen schnelle Fortschritte, könnte sich die Stimmung im Land bald aufhellen. Einen Kipppunkt könnte die Migrationspolitik bedeuten. Hier dürfen die Wähler nicht länger das Gefühl haben, dass nur gehandelt wird, wenn es zu Verbrechen von abgewiesenen Asylbewerbern kommt. Zudem hat US-Präsident Donald Trump in dieser Woche de facto das transatlantische Bündnis gebrochen. Auch deshalb kommt es nun auf den Riesen in Europas Mitte an wie nie", vermerkt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.
In der VOLKSSTIMME aus Magdeburg heißt es: "Die Bedrohung kommt jetzt genauso aus dem Westen wie durch Russland aus dem Osten. Es braucht eine Regierung des Zusammenhalts, die viele demokratische Richtungen förmlich zusammenschweißt."
Die FRANKFURTER RUNDSCHAU verweist auf ein weiteres Thema der künftigen deutschen Regierung: "Der russische Überfall auf die Ukraine 2022 hat die Politik in Deutschland auf den Kopf gestellt. Drei Jahre später zeichnet sich ab, dass das mögliche Ende des Krieges in der Ukraine der Anfang einer noch schlimmeren Epoche werden könnte, wenn Donald Trump Russland in Europa freie Hand gibt. Will Europa nicht zum Spielball der Interessen der USA, Russlands und auch Chinas werden, muss es schnell Gegenmaßnahmen ergreifen. Das ist die Toppriorität für alle ihre Regierungen, auch für den neuen deutschen Kanzler", konstatiert die FRANKFURTER RUNDSCHAU.
Die FREIE PRESSE aus Chemnitz ergänzt: "Für einen europäischen Neustart braucht es eine funktionierende deutsch-französische und auch deutsch-polnische Achse. Es geht um die Pflege persönlicher Beziehungen. Aber auch um die Bereitschaft, als größtes Land in Europa nicht nur auf den eigenen Vorteil zu schauen. In der Migrationspolitik wiederum geht es um das Kunststück, weitere Erfolge im Kampf gegen irreguläre Migration zu erzielen – ohne europäisches Recht zu brechen."
Die SÜDWEST-PRESSE aus Ulm befasst sich mit den vielen unentschlossenen Wählern: "Zwischen 25 und 30 Prozent der Wahlberechtigten sind sich noch nicht sicher, wo sie ihr Kreuz machen sollen. Ein Ausdruck dafür, dass sich die deutsche Gesellschaft politisiert hat wie selten zuvor. Das Wort Zeitenwende ist überstrapaziert, aber wir leben in einer solchen, und sie braucht eine stabile Demokratie. Deshalb sollte jeder, auch wenn er noch unschlüssig ist, wählen gehen. Und darauf vertrauen, dass die demokratischen Parteien beweisen, dass sie die anstehenden Probleme lösen wollen und können. Denn falls nicht, werden die Unzufriedenen und Ungeduldigen in vier Jahren eine deutliche Mehrheit haben", warnt die SÜDWEST-PRESSE.
Der REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER vermutet auch die nachlassende Bindung zu den Parteien hinter der Unentschlossenheit vieler Wähler: "Immer mehr Menschen machen ihr Kreuz mal bei dieser Partei, mal bei einer anderen. Je nach politischer Lage und Präferenz. Zudem ändern sich die bestimmenden Themen. Vor drei Jahren war es der Klimaschutz, nun sind es Wirtschaft und Sicherheit, die an oberster Stelle stehen."
Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG macht auf den Wert des Wahlrechts aufmerksam: "Die Wahl ist ein Recht - und keine Pflicht. Deshalb wird eigentlich auch niemand zur Wahl aufgerufen; vielmehr werden die Bürger benachrichtigt. Das ist Ausdruck von Freiheit. Freiheit ist elementar für die Demokratie. Die Bürger haben die Wahl und bestimmen gleichberechtigt die öffentliche Gewalt. Gerade in Zeiten, in denen in der alten Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika, in die einst Europäer vor Königen flüchteten, sich der Präsident dem Despotismus zuwendet, ist diese Wahl des Deutschen Bundestages eine besondere. Jede Stimme zählt", betont die F.A.Z..
Zum zweiten Thema. US-Vizepräsident Vance hat erneut die Redefreiheit in Deutschland in Frage gestellt und dies mit der Rolle der Vereinigten Staaten in der Sicherheitspolitik in Zusammenhang gebracht. Das STRAUBINGER TAGBLATT schreibt dazu: "Muss man sich ernsthaft Sorgen um die Demokratie in Deutschland machen? Nun, J. D. Vance tut es jedenfalls. Der amerikanische Vize-Präsident beklagt kurz vor der Bundestagswahl eine angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit hierzulande und kritisiert politische Brandmauern als undemokratisch. Ja, das ist in der Tat eine Gefahr - wenn Populisten wie Vance permanent Zweifel an demokratischen Spielregeln und Institutionen säen und dabei nur von Eigennutz getrieben sind."
Auch der Berliner TAGESSPIEGEL hält Vance‘ Einschätzung für übertrieben, fragt sich aber: "Könnte es sein, dass auch die deutsche Justiz übertreibt? Derzeit laufen Tausende Strafverfahren, weil Menschen mit Internetanschluss Politiker beleidigen. In vielen Fällen dürfte es sich um etwas handeln, das als Pöbelei beschrieben werden kann. Der rhetorisch effektvolle, letztlich aber sinnleere Slogan 'Hass ist keine Meinung' ist in ein politisches Programm gemündet, das Äußerungen solcher Art ersticken soll. Niemand soll mehr öffentlich gehasst werden dürfen. Man muss kein Amerikaner sein, um dabei ein Störgefühl zu haben", befindet der TAGESSPIEGEL.
Die RHEIN-ZEITUNG aus Koblenz überlegt zu möglichen Motiven der US-Spitzenpolitiker: "Trump und Vance profitieren von einer Welle, die aggressiv staatsverachtende oder rückgratlos um ihre Geschäfte fürchtende Tech-Milliardäre seit Jahren lostreten. Meinungsfreiheit? Ja klar, aber gefälligst nur, wenn es die unsere ist. Die Botschaft des US-Vizepräsidenten an die Europäer war also 'Hände weg von X, Google und Meta'. Das schockiert, aber man kann und muss damit umgehen. Ja, auch der deutsche Politikbetrieb, unsere Wirtschaft oder wir Medien sind nicht frei von Fehlern. In der Summe seiner Teile aber ist dieses Deutschland so frei und so lebenswert wie kaum ein anderer Staat der Welt", stellt die RHEIN-ZEITUNG fest, und damit endet die Presseschau.