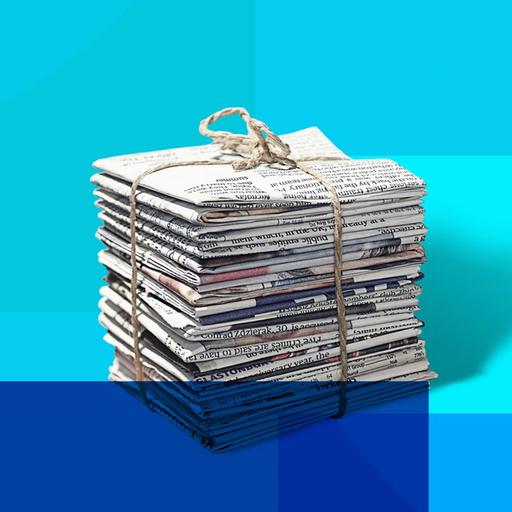"Chapeau für Frankreichs Justiz", lobt der TAGESSPIEGEL aus Berlin. "Die Beweise gegen die Fraktionschefin der französischen Rechtsextremen waren erdrückend. Mit großer krimineller Energie habe sie mehr als zwölf Jahre lang ein Betrugssystem aufgebaut und optimiert, um EU-Gelder zu veruntreuen. Schluss war erst, als Brüssel Ermittlungen einleiten ließ. Dafür ist Le Pen, die Oppositionsführerin und Vorsitzende der größten Fraktion im französischen Parlament, nun zu Recht hart verurteilt worden", findet der TAGESSPIEGEL.
"Das Urteil ist ein Schock – vor allem für die Rechte", analysiert das Nachrichtenportal T-ONLINE. "Umfragen zufolge ist Le Pen die beliebteste Politikerin Frankreichs. Ohne je regiert zu haben, prägt sie das politische System und entscheidet schon jetzt im Parlament darüber, wie lange der Premierminister und seine Minderheitsregierung überleben dürfen. Aber darf ein Gericht so weit gehen und einer Politikerin Berufsverbot erteilen? Darf es in die nächsten Wahlen eingreifen? Über diese Frage wird nun eine heftige Diskussion ausbrechen, aus der sich schließen lässt, wie tief Frankreich heute gespalten ist."
"Für alle, die sich ein pro-europäisches, offenes und starkes Frankreich wünschen, ist die Ausgrenzung von Le Pen nur teilweise eine gute Nachricht", befürchtet der KÖLNER STADT-ANZEIGER. "Tatsächlich könnte sich das Urteil zum Rückenwind für ihre Partei entwickeln. In den Augen ihrer Anhänger wird die Rechtspopulistin zu einer Märtyrerin, geopfert auf dem Altar einer angeblich politisch gelenkten Justiz. Zugleich bleibt die Ideologie der rechtsextremen Partei populär. Nichtsdestotrotz ist jede Kritik am Urteil des Gerichts unangebracht, weil es auf Fakten beruht. Le Pen hat bewusst ein System der Veruntreuung von EU-Geldern von ihrem Vater übernommen und weitergeführt, ließ ihre hoch verschuldete Partei, aber auch Teile ihrer Familie und ihres Umfelds davon profitieren und zeigte zu keinem Zeitpunkt Reue. Für die erwiesenen Vergehen sieht das französische Gesetz eben jene Strafe der Unwählbarkeit vor, die sie nun erhalten hat. Ihr Schuldspruch ist völlig legitim", meint der KÖLNER STADT-ANZEIGER.
"Dass Le Pen nun nicht kandidieren kann, ist kein Anlass für Mitleid", schreibt die TAGESZEITUNG – TAZ – aus Berlin. "Wie schon in den Prozessen gegen Ex-Präsident Sarkozy hat die französische Justiz klargemacht, dass die Politiker nicht über dem Gesetz stehen. Sie werden im Gegenteil besonders streng bestraft, wenn sie selbst nicht beispielhaft sind. Es ist im internationalen Kontext auch ein Urteil gegen die schleichende 'Trumpisierung': Die Richter entscheiden nach dem Gesetz und den Fakten, und die verurteilten Delinquenten sind keine Opfer, weil ihre politischen Ambitionen durchkreuzt werden." Soweit die TAZ. Und so viel zu diesem Thema.
In Berlin haben Spitzenvertreter von Union und SPD die Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Nach Ansicht der NÜRNBERGER NACHRICHTEN macht der bisherige Ablauf der Gespräche nicht allzu viel Hoffnung: "Außer der 'Billion plus' für Infrastruktur und Verteidigung hat sich wenig getan. Die öffentlich gewordenen Abschlusspapiere der Arbeitsgruppen sind im Wesentlichen nur eine Auflistung dessen, was beide Lager nicht wollen. Die 19 Top-Unterhändler, die jetzt noch aktiv sind, müssen endlich anfangen, die unvermeidlichen bitteren Kompromisse zu schließen. Momentan gebärden sich viele, als ob sie eine Alleinregierung bilden könnten. Sie sehen noch keine unbedingte Pflicht, sich zu einigen", heißt es in den NÜRNBERGER NACHRICHTEN.
Die RHEINISCHE POST aus Düsseldorf geht auf die Verteilung der Ressorts und das Personal ein: "Wer was wird, ist schließlich auch entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg einer schwarz-roten Koalition und der sie tragenden Parteien. Ein Bündnis, von dem jetzt schon behauptet wird, dass es womöglich die letzte Chance hat, einen Durchmarsch der AfD zu verhindern. Weil sich die mögliche Koalition aus Union und SPD den Politikwechsel auf die Fahnen geschrieben hat, den das Land in vielen Bereichen dringend benötigt, müssen daher auch die neuen Minister für Aufbruch und Erneuerung stehen. Schließlich soll dies die DNA der Koalition sein. Die Besetzung des Kabinetts wird somit aber noch einmal schwieriger als in früheren Merkel-Zeiten, in denen es personell oft eher um ein Weiter-so ging", prognostiziert die RHEINISCHE POST.
Ein verpflichtender Gesellschaftsdienst und eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht sind derzeit Gegenstand der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, sagte im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass sie eine neue Form des Wehrdienstes für möglich halte. Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg zeigt sich skeptisch: "Die Idee eines 'Freiheitsdienstes' von den Grünen hält Högl für richtig gut. Da müsste jeder für ein halbes Jahr ran, um etwas Nützliches für die Gesellschaft zu leisten – bei der Feuerwehr oder dem Roten Kreuz vielleicht. Und wer möchte, darf auch zum Dienst bei der Bundeswehr einrücken. Eventuell aber erstmal zum Schnupperkurs, ob auch alles recht ist beim Militär? Beim Alter haben die jugendaffinen Grünen spezielle Vorstellungen: Die Spanne soll von 18 bis 67 Jahren reichen. So müssten alle Arbeitsveteranen noch kurz vor Renteneintritt ihren Pflichtdienst ableisten. Das erinnert fatal an den Volkssturm, der vor 80 Jahren in Deutschland sinnloserweise zusammengetrommelt worden war", moniert die VOLKSSTIMME.
Die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG aus Heidelberg unterstreicht: "Das Projekt 'Gesellschaftsjahr' für alle wäre nicht nur ein Mittel zur Rekrutierung von Soldaten oder eine Möglichkeit, Kliniken mit billiger Arbeitskraft zu versorgen. Vielmehr könnte es das gesellschaftliche Fundament stärken. Ein Pflichtjahr zwingt dazu, seine Komfortzonen zu verlassen, eröffnet aber zugleich neue Lebens- und Arbeitswelten und fördert die persönliche Reifung. Es mag jungen Menschen zunächst ungerecht erscheinen, doch im Laufe eines Arbeitslebens wiegt ein scheinbar 'verlorenes' Jahr mit 19 oder 20 letztlich kaum", vermutet die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG.
Die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG kritisiert, dass bei der Rekrutierung für die Bundeswehr nur Männer berücksichtigt werden sollen. Für die Rekrutierung von Frauen müsse laut Högl das Grundgesetz geändert werden: "Wie bitte? Wenn die internationale Lage doch solche Eile erfordert, warum hat man den alten Bundestag dann zwar noch über die Schuldenfrage abstimmen lassen, nicht aber mehr über die Rekrutierung von Frauen? Letzteres Thema hätte die Ampel übrigens schon die ganze letzte Legislaturperiode in Angriff nehmen können, zumal sich die sogenannte 'Fortschrittskoalition ' ja eigentlich gerade auch um Fortschritte bei der Gleichbehandlung der Geschlechter kümmern wollte", bemängelt die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG.
"Während die Unionsparteien die seit 2011 ausgesetzte Wehrpflicht reaktivieren wollen, fordert die SPD, dass der neue Wehrdienst freiwillig bleibt", resümiert die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG. "Der Bundeswehr, die trotz der 100 Milliarden in vielen Bereichen nach wie vor nicht 'kriegstüchtig' ist, fehlen nicht nur Waffen und Munition, sondern auch Soldaten. Würden viele junge Menschen eingezogen, dann vergrößerte das die Arbeitskräfteknappheit, über die die Wirtschaft schon jetzt klagt. Auch die Annahme, dass eine kriegerische Auseinandersetzung mit Russland nicht von langer Dauer sein werde, muss mit Blick auf den Ukrainekrieg hinterfragt werden. Die Reaktivierung der Wehrpflicht würde den Deutschen zeigen, dass es wirklich ernst ist. Putin sähe, dass er es mit einem wehrhaften Volk zu tun bekäme, das bereit wäre, für seine Freiheit zu kämpfen", konstatiert die F.A.Z. Und damit endet diese Presseschau.