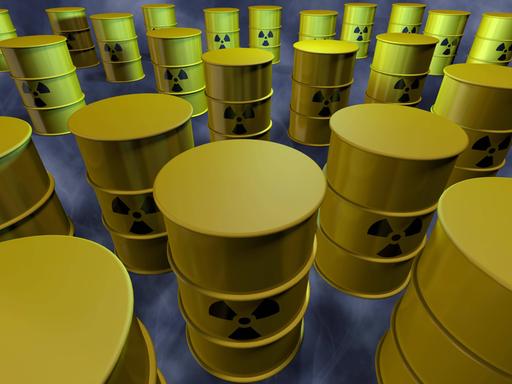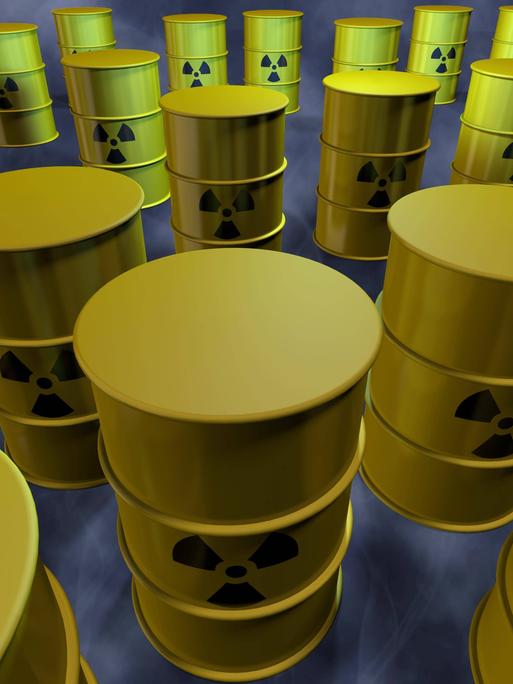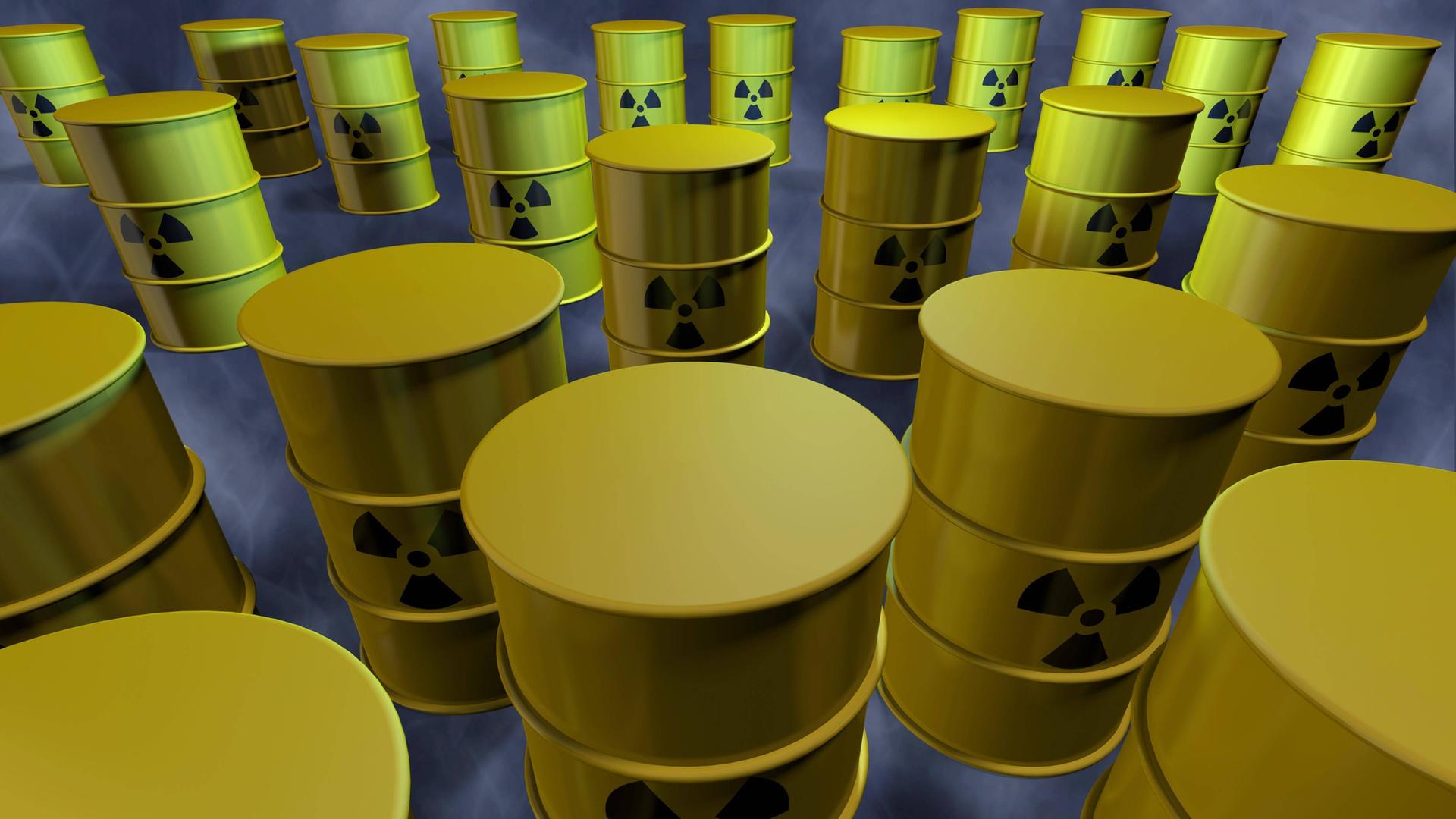Deutschlands Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll wird sich weiter verzögern. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten im Auftrag des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). Demnach wird ein Standort frühestens 2074 benannt werden können. Das Verfahren verzögert sich damit um mehrere Jahrzehnte. Rund um das Verfahren gibt es zudem Ungereimtheiten.
Als Reaktion auf die Deutschlandfunk-Recherche und die Veröffentlichung des Gutachtens will sich das Bundesumweltministerium (BMUV) nun für eine Beschleunigung des Verfahrens einsetzen. Das ist auch ein Signal an die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), die das Verfahren praktisch durchführt. Auf ein neues Zieldatum und eine entsprechende gesetzliche Änderung will sich das BMUV aber nicht einlassen.
Inhaltsverzeichnis
- Wie ist der Stand der Endlagersuche?
- Wieso verzögert sich die Suche nach einem Atommüll-Endlager?
- Wieso werden die Inhalte des Gutachtens erst jetzt bekannt?
- Wie sind die Reaktionen auf die Deutschlandfunk-Recherche?
- Wie geht es jetzt weiter bei der Endlagersuche?
- Welche weiteren Probleme ergeben sich durch die Verzögerung?
Wie ist der Stand der Endlagersuche?
2013 wurde die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle auf komplett neue gesetzliche Füße gestellt. Vorher war geplant, den Atommüll im Salzstock Gorleben unterzubringen, doch seit jeher hatte es Zweifel gegeben, ob Gorleben überhaupt geeignet ist. Die Entscheidung für diesen Standort war immer eine politische, keine wissenschaftliche.
Nach eklatanten Problemen im nicht weit entfernten Salzstock Asse II, in dem schwach- bis mittelradioaktive Stoffe untergebracht sind, entschied die Politik: Es braucht einen Neustart des Verfahrens und ein wissenschaftsbasiertes Verfahren mit Bürgerbeteiligung. Nachdem eine Kommission Empfehlungen für ein solches Verfahren zusammengestellt hatte, wurde 2017 das Standortauswahlgesetz in seiner bis heute gültigen Form vom Bundestag verabschiedet.
Es beauftragt die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit der konkreten Ausführung des Prozesses. Aufsichtsbehörde für den Prozess ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), das außerdem die Öffentlichkeitsbeteiligung organisiert. Im sogenannten Nationalen Begleitgremium (NBG) haben Bürgerinnen und Bürger ein Auge auf den Prozess.
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat nachgelassen
2021 hatte die BGE eine Karte mit sogenannten Teilgebieten veröffentlicht – ab diesem Zeitpunkt war offiziell, dass Gorleben als möglicher Standort ausscheidet. Weil die Endlagerfrage seitdem nicht mehr mit einem konkreten realen Ort verknüpft ist, hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit spürbar nachgelassen.
2022 musste die BGE zugeben: Das Verfahren wird insgesamt viel länger dauern als im Gesetz vorgesehen, nämlich bis 2031. Im besten Fall geht die BGE davon aus, bis 2046 einen Standort benennen zu können, im schlimmsten Fall erst 2068.
Wieso verzögert sich die Suche nach einem Atommüll-Endlager?
Das Öko-Institut hat für das BASE diesen Zeitplan überprüft und kommt grundsätzlich zu dem Schluss, dass er plausibel ist. Aber: Die BGE habe Verfahrensschritte, die nicht in ihrem eigenen Aufgabenbereich liegen, ausgeklammert. Daher kommen die Autorinnen zu dem Schluss, dass es noch deutlich länger dauern wird, nämlich bis 2074 – und das auch nur, wenn alles gut läuft. „Im realen Verfahren ist ein weniger idealer Verlauf zu erwarten."
Das Gutachten war vom BASE in seiner Rolle als Aufsichtsbehörde der BGE in Auftrag gegeben und vom Öko-Institut durchgeführt worden. Das Gutachten liegt seit Februar vor.
Wieso werden die Inhalte des Gutachtens erst jetzt bekannt?
Hier zeigen sich tatsächlich einige Ungereimtheiten. Das Gutachten wurde am 29. Februar 2024 fertiggestellt und dem BASE übergeben. Das Projekt wird jedoch Stand Ende Juli auf der Webseite der Behörde noch immer als "laufend" gelistet. Auch wurde es nicht offiziell an das Umweltministerium weitergeleitet. Erst zwei Tage nach der Anfrage des Deutschlandfunks zur Existenz des Gutachtens wurde es nach Angaben des BASE am 25. Juli offiziell an das BMUV übergeben. Das Gutachten trägt ein Vorwort des BASE, das auf Juli 2024 datiert ist und die Jahreszahl 2074, eine zentrale Erkenntnis des Gutachtens, nicht aufgreift. Schriftlich ließ das Bundesamt wissen, dass eine Veröffentlichung für den Herbst geplant sei. Als Folge der Recherchen des Deutschlandfunks veröffentlichte das BASE den Bericht jedoch bereits am 6. August.
Weitere Ungereimtheiten rund um das Gutachten
Dies ist jedoch nicht die einzige Ungereimtheit. Anfang Juli antwortete das Bundesumweltministerium auf eine Frage des CDU-Abgeordneten Klaus Wiener im Rahmen der Fragestunde im Deutschen Bundestag. Dieser hatte sich nach dem Stand des Forschungsvorhabens erkundigt. Der parlamentarische Staatssekretär das BMUV, Jan-Niclas Gesenhues (Bündnis 90/Die Grünen), antwortete darauf schriftlich: „Ein Abschluss wird voraussichtlich nicht vor 2025 erfolgen.“
Zu diesem Zeitpunkt lag der Abschlussbericht des Projektes dem BASE seit Ende Februar vor. Neuer Präsident des BASE ist seit Februar der Vorgänger von Gesenhues im Amt des Staatssekretärs: der Grünen-Politiker Christian Kühn. Das BASE kann sich auf Anfrage nicht erklären, wie die Zahl 2025 in Gesenhues' Antwort zustande gekommen ist. All das ist auch deshalb pikant, weil der Forschungsbericht Aufsichtsdefizite benennt. Die Autorinnen stellen fest, dass dem BASE eine "formale Unabhängigkeit [...] gegenüber dem BMUV" fehle.
Wie sind die Reaktionen auf die Deutschlandfunk-Recherche?
Das Bundesumweltministerium hat sich dafür ausgesprochen, die Endlagersuche für hochradioaktive Stoffe zu beschleunigen - ein Signal an die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), die das Verfahren praktisch durchführen muss. Auf einen neuen Zeitpunkt oder eine Änderung des Standortauswahlgesetzes will sich das Ministerium aber nicht einlassen.
Der ARD sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke, das jüngst publizierte Gutachten des Öko-Instituts bilde die jüngsten Fortschritte nicht ab. "Diese Studie hat nicht alle aktuellen Informationen und Fakten einbeziehen können, weil wir in den letzten Monaten eine Entwicklung hatten, die dynamisch ist."
Der frühere Chef des BASE, Wolfram König, sowie Endlager-Experte Klaus-Jürgen Röhlig, schlagen vor, die Auswahl auf weniger und kleinere Standortregionen zu begrenzen. Damit ließe sich das Verfahren beschleunigen, eine Forderung, die auch die Autorinnen der Studie vorschlagen. König sagte im Deutschlandfunk, aktuell würden 54 Prozent des Bundesgebiets als prinzipiell geeignete Fläche betrachtet. Diesen Wert müsse man schnell reduzieren und die verbleibenden Flächen dann näher begutachten.
Die Menschen in Regionen, die derzeit als Zwischenlager dienen, sind wenig erfreut über die Verzögerung. Bürgermeister Joachim Winkler aus Neckarwestheim in Baden-Württemberg sagte gegenüber der ARD, dass viele nun nicht mehr erleben würden, dass der Atommüll aus ihrer Region weggeht.
Agnor Sittich, Mitglied des nationalen Begleitgremiums, bemängelt, dass der Zeitplan für die Endlagersuche dem Bürgergremium nun schon zum zweiten Mal aus der Presse bekannt wird. Dieser Prozess sollte aber transparent ablaufen, das ist auch gesetzlich so vorgesehen. Auch Sittich spricht sich dafür aus, die Endlagersuche zu beschleunigen. Es müsse aber "ein Kompromiss zwischen Schnelligkeit und einer guten Qualität" gefunden werden. Das ist gerade der erkennbare Wunsch vieler.
Wie geht es jetzt weiter bei der Endlagersuche?
Auf der politischen Ebene stellt sich zum einen die Frage, warum das Gutachten über Monate hinweg nicht veröffentlicht wurde. Das Standortauswahlgesetz sieht eigentlich ein transparentes Verfahren vor. Das Vertrauen der Menschen in den Prozess sei wichtig, betonen mehrere Quellen gegenüber dem Deutschlandfunk. Die Reaktionen auf die Deutschlandfunk-Recherche zeigen, dass die Menschen ernüchtert sind, dass sie ihre Region nie atommüllfrei erleben werden und mit dem Risiko leben müssen, die eine oberirdische Lagerung mit sich bringt.
De facto wird es mindestens noch 50 Jahre dauern, bis ein Standort für ein Endlager feststehen kann. Die BGE will bis 2027 bis zu zehn Standortregionen bekannt geben, die für ein Endlager infrage kommen und weiter untersucht werden. Möglicherweise wird die Zahl der Standorte aber noch weiter eingegrenzt. In diesen Regionen sollen dann auch die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden. Für sie wird das Verfahren, wenn es so durchgeführt wird, jahrelange Ungewissheit mit sich bringen.
Experten befüchten, das Verfahren könnte scheitern
Bereits 2023 hatte das BASE eine umfassende Evaluierung des Verfahrens gefordert. Zu der Frage, wie der Prozess beschleunigt werden kann, schlagen die Autorinnen des Forschungsberichts vor - so wie es nun von einigen auch gefordert wird - die Zahl der Standortregionen einzugrenzen, um den Aufwand der weiteren Erkundung klein zu halten. Diese Position greifen einige nun auf. Sollte 2074 ein Endlagerstandort als Ergebnis der Suche benannt werden können, müsste dieser vom Deutschen Bundestag bestätigt werden. Erst dann können Planung, Genehmigung und Bau beginnen. Bis schlussendlich hochradioaktiver Müll eingelagert werden kann, könnte das nächste Jahrhundert angebrochen sein. Mehrere mit dem Verfahren vertraute Quellen äußerten gegenüber dem Deutschlandfunk die Sorge, dass das Verfahren scheitern könne, wenn es wie derzeit fortgesetzt würde.
Welche weiteren Probleme ergeben sich durch die Verzögerung?
Der hochradioaktive Müll lagert derzeit in über 1000 Castor-Behältern in Zwischenlagern über ganz Deutschland verteilt. Für die Zwischenlager in Ahaus und Gorleben laufen die Genehmigungen bereits 2034 aus, für viele andere Lager in den 2040ern. Die Behälter sind zudem eigentlich nicht für eine so lange Nutzung in Zwischenlagern konzipiert.
Finanzierung könnte knapp werden
Außerdem bedroht die Dauer des Verfahrens die Finanzierungsgrundlage. Die Endlagersuche wird über den Staatsfonds KENFO finanziert, in diesen hatten die Kraftwerksbetreiber Milliardensummen eingezahlt. Doch diese Summe ist ausgelegt auf einen Prozess bis 2031. Dauert es Jahrzehnte länger, einen Standort zu finden, könnten die Mittel knapp werden.
Das Verfahren setzt zudem auf eine starke öffentliche Beteiligung. In einem Begleitgremium organisieren sich Bürgerinnen und Bürger sowie von der Politik bestimmte Akteure. Viele der jetzt Teilnehmenden werden das Ende des Prozesses nicht mehr erleben.
Angesichts des langen Zeitraums wird es zudem schwierig, das öffentliche Interesse sowie die Akzeptanz aufrechtzuerhalten. Viele, die jetzt im Prozess aktiv sind, werden die Festlegung nicht erleben, wenn sie erst 2074 erfolgt.