
2017 trat ein Gesetz in Kraft, das die Verwaltung in Deutschland endlich ins digitale Zeitalter katapultieren sollte: das Online-Zugangsgesetz, kurz OZG. Ob Führerschein, Kirchenaustritt, Firmeninsolvenz oder Einfuhrgenehmigung - alles, was man bislang üblicherweise persönlich oder auf Papier beantragen muss, sollte innerhalb von fünf Jahren digital möglich sein. Am 31. Dezember dieses Jahres läuft die Frist zur Umsetzung ab. Die Bilanz: schlecht.
„Also, wir werden das Zeitziel, alles in der Fläche verfügbar zu haben, deutlich verfehlen, das muss man ganz klar sagen“, sagt Markus Richter. Er ist Staatssekretär im Bundesinnenministerium und der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik. Er hat auch einen Kurztitel: CIO – für Chief Information Officer. Jedenfalls soll er auf Seiten des Bundes die Digitalisierung der Behörden koordinieren:
„Das macht uns alle nicht glücklich, diese Vergangenheitsdiskussionen zu führen. Wir müssen jetzt dieses Ausrollen in der Fläche vornehmen. Und da bin ich sehr froh, dass die IT-Verantwortlichen der Länder das genauso sehen und dass wir da in einem gemeinsamen Boot sitzen und das auch so umsetzen.“
Wichtige Behördengänge bleiben unverändert analog
575 Verwaltungsleistungen sollten ursprünglich Ende des Jahres digital angeboten werden. 114 Leistungen konnten im Zuge der OZG-Offensive umgesetzt werden. Doch selbst diese Zahl täuscht: Denn umgesetzt bedeutet nur, dass mindestens eine deutsche Kommune einen Online-Antrag für diese Leistung anbietet. Und „Online-Antrag“ heißt in diesem Fall, dass es sich auch bloß um ein ausfüllbares PDF-Dokument handeln kann. Und ob Bürger und Firmen die nötigen Nachweisdokumente dann noch per Post schicken müssen und die weitere Kommunikation wieder auf Papier stattfindet, spielt auch keine Rolle.
Bei den meisten wichtigen Behördengängen bleibt also alles beim Alten. Das heißt: beim Analogen. Wer zum Beispiel online seinen Wohnsitz ummelden möchte, kann das derzeit nur in Hamburg tun. Und auch nur bei einem Umzug innerhalb des Stadtstaats.
Warum haben die fünf Jahre nicht gereicht? Einig sind sich die Beteiligten, dass das OZG, das Online-Zugangsgesetz zwar insgesamt einen Aufbruch markierte, aber bereits 2017 viel zu spät kam.
„Ich glaube, es wurde tatsächlich auf politischer Ebene zu lange, zu zögerlich bearbeitet“, sagt Moreen Heine, Professorin für E-Government an der Universität Lübeck. „Das ist natürlich jetzt auch kein so hochspannendes Thema auf politischer Ebene, was man gerne in aller Breite diskutiert und in den Fokus rückt. Und das hat man dann eigentlich erst gemacht, als der Druck so groß war, dass es wirklich für jeden auch spürbar ist, dass Verwaltungen da hinterher hängen.“
Warum haben die fünf Jahre nicht gereicht? Einig sind sich die Beteiligten, dass das OZG, das Online-Zugangsgesetz zwar insgesamt einen Aufbruch markierte, aber bereits 2017 viel zu spät kam.
„Ich glaube, es wurde tatsächlich auf politischer Ebene zu lange, zu zögerlich bearbeitet“, sagt Moreen Heine, Professorin für E-Government an der Universität Lübeck. „Das ist natürlich jetzt auch kein so hochspannendes Thema auf politischer Ebene, was man gerne in aller Breite diskutiert und in den Fokus rückt. Und das hat man dann eigentlich erst gemacht, als der Druck so groß war, dass es wirklich für jeden auch spürbar ist, dass Verwaltungen da hinterher hängen.“
Hindernis: Föderale Aufgabenverteilung
Es gibt viele Hindernisse einer gemeinsamen Verwaltungsdigitalisierung, allen voran die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Interessen von Bund, Ländern und Kommunen. Denn das Online-Zugangsgesetz musste in einem Dschungel föderaler Aufgabenverteilung und bereits existierender IT-Strukturen in Ländern und Kommunen umgesetzt werden.
„Fünf Jahre hat man genutzt, um in Deutschland herauszufinden, wie man dann über diese Ebenen Bund, Länder, Kommunen sinnvoll gemeinsam kooperiert“, bilanziert deshalb Ariane Berger vom Deutschen Landkreistag. „Da musste viel neu gebaut werden, viel neu gefunden werden. Wir sind in Deutschland nicht unbedingt geübt in Kooperation über diese Ebene hinweg. Wir haben in der Verwaltung üblicherweise andere Wege.“
„Fünf Jahre hat man genutzt, um in Deutschland herauszufinden, wie man dann über diese Ebenen Bund, Länder, Kommunen sinnvoll gemeinsam kooperiert“, bilanziert deshalb Ariane Berger vom Deutschen Landkreistag. „Da musste viel neu gebaut werden, viel neu gefunden werden. Wir sind in Deutschland nicht unbedingt geübt in Kooperation über diese Ebene hinweg. Wir haben in der Verwaltung üblicherweise andere Wege.“
Diese komplexe Ausgangslage ist auch ein Grund dafür, dass das Online-Zugangsgesetz von Beginn an nur den kleinsten gemeinsamen Nenner markierte.
Überschreiten der Umsetzungsfrist - keine Folgen für Behörden
Das zeigt sich auch zum Jahreswechsel: Denn dass Bund, Länder und Kommunen die gesetzliche Umsetzungsfrist reißen, hat keinerlei Folgen. Torsten Frenzel, IT-Berater im Kommunalen Bereich und Macher des „E-Government-Podcasts“, blickt zurück:
„Ganz am Anfang habe ich mit vielen Kommunen darüber gesprochen, wie sie denn jetzt mit dem OZG umgehen wollen. Und die haben gesagt: Naja, warum? Wir müssen nichts machen. Weil wenn wir bis Ende 2022 nix hinkriegen - weil Geld haben wir eh keins - dann passiert uns auch nichts. Also wir haben keinen Druck.“
Eine weitere Grundsatzentscheidung wirkt ebenfalls noch nach: Denn das Onlinezugangsgesetz ist gar nicht auf einen vollständig digitalisierten Prozess ausgelegt. Sondern es regelt, wie der Name schon sagt, nur den Zugang - also die Möglichkeit für Bürger und Firmen, digital Anträge zu stellen:
„Ein Designfehler ist auch, dass wir nicht bedacht haben, dass die Daten irgendwo ankommen müssen. Die Daten müssen ja irgendwo verarbeitet werden.“
Was passiert, wenn die Anträge für Kindergeld, Parkausweis oder Baugenehmigung digital gestellt sind und die Daten in der zuständigen Verwaltung gelandet sind: Damit hat das OZG nichts zu tun.
Was auch bedeuten kann, dass die Übertragungskette reißt, wie Stefan Domanske vom Niedersächsischen Landkreistag erzählt: „Ich hab ein tolles Online-Frontend. Und sobald dort ein Mensch Daten eingibt, habe ich die nicht sofort in meinem Fachverfahren. Und jede Fachlichkeit einer Kommunalverwaltung, von der KfZ-Zulassung bis hin zur Abfallbeseitigung, hat natürlich eine eigene Software, mit der sie das bearbeiten möchte. Und wenn die Daten dann nicht gleich reinkommen, dann habe ich ein Schnittstellenproblem. Und wenn es ganz blöd läuft, dann habe ich die nur als pdf-Datei. Und kann damit gar nicht weiterarbeiten.“
Was auch bedeuten kann, dass die Übertragungskette reißt, wie Stefan Domanske vom Niedersächsischen Landkreistag erzählt: „Ich hab ein tolles Online-Frontend. Und sobald dort ein Mensch Daten eingibt, habe ich die nicht sofort in meinem Fachverfahren. Und jede Fachlichkeit einer Kommunalverwaltung, von der KfZ-Zulassung bis hin zur Abfallbeseitigung, hat natürlich eine eigene Software, mit der sie das bearbeiten möchte. Und wenn die Daten dann nicht gleich reinkommen, dann habe ich ein Schnittstellenproblem. Und wenn es ganz blöd läuft, dann habe ich die nur als pdf-Datei. Und kann damit gar nicht weiterarbeiten.“
Studierendenwerke bearbeiten Bafög-Anträge auf Papier
In den Verwaltungen heißt es dann nicht selten: „copy and paste“. Oder sogar: Drucker an, wie das Beispiel der Studierenden zeigt, die inzwischen zwar ihren Antrag auf Bafög-Zahlung digital stellen können, sogar in allen Bundesländern im identischen System. Doch die Studierendenwerke drucken diese Anträge dann tatsächlich auf Papier aus, um sie zu bearbeiten.
Insgesamt habe es Deutschland verpasst, zuerst die Grundlagen zu klären, lautet deshalb die Kritik aus der Fachwelt. Elektronische Verwaltungsakten, miteinander kompatible Rechenzentren, und nicht zuletzt einheitliche Schnittstellen und Standards: Das alles wird zwar inzwischen teilweise angegangen.
Aber wäre eigentlich die Voraussetzung, damit aus einem digitalisierten Antrag überhaupt ein digitaler Prozess wird, so der IT-Berater Torsten Frenzel: „Wenn ich ein Haus baue, muss ich den Architekten beauftragen, der mir das Haus gestaltet und plant. Dann fange ich an mit einem Keller und dem Fundament. Wenn ich Keller und Fundament habe, kann ich die Wände hochziehen, das Dach draufsetzen. Und dann kann ich anfangen mit Tapezieren und einrichten. Was wir gerade machen bei der Digitalisierung und bei der ganzen OZG-Umsetzung: Wir fangen schon an zu tapezieren und uns die Möbel auszusuchen - und wir haben noch gar keine Wände.“
Um im Bild zu bleiben: Zuständig für Fundament und Wände wäre eigentlich der IT-Planungsrat: In diesem Steuerungsgremium legen die Digitalverantwortlichen von Bund und Ländern Leitlinien fest. Zum Beispiel, um zu vermeiden, dass mehrere Bundesländer Online-Anträge für die gleichen Leistungen entwickeln. Oder um Einheitlichkeit bei Standards und Schnittstellen zu vereinbaren, damit die Daten dann auch über Landkreis- und Ländergrenzen hinweg fließen können.
Insgesamt habe es Deutschland verpasst, zuerst die Grundlagen zu klären, lautet deshalb die Kritik aus der Fachwelt. Elektronische Verwaltungsakten, miteinander kompatible Rechenzentren, und nicht zuletzt einheitliche Schnittstellen und Standards: Das alles wird zwar inzwischen teilweise angegangen.
Aber wäre eigentlich die Voraussetzung, damit aus einem digitalisierten Antrag überhaupt ein digitaler Prozess wird, so der IT-Berater Torsten Frenzel: „Wenn ich ein Haus baue, muss ich den Architekten beauftragen, der mir das Haus gestaltet und plant. Dann fange ich an mit einem Keller und dem Fundament. Wenn ich Keller und Fundament habe, kann ich die Wände hochziehen, das Dach draufsetzen. Und dann kann ich anfangen mit Tapezieren und einrichten. Was wir gerade machen bei der Digitalisierung und bei der ganzen OZG-Umsetzung: Wir fangen schon an zu tapezieren und uns die Möbel auszusuchen - und wir haben noch gar keine Wände.“
Um im Bild zu bleiben: Zuständig für Fundament und Wände wäre eigentlich der IT-Planungsrat: In diesem Steuerungsgremium legen die Digitalverantwortlichen von Bund und Ländern Leitlinien fest. Zum Beispiel, um zu vermeiden, dass mehrere Bundesländer Online-Anträge für die gleichen Leistungen entwickeln. Oder um Einheitlichkeit bei Standards und Schnittstellen zu vereinbaren, damit die Daten dann auch über Landkreis- und Ländergrenzen hinweg fließen können.
Länder verteidigen jeweils eigene Online-Lösungen
In der Praxis ist der Prozess hochpolitisch: Länder verteidigen oft ihre eigenen Online-Lösungen, weil die bereits gut funktionieren. Oder weil sie schon Geld dafür ausgegeben haben und die Prozesse nicht einstampfen wollen. Auch die Wünsche und Interessen der regionalen öffentlichen IT-Dienstleister spielen eine Rolle. Ähnliches gilt für die Kommunen, die zudem oft aus einer knappen Kassenlage heraus agieren.

Ein Durchgriffsrecht gibt es in dieser föderalen Gemengelage nicht, die Umsetzung liegt schließlich bei Ländern und Kommunen. Kritik an fehlender Durchsetzungskraft im IT-Planungsrat weist Bundes-CIO Markus Richter deshalb zurück:
„Das Entscheidende ist am Ende des Tages, dass wir überzeugen, dass der Weg, den wir einschlagen, der richtige ist. Denn wenn wir davon immer wieder Gebrauch machen, dass wir gegen die Positionen von einzelnen Bundesländern agieren, dann werden uns solche Beschlüsse auch nicht helfen.“
Die Folgen dieser Unverbindlichkeit zeigen sich an vielen Stellen. Zum Beispiel bei den Servicekonten: Das sind Nutzerkonten, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger bei den Behörden online anmelden können. Irgendwann sollen sie über diese Konten ihren ganzen Verwaltungsverkehr abwickeln können.
Die Bundesregierung bietet ein Nutzerkonto namens „BundID“ an. Aber viele Länder haben ebenfalls Servicekonten entwickelt. Die tragen Namen wie „BayernID“ oder „Servicekonto.NRW“. 2018 drängte die Bundesregierung bei den Ländern darauf, dass künftig alle Bürgerinnen und Bürger die BundID nutzen. Vergeblich.
Stattdessen entschied der IT-Planungsrat, die verschiedenen Bundes- und Länderkonten technisch aufeinander abzustimmen. Eine komplizierte Lösung, die nicht nur Geld kostet, sondern auch dazu führt, dass selbst kleinste technische Änderungen mit einem hohen Koordinationsaufwand verbunden sind.
Entschieden war die Sache damit aber nicht. Anfang 2022 kündigte eine Gruppe von Bundesländern an, nun doch auf BundID zurückzugreifen, unter anderem Sachsen-Anhalt. Kirsten Wilke, Innendezernentin im dortigen Burgenlandkreis, beschreibt, was das für ihre Verwaltung in der Praxis bedeutete:
Die Bundesregierung bietet ein Nutzerkonto namens „BundID“ an. Aber viele Länder haben ebenfalls Servicekonten entwickelt. Die tragen Namen wie „BayernID“ oder „Servicekonto.NRW“. 2018 drängte die Bundesregierung bei den Ländern darauf, dass künftig alle Bürgerinnen und Bürger die BundID nutzen. Vergeblich.
Stattdessen entschied der IT-Planungsrat, die verschiedenen Bundes- und Länderkonten technisch aufeinander abzustimmen. Eine komplizierte Lösung, die nicht nur Geld kostet, sondern auch dazu führt, dass selbst kleinste technische Änderungen mit einem hohen Koordinationsaufwand verbunden sind.
Entschieden war die Sache damit aber nicht. Anfang 2022 kündigte eine Gruppe von Bundesländern an, nun doch auf BundID zurückzugreifen, unter anderem Sachsen-Anhalt. Kirsten Wilke, Innendezernentin im dortigen Burgenlandkreis, beschreibt, was das für ihre Verwaltung in der Praxis bedeutete:
„Beim Servicekonto haben wir das Problem gehabt, dass wir das Landesservicekonto tatsächlich angebunden hatten, das sachsen-anhaltinische. Und dann wurde uns ein halbes Jahr danach mitgeteilt, dass das Landesservicekonto nicht weiter gepflegt wird und dass man doch lieber das Bundesservicekonto nutzt. Das heißt also, wir haben da tatsächlich auch Geld umsonst ausgegeben. Was natürlich bei den klammen kommunalen Haushalten auch schmerzlich ist.“
Für Kirsten Wilke bedeutet die Kehrtwende ihres Bundeslandes also zusätzliche Arbeit. Bundes-CIO Markus Richter hingegen sieht darin eine Bewegung in die richtige Richtung:
Für Kirsten Wilke bedeutet die Kehrtwende ihres Bundeslandes also zusätzliche Arbeit. Bundes-CIO Markus Richter hingegen sieht darin eine Bewegung in die richtige Richtung:
„Das ist etwas, was sich gerade in den letzten zwei Jahren auch entwickelt hat, nachdem der Bund Konjunkturmittel in die Hand genommen hat und diesen Prozess auch mitfinanziert. Und da ist auch vom Mindset vieles gewachsen, was vor einigen Jahren noch nicht da war.“
Zum Scheitern verdammt? Das „Einer-für-alle“-Prinzip
Drei Milliarden Euro hat der Bund an Corona-Konjunkturmitteln in die Umsetzung des OZG gepumpt und konnte damit zumindest eine Zeit lang den ständigen Streit um die Finanzierung entschärfen. Sinnbild für das neue Zusammenwirken soll das „Einer-für-alle“-Prinzip, kurz EfA, sein. EfA bedeutet: Ein Bundesland - in der Regel der dortige IT-Dienstleister - digitalisiert ein Antragsverfahren nicht nur, sondern betreibt dieses Antragsverfahren selbst und lizenziert es bei Bedarf an andere Bundesländer, die es wiederum an ihre Kommunen weitergeben können.
Rechtlich waren dafür einige föderale Winkelzüge notwendig. Aber nur so könne die Vielzahl von bereits digitalisierten Verfahren endlich in Städte, Gemeinden und Kreise kommen, sagt die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus:
Rechtlich waren dafür einige föderale Winkelzüge notwendig. Aber nur so könne die Vielzahl von bereits digitalisierten Verfahren endlich in Städte, Gemeinden und Kreise kommen, sagt die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus:
„Wir müssen schnellstmöglich dann auch in den Betrieb kommen, das heißt in die Nachnutzung bei den anderen Ländern. Und dazu müssen wir wirklich auch sehen, dass wir die entsprechende digitale Infrastruktur bereitstellen.“
Die bisherigen Erfahrungen sind durchwachsen. Der „OZG-Booster“ genannte Versuch, 35 bereits entwickelte Online-Antragsverfahren noch bis Ende des Jahres bundesweit zur Verfügung zu stellen, scheiterte. Auf der Liste der zur Nachnutzung verfügbaren EfA-Leistungen finden sich bislang nur gut zwei Dutzend Online-Formulare.
Viele Kommunen sehen das Einer-für-Alle-Prinzip noch skeptisch. Während die Länder glaubten, mit der Erlaubnis zur Nachnutzung sei das Thema erledigt, sei die Praxis schwieriger: So müssen die Kommunen die Online-Formulare zunächst an die eigenen Systeme anschließen, damit die Daten auch ankommen. Und dann die Hersteller auch noch für den Regelbetrieb bezahlen.
„Problematisch ist es deshalb, weil jede Kommune, ich sag jetzt mal eine Zahl, vielleicht 70 verschiedene Fachanwendungen betreibt, die auch von verschiedenen Software-Herstellern hergestellt werden. Und dazu kommen jetzt geschätzt auch nochmal 300 verschiedene EfA-Leistungen und die müssen jetzt miteinander über Datenschnittstellen kompatibel gemacht werden“, sagt Stefan Domanske vom Landkreistag Niedersachsen.
In der Praxis werde die digitale Verwaltung für Kommunen nicht einfacher, sondern technisch komplizierter, sagt auch E-Government-Experte Torsten Frenzel: „Da kommt eine Plattform vom Bundesland A. Dann kommt ein Online-Dienst vom Bundesland B, was bestimmter Voraussetzungen im Rechenzentrum bedarf. Dann kommt wieder irgendein Formularserver von Bundesland C. Und eine Kommune muss sich dann um alle diese Systeme irgendwie kümmern.“
Die bisherigen Erfahrungen sind durchwachsen. Der „OZG-Booster“ genannte Versuch, 35 bereits entwickelte Online-Antragsverfahren noch bis Ende des Jahres bundesweit zur Verfügung zu stellen, scheiterte. Auf der Liste der zur Nachnutzung verfügbaren EfA-Leistungen finden sich bislang nur gut zwei Dutzend Online-Formulare.
Viele Kommunen sehen das Einer-für-Alle-Prinzip noch skeptisch. Während die Länder glaubten, mit der Erlaubnis zur Nachnutzung sei das Thema erledigt, sei die Praxis schwieriger: So müssen die Kommunen die Online-Formulare zunächst an die eigenen Systeme anschließen, damit die Daten auch ankommen. Und dann die Hersteller auch noch für den Regelbetrieb bezahlen.
„Problematisch ist es deshalb, weil jede Kommune, ich sag jetzt mal eine Zahl, vielleicht 70 verschiedene Fachanwendungen betreibt, die auch von verschiedenen Software-Herstellern hergestellt werden. Und dazu kommen jetzt geschätzt auch nochmal 300 verschiedene EfA-Leistungen und die müssen jetzt miteinander über Datenschnittstellen kompatibel gemacht werden“, sagt Stefan Domanske vom Landkreistag Niedersachsen.
In der Praxis werde die digitale Verwaltung für Kommunen nicht einfacher, sondern technisch komplizierter, sagt auch E-Government-Experte Torsten Frenzel: „Da kommt eine Plattform vom Bundesland A. Dann kommt ein Online-Dienst vom Bundesland B, was bestimmter Voraussetzungen im Rechenzentrum bedarf. Dann kommt wieder irgendein Formularserver von Bundesland C. Und eine Kommune muss sich dann um alle diese Systeme irgendwie kümmern.“

Genau wegen solcher Probleme werde auch das Einer-für-alle-Prinzip scheitern, prognostiziert deshalb Anke Domscheit-Berg. Sie ist Digitalpolitikerin und Bundestagsabgeordnete für die Linkspartei: „Das funktioniert nicht, wenn man keine einheitlichen Standards hat. Es funktioniert auch nicht, wenn trotzdem viele Bundesländer ihre eigenen Sonderlocken machen. Es funktioniert auch nicht, wenn man zum Beispiel äußerst komplexe Vertragsbedingungen damit verbindet. Und es gibt auch keine klaren Preismodelle."
Experte: Digitalisierung mehr als "nur technische Umsetzung"
Ist die deutsche Verwaltungsdigitalisierung also auf dem falschen Weg? Eine Frage für den österreichischen Digitalexperten Christian Rupp. Er ist seit zwei Jahrzehnten in Digitalisierungsprozesse auf EU-Ebene und in ganz Europa involviert. Und sagt: In Deutschland verstehe man oft nicht, dass Digitalisierung mehr ist als nur eine technische Umsetzung:
„Meistens ist ja auch die Herausforderung, dass nicht bis zu Ende gedacht wird. Das heißt: Wie schaut’s aus, das Schulungskonzept? Wie schaut aus das Marketingkonzept? Wie sieht es aus, wenn man dann die Software auch hat und sie weiterentwickelt wird?“
Klare Verantwortung, konkrete Zwischenschritte, Einbeziehung von Akteuren aus der Praxis und ganzheitliche Konzepte zur Einführung: Das sei in erfolgreicheren Digitalisierungsländern wie Österreich der Schlüssel gewesen. Die deutsche Lage sei nicht zwangsläufig - denn man habe die Bedeutung bestimmter Technologien früh erkannt.
Zum Beispiel beim elektronischen Personalausweis, an dem sich das Problem veranschaulichen lässt: „Deutschland war eigentlich ein Vorreiter beim Anerkennungsprozess des elektronischen Personalausweises in Brüssel. Nur hat man das weder vermarktet noch verkauft irgendwo.“
Klare Verantwortung, konkrete Zwischenschritte, Einbeziehung von Akteuren aus der Praxis und ganzheitliche Konzepte zur Einführung: Das sei in erfolgreicheren Digitalisierungsländern wie Österreich der Schlüssel gewesen. Die deutsche Lage sei nicht zwangsläufig - denn man habe die Bedeutung bestimmter Technologien früh erkannt.
Zum Beispiel beim elektronischen Personalausweis, an dem sich das Problem veranschaulichen lässt: „Deutschland war eigentlich ein Vorreiter beim Anerkennungsprozess des elektronischen Personalausweises in Brüssel. Nur hat man das weder vermarktet noch verkauft irgendwo.“
Bürger sind zu wenig in digitale Prozesse integriert
Den elektronischen Personalausweis gibt es bereits seit 2010. Jeder Ausweis hat die Online-Funktion. Für die Online-Identifizierung ist nicht mal mehr ein Karten-Lesegerät nötig, sondern nur eine App auf einem gängigen Smartphone. Allerdings wissen das die wenigsten Bürgerinnen und Bürger. Genauso wenig wie Verwaltungen und Firmen, die das System nur selten in ihre digitalen Prozesse integrieren.
Christian Rupp: „Da hat natürlich Deutschland viel versäumt. Weil wenn ich heute auf ein Amt gehe und mir meinen Personalausweis hole, kann mir keiner erklären: Wozu brauche ich jetzt eine elektronische Identität? Wie kann ich die aktivieren? Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Und ich habe immer gesagt, das muss jede Bürgermeisterin und Bürgermeister mir am Wochenende am Stammtisch erklären können. Nur dann wird’s funktionieren.“
Auch bei solchen Fragen sei man inzwischen auf dem richtigen Weg, betont dagegen Innen-Staatssekretär und Bundes-CIO Markus Richter. Und richtet den Blick zurück auf das Onlinezugangsgesetz und das, was funktioniert. Oder zumindest bald funktionieren soll:
Christian Rupp: „Da hat natürlich Deutschland viel versäumt. Weil wenn ich heute auf ein Amt gehe und mir meinen Personalausweis hole, kann mir keiner erklären: Wozu brauche ich jetzt eine elektronische Identität? Wie kann ich die aktivieren? Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Und ich habe immer gesagt, das muss jede Bürgermeisterin und Bürgermeister mir am Wochenende am Stammtisch erklären können. Nur dann wird’s funktionieren.“
Auch bei solchen Fragen sei man inzwischen auf dem richtigen Weg, betont dagegen Innen-Staatssekretär und Bundes-CIO Markus Richter. Und richtet den Blick zurück auf das Onlinezugangsgesetz und das, was funktioniert. Oder zumindest bald funktionieren soll:
„Wenn ich an BaföG Digital denke, an den elektronischen Bauantrag, der zunächst nur in zwei, drei Kommunen verfügbar war, an den sich jetzt zehn Bundesländer angeschlossen haben. Oder wenn ich an Ummeldung denke, etwas, was Hamburg entwickelt hat, dort jetzt produktiv ist. Das sind doch die Anwendungsfälle, die die Menschen und Unternehmen in diesem Land brauchen.“
EU-Ranking – Deutschland liegt auf Platz 21
Fakt ist aber: Deutschland hängt zurück. In einem EU-Ranking von 37 Staaten zum Stand der Verwaltungsdigitalisierung belegt die Bundesrepublik nur Platz 21. Und die Aufgaben stapeln sich: Wichtige Finanzierungsfragen für 2023 müssen noch bis Weihnachten geklärt werden. Das Nachfolgegesetz „OZG 2.0“ ist längst überfällig, hatte aber zuletzt noch nicht einmal das Bundesinnenministerium verlassen. Im OZG 2.0 könnte Bürgern und Unternehmen erstmals ein Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen zugesichert werden – ein umstrittener Aspekt, der aber den Druck zur Umsetzung erhöhen würde.
Anfang 2024 dann tritt bereits eine EU-Verordnung in Kraft, mit der die wichtigsten digitale Amtsgeschäfte sogar über europäische Grenzen hinweg möglich sein müssen. Dass Deutschland die Umsetzungsfrist reißt, gilt als so gut wie sicher.
Anfang 2024 dann tritt bereits eine EU-Verordnung in Kraft, mit der die wichtigsten digitale Amtsgeschäfte sogar über europäische Grenzen hinweg möglich sein müssen. Dass Deutschland die Umsetzungsfrist reißt, gilt als so gut wie sicher.
Hunderte von Verzeichnissen müssen noch digitalisiert werden
Und dann wartet da noch die Mammutaufgabe: Die Registermodernisierung, also die Volldigitalisierung von Verwaltungsverzeichnissen. Denn ob Personenstandsregister, Gewerbeverzeichnis oder Tierbestandsregister - Hunderte von Verzeichnissen, die bei Verwaltungen in ganz Deutschland liegen, müssen digitalisiert werden. Und zwar so, dass sie von Berchtesgaden bis Flensburg miteinander vernetzt werden können. Die Komplexität der Registermodernisierung, so viel zeichnet sich ab, übertrifft die der Einführung von Online-Anträgen um ein Vielfaches.
„Unsere Erfahrungen aus vergangenen Registermodernisierungen, zum Beispiel das nationale Waffenregister, setzte auch voraus, dass die ganzen Waffenregister in den Kommunalbehörden konsolidiert wurden. Das hat zehn Jahre gedauert“, sagt Ariane Berger vom Deutschen Landkreistag. „Und diese Frist werden wir auch brauchen für ganzen für unsere Registermodernisierung relevanten Register. Dass ist eben nicht nur das Melderegister, sondern das sind insgesamt 300 Register in Deutschland. Und da traut man sich jetzt noch nicht dran.“
„Unsere Erfahrungen aus vergangenen Registermodernisierungen, zum Beispiel das nationale Waffenregister, setzte auch voraus, dass die ganzen Waffenregister in den Kommunalbehörden konsolidiert wurden. Das hat zehn Jahre gedauert“, sagt Ariane Berger vom Deutschen Landkreistag. „Und diese Frist werden wir auch brauchen für ganzen für unsere Registermodernisierung relevanten Register. Dass ist eben nicht nur das Melderegister, sondern das sind insgesamt 300 Register in Deutschland. Und da traut man sich jetzt noch nicht dran.“






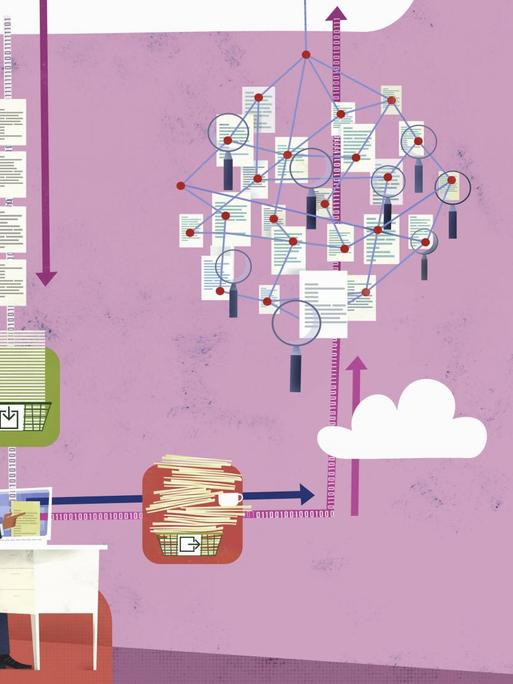








![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)


