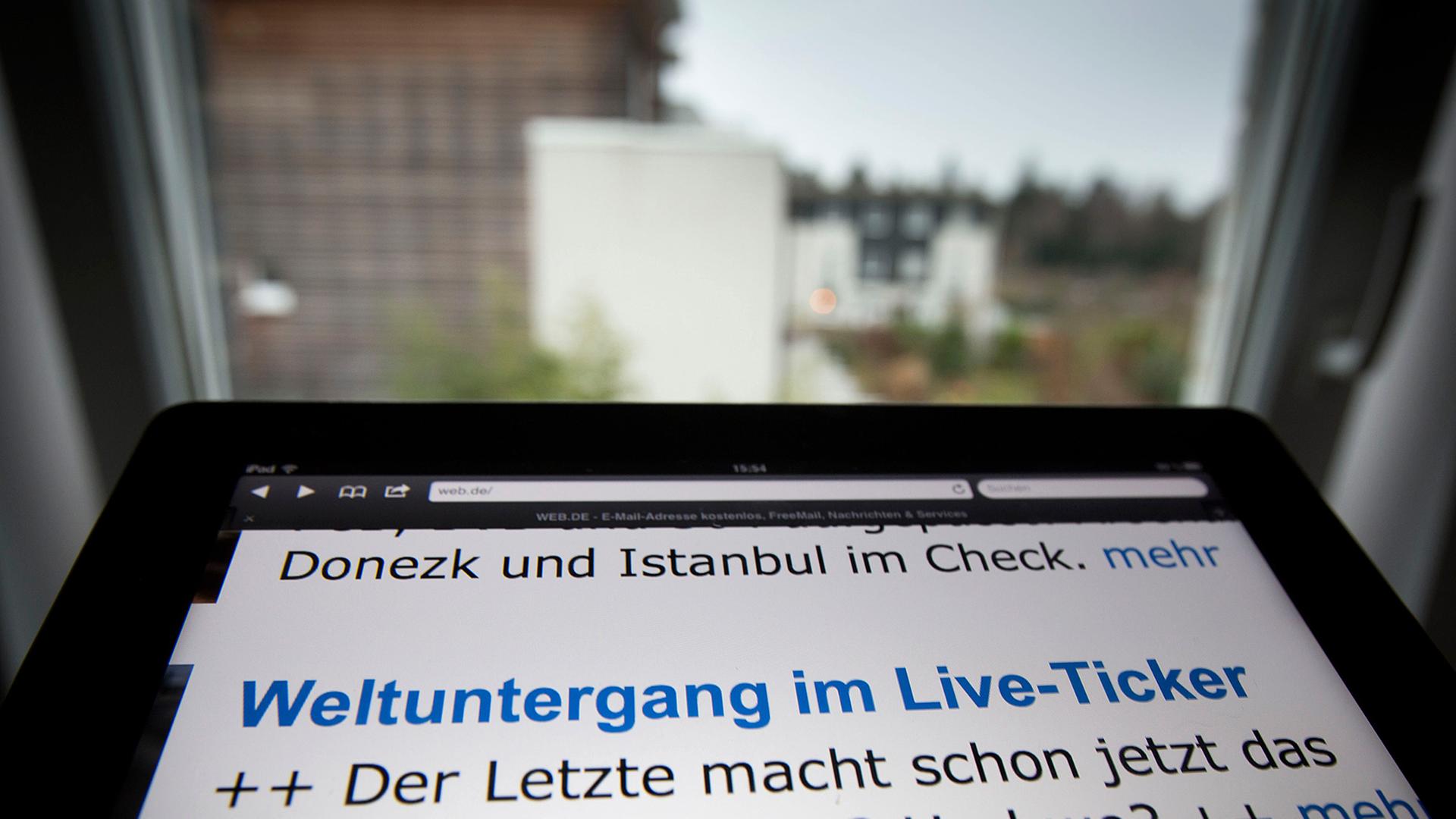
Alles ist im Fluss. Aber ist alles auch auf einem guten Weg? Die Digitalisierung verändert den Journalismus fundamental. Das löst Unsicherheiten aus. Bange Blicke gehen nicht nur in die USA, wo es bereits zeitungslose Landstriche gibt. Auch in Deutschland wächst der Druck auf die Zeitungen und Magazine.
Beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in Hamburg spaltet der Versuch einer neuen Digitalstrategie das Haus und kostete Chefredakteure den Job. Die Entscheidung bei der "Süddeutschen Zeitung", den Leiter der Onlineredaktion zum Mitglied der Chefredaktion zu machen, löste im Frühjahr 2014 Irritation in der Branche aus. Und Ende 2014 schlug der Rauswurf des Chefredakteurs bei der renommierten Züricher "NZZ" ebenfalls Wellen. Nicht nur Verlage, auch Fernseh- und Radiosender suchen nach Wegen, den Journalismus der alten Medien mit den neuen digitalen Ausspielwegen zu verbinden.
Um es vorweg zu sagen: Die Digitalisierung per se gefährdet den Journalismus nicht. Im Gegenteil: Sie bietet immense Chancen. Doch die gewaltige Dynamik, mit der sich der Journalismus im Netz entwickelt, birgt auch zahlreiche Fallstricke.
Im Folgenden geht es um drei Aspekte:
- Die Schnelligkeit: Nachrichten verbreiten sich in Bits und Bytes wie ein Lauffeuer.
- Die Interaktion: Nutzer und Nutzerinnen digitaler journalistischer Angebote haben ein komplett anderes Selbstverständnis als traditionelle Zeitungsleser, Radiohörer und Fernsehzuschauer und müssen anders einbezogen werden.
- die multimedialen Möglichkeiten des Netzes: Sie erfordern ein neues, ein crossmediales Denken in den Redaktionen.
In der besten aller möglichen Nachrichtenwelten, wie sie die amerikanische TV-Serie "The Newsroom" idealerweise darstellt, gelingt die Verbindung zwischen alter linearer Medienwelt und sozialen Netzwerken in einer Fernsehnachrichten-Redaktion scheinbar spielerisch: Während der Nachrichtensendung wird kurz der über das Smartphone eingehende Tweet gegengecheckt und sogleich in die Liveshow eingebaut. Die tägliche digitale Wirklichkeit ist indes viel komplexer, sie fängt mit der Frage nach der Gewichtung von Nachricht und Recherche an.
Das Netz vergisst nichts
Schlägt in der Online-Welt Nachricht Recherche? Auf alle Fälle ist Schnelligkeit zum Qualitätskriterium geworden - wer veröffentlicht die News zuerst? Das erhöht den Arbeitsdruck in den Redaktionen. Dennoch gilt in seriösen Medien der alte journalistische Grundsatz auch im Netzzeitalter: "Be first - but first be right!" – "Sei der Erste, aber sei in erster Linie korrekt!". Denn das Netz vergisst nichts. Fehler, einmal in der Welt, sind fast nicht mehr korrigierbar.
Enorm wichtig ist (weiterhin) die Quellentransparenz, das Kenntlichmachen der Herkunft einer Nachricht. Vielleicht ist es heute sogar noch wichtiger, dass im Teaser oder Anreißer auf der Homepage oder App auch die Quelle genannt wird, damit die Nutzer und Nutzerinnen wissen, woher die Informationen stammen. Zudem können Originaldokumente, nicht journalistisch bearbeitete Rohfassungen und der Wortlaut von Reden, so sie im Internet vorhanden sind, verlinkt werden. So können sich Nutzer bei Bedarf gleich selbst weiter und hintergründiger informieren. Das geschieht tatsächlich viel zu selten, obwohl es einer der großen Vorteile des Hypertext-basierten Journalismus ist: Er erlaubt, Inhalte im Netz direkt miteinander zu verknüpfen.
Die Quellen offenzulegen stärkt die Glaubwürdigkeit des jeweiligen Mediums - und Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut. Tageszeitungen mit jahrhundertelanger Tradition können ihren guten Ruf im Netz verspielen, wenn sie dort, anders als in der Druckausgabe, reißerisch und oberflächlich berichten. Ob Print, Radio oder Fernsehen, die jeweiligen Medien erfinden sich online nicht völlig neu, genauso wenig wie der Journalismus generell durch die Digitalisierung neu erfunden wurde.

Recherche gehörte und gehört zum Handwerk: Stimmt die Information? Welche Bedeutung hat sie für das Gesamtgeschehen? Wer kann mehr darüber wissen? Kann das Foto oder Video aus den sozialen Netzwerken verifiziert werden? Inzwischen gibt es ein wieder gewachsenes Bewusstsein für die Notwendigkeit des Fact Checkings, des Überprüfens von Fakten und Informationen.
Fragen nach den Konsequenzen bleiben zunächst unbeantwortet
Dennoch ist die Sorge berechtigt, dass die journalistische Recherche im Onlinezeitalter zu kurz kommt. Ohne Frage: Es gibt einen Wettlauf um die schnellste Eilmeldung und einen Trend zur schnellen fortlaufenden Berichterstattung. Ist das ein Service für das Publikum? Geht es vor allem um das Erhaschen von Aufmerksamkeit und Klicks? Oder geht es gar nur um den Wettkampf der Nachrichtenkonkurrenten, die nicht mehr allein aus journalistischen Anbietern bestehen?
Über die sozialen Netzwerke Twitter, Instagram und Facebook werden Sportereignisse und -ergebnisse genauso wie Katastrophennachrichten häppchenweise in die Welt gestreut. Aus Gerichtsverhandlungen erfahren wir im Sekundentakt, wann die Richterin in die Pause geht. Bei Volksabstimmungen teilen uns die Social Media kurzfristige Stimmungsschwankungen aus den Wahllokalen mit. Um zu wissen, was auf der Welt passiert, kann sich jeder Eilmeldungen abonnieren. Sogenannte Live-Blogs, in denen fortlaufend und fast in Echtzeit über Ereignisse berichtet wird, sind "in".
Doch mehr als das, was wann wo passiert ist und wer wie reagiert hat, wissen die Leserinnen und Leser dann noch nicht. Das Warum und die Frage nach den Konsequenzen des Geschilderten bleiben damit zunächst unbeantwortet. In den Redaktionen gibt es darüber engagierte Debatten: Denn die schnelle Kurznachricht liefert keinen Kontext, bindet aber Personal und Ressourcen, die besser für eine gleichzeitige vertiefende Recherche eingesetzt werden könnten.
In der besten aller Medienwelten, in der US-Serie "The Newsroom", leisten das die Redakteure und Redakteurinnen. Sie nutzen Twitter als Rechercheinstrument bei der investigativen Recherche, indem sie herausfinden, wann zu einem Thema Tweets, also Twittermeldungen, abgesetzt wurden. Sie finden aber auch schnell und effektiv während einer Live-Sendung heraus, von wo aus ihre Informanten anrufen oder digitale Nachrichten absetzen.
Viel heiße Luft
Genau das ist der Job von Journalisten und Journalistinnen, die digital arbeiten: Informationen im Netz zu finden, zu sichten und zu gewichten. Die sozialen Medien zu beobachten, ist Teil der Informationsbeschaffung und Informationsbewertung, des sogenannten redaktionellen Monitorings: Was passiert gerade wo? Wer ist involviert oder weiß mehr? Welche Reaktionen sind für unsere journalistischen Geschichten wichtig? Kommentare, Posts, Tweets können die Berichterstattung anstoßen oder ergänzen. Im digitalen Zeitalter nennt man diese Arbeit das Kuratieren.
Schnell und direkt informiert werden, möglichst nah an dem Moment, in dem es passiert - diesen Service bieten nicht mehr nur journalistische Portale. Breaking News sind eine heiß gehandelte Ware - und das erst recht im digitalen Journalismus, wo die knappen Text-Bytes schnell und einfach übertragen werden. Die Auswahl und Gewichtung von Nachrichten durch Journalisten, das Gatekeeping, findet dabei nicht mehr zwangsläufig statt. Denn jeder, der zum Beispiel den Kurznachrichtendienst Twitter intelligent zu nutzen weiß, ist bei der Informationsbeschaffung zeitlich gleichauf mit den Redaktionen. Erstmal ist dies eine gute Entwicklung, so wie jede Form der Quellentransparenz, denn auf Twitter können sich alle Interessierten die zugegeben kurzen, aber direkten Mitteilungen der politischen und gesellschaftlichen Akteure von der Quelle beschaffen.
Es kommen allerdings auch immer mehr Anbieter hinzu, die viel heiße Luft in die Welt pusten. Zudem läuft das inflationäre Versenden von Eilmeldungen Gefahr, als marktschreierisch oder als simple Marketing‑Strategie wahrgenommen zu werden. Seriöse Nachrichtenportale brauchen eine verlässliche Breaking‑News‑Strategie, die sich über nachvollziehbare Kategorien von Nachrichten-Werten definiert, um die Nutzer und Nutzerinnen nicht zu verwirren oder mit Belanglosigkeiten zu nerven.
Die Wucht ungefilterter Veröffentlichungen
Die Orientierungsfunktion des Journalismus rückt dabei in den Vordergrund. Das Abwägen und Einordnen erfordert professionelle Distanz. Diese aufzubauen ist im redaktionellen Alltag schwer. Skandale und Gerüchte entwickeln im Netz eine gewaltige Dynamik. Die schwierige Frage in der täglichen Arbeit: Springen wir auf das Thema auf - oder ignorieren wir es und gelten schlimmstenfalls als ignorant oder verpennt?
Über die sozialen Netzwerke - und das ist eine neue Herausforderung seit wenigen Jahren - gewinnen ungefilterte Veröffentlichungen eine Wucht, zu der sich journalistische Medien in irgendeiner Form verhalten müssen. Ein Beispiel für die Beeinflussung der öffentlichen Meinung über soziale Medien sind die gezielten Postings russischer Agenturen zum Ukraine-Konflikt, die im Sommer 2014 weltweit die Meinung in den sozialen Netzwerken im Sinne des Kreml massiv beeinflussten.
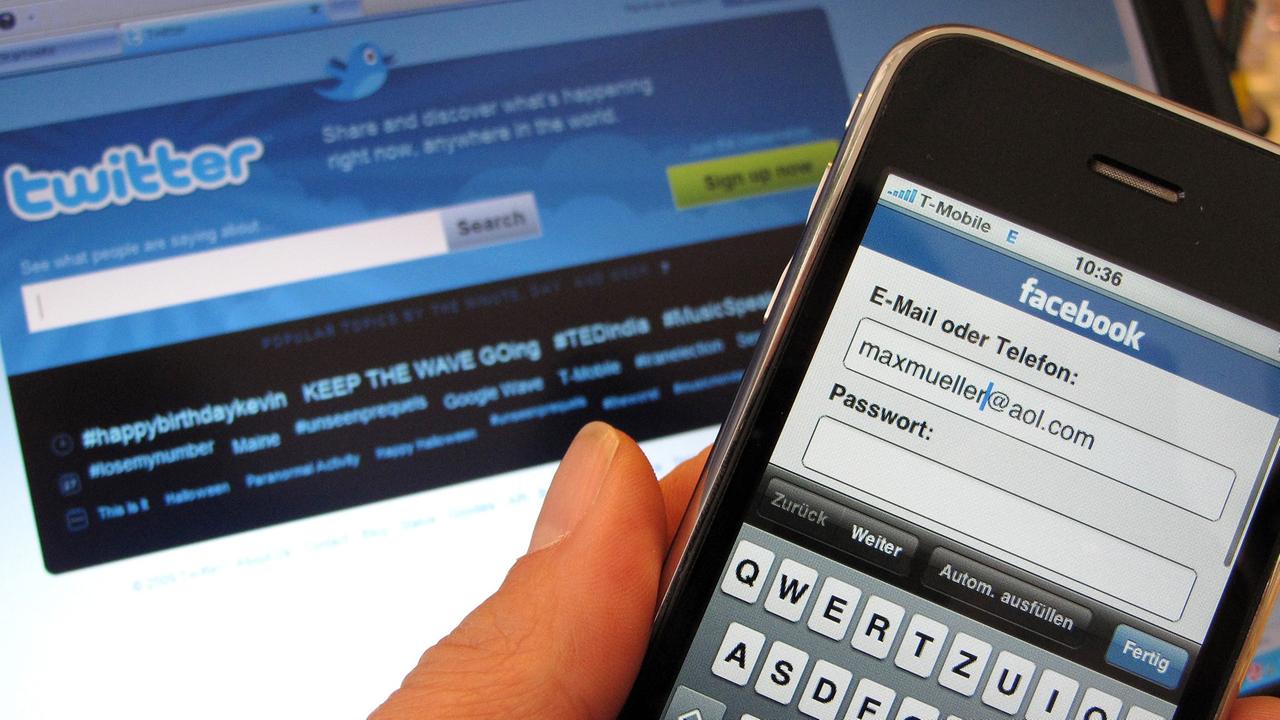
Ist der Journalismus also online leichter zu manipulieren als im langsamer getakteten Produktionsprozess der Print- und Fernsehmedien? So zumindest zeigt es das Beispiel von Bettina Wulff, der geschiedenen Ehefrau des Ex-Bundespräsidenten Wulff. Unterstellungen über ihr voreheliches Privatleben kursierten auf Facebook, wo sich alle Menschen, die einen Fankreis oder Freundeskreis von Tausenden besitzen, zu kleinen Meinungsführern entwickeln können. Die nicht verifizierten Behauptungen im Fall Wulff sickerten - und sei es auch nur als Zitat von eben diesen Plattformen - in die Medien ein oder wurden dort einfach kolportiert. Bestätigte Aussagen gab es nie.
Ob wir Blogs, Kommentare, Posts und Tweets als Äußerungen von digitalen Wut- oder digitalen Gutbürgerinnen und -bürgern wahrnehmen, ist eine Frage der redaktionellen Haltung. Für wen die redaktionelle Plattform der verlängerte Arm zu einer größeren Öffentlichkeit ist, muss immer wieder aufs Neue Diskussionspunkt in jeder Redaktion sein.
Blogger, Kampagnenmacher oder Plagiatsjäger sind neue massenmediale Akteure, die an Einfluss gewinnen. Nicht mehr nur Journalisten übernehmen die mediale Deutung gesellschaftlicher Entwicklungen. In der neuen digitalen Öffentlichkeit entfalten so zum Beispiel Skandale eine Virulenz, die Reaktionen dringend erfordere und jedes Aussitzen ausschließe, sagt der Hamburger Medienforscher Steffen Burghard. Darin liegt eine große Chance für die journalistische Herangehensweise.
In der besten aller Medienwelten, der US-Serie "The Newsroom", schafft es die Occupy-Wallstreet-Bewegung nur deshalb in die Hauptnachrichtensendung, weil der Onlineredakteur deren Social‑Media-Kampagnen nicht ignoriert, sondern die politische Brisanz dahinter früh erkennt. Er argumentiert vor allem damit, dass die Bewegung eine starke Resonanz im Netz auslöst.
Reaktionen im Affekt
Nutzer-Kommentare können den Blick für Probleme und Fehlentwicklungen schärfen, den Finger in die Wunde legen. Das fängt beim Schlagloch-Report an und geht bis zu Hinweisen auf Missstände in einer Behörde oder in einem Unternehmen. Der Umgang mit Nutzerbeiträgen kann in zwei Richtungen gehen:
Sieht die Redaktion einen journalistischen Informationswert? Dann setzt sie selbst das Thema.
Oder dient die Kommentarfunktion auf der Internetseite der Förderung der demokratischen Partizipation, quasi als Sprachrohr für jedermann?
Das Problem: Die digitalen Wege sind kurz, der Rückkanal ist unkompliziert und direkt. Das Netz der Nutzer dient sehr häufig der ersten Reaktion im Affekt, oft heftig, oft auch anonym. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema findet nicht statt. Vor allem dann nicht, wenn zu viele Trolle aktiv sind, Menschen, die Diskussionen im Netz nur destruktiv kommentieren.
Eine Studie des amerikanischen Pew Research Center von 2014 untermauert, dass soziale Medien keineswegs im erhofften Maße zur Meinungspluralität bei kontrovers diskutierten Themen beitragen. Zwar werden demnach in den USA sowohl unterhaltsame als auch journalistische Themen in großem Umfang über Facebook, YouTube, Twitter und Reddit geteilt, aber die Mehrheit der User hält sich mit politischen Meinungsäußerungen zurück.
Für den offenen Umgang mit der Kommentarfunktion spricht, dass die "Kundschaft" dadurch länger auf der Website bleibt. Die Verweildauer gewinnt im Vergleich zu den Klickzahlen immer mehr an Bedeutung für Anzeigenkunden und damit für die Portale selbst. Aber wie motiviert man die Leserinnen und Leser zu einer inhaltlich konzentrierten Debatte? Einen Weg aus dem Dilemma der Kommentarfunktion sehen online-Verantwortliche neuerdings in von der Redaktion vorgegebenen Diskussionsthemen. "Talking Points" nennt der britische "Guardian"entsprechende Einladungen auf seiner Website. Den "Room for Debate" hat die "New York Times" eingerichtet. Auch bei deutschen Onlineportalen gibt es jetzt wieder ausgewählte Diskussionsthemen, statt fast alles kommentierbar zu machen wie in den vergangenen Jahren.
Eine parallele Öffentlichkeit durch Blogs und Portale
Tagesschau.de-Chefin Christiane Krogmann kündigt einen Paradigmenwechsel an und sagt: "Wir wollen etwas genauer schauen: Was sind für uns die Themen, die am Tag eine Diskussion wert sind."
Süddeutsche.de bietet bereits seit 2014 in einem Extraforum täglich zwei bis drei aktuelle Themen für Diskussionen an. Mehr Qualität verspricht sich Chefredakteur Stefan Plöchinger davon und schob gleich noch eine Rubrik mit dem Titel "Die Recherche" hinterher: Leser der Nachrichtenplattform können dort der Redaktion Recherchevorschläge machen.
Solche Angebote fördern die inhaltliche Qualität eines Portals und binden die Leser, Hörer und Zuschauer an die Marke. Darüber hinaus gehen die Inhalte, die von Nutzern eigenständig erstellt werden, "User Generated Content" genannt. Nach der Jahrtausendwende setzte sich der Begriff Web 2.0 für die Idee durch, dass das Internet das Publikum nicht als reine Konsumenten, sondern als Produzenten von Inhalten integriert. Aber hat sich über das reine Posten auf Plattformen von Medienunternehmen hinaus - dazu gehören auch Bürgerreporter oder Apps zum Hochladen eigener Videos, Fotos oder Texte - etwas Substanzielles getan in der Blogosphäre, der Welt der Blogger? Gibt es ernst zu nehmende Produzenten von Inhalten unabhängig vom Medien-Mainstream?

In Deutschland war die Entwicklung zäh und langsam, aber sie kommt tatsächlich in Schwung. Für eine parallele Öffentlichkeit sorgen zum Beispiel lokale Blogs und Portale, Twitterer mit lokalen und thematischen Schwerpunkten und Videoblogger auf YouTube. Themenkarrieren verlaufen jetzt unabhängig von den Regeln und Ritualen etablierter Redaktionen. Fach-, Interessens- und lokale Gruppen setzen Themen jenseits der Schlagzeilen. Sie agieren komplementär zum Mainstream-Journalismus.
Unabhängigkeit vom Zeitungs-Kiosk
Es gibt tatsächlich keinen Grund, dass Journalistinnen und Journalisten als Einzelpersonen mehr zu sagen haben sollten. Schafft das digitale Medium also die Priesterklasse der journalistischen Meinungsmacher ab, wie der Philosoph Byung‑Chul Han feststellt? Nicht ganz. Aber es stellt sie - und das ist gut so - massiv in Frage. Journalisten verlieren zwar ihr Privileg als Gatekeeper, bleiben aber auch in der Netzwelt die Profis, die sich an die journalistischen Standards der Recherche, des Opfer- und Informantenschutzes, des korrekten Umgangs mit Sprache und Political Correctness halten. Als Profis mit diesem Hintergrund bestimmen sie die Inhalte und den Stil ihres Mediums. Das ist der Grund, warum gut gemachter Journalismus weiterhin sein Geld wert ist - egal, ob analog oder digital.
In der besten aller Medienwelten, in der Welt der US-Serie "The Newsroom", gründet eine Reporterin ihre eigene politische Website, weil sie den Konformismus der Fernsehkanäle während des Wahlkampfes 2012 nicht weiter mitmachen wollte. Sie ist erfolgreich damit - auch als Einzelkämpferin. Der digitale Journalismus braucht den ganzen Produktionsapparat nicht - Studio, Druckerei, Vertriebssystem. Er braucht den klugen journalistischen Kopf genauso wie die "alten" Medien und eine gute Publikations-Software.
Das Publizieren im Internet ist in den letzten fünf Jahren immer einfacher geworden. Mag vor wenigen Jahren noch die langsame Übertragungsgeschwindigkeit ein Grund dafür gewesen sein, dass das Lesen und Schauen am Rechner unkomfortabel war, vollzieht sich zurzeit mit dem Standard LTE, der vierten Generation des Mobilfunks, für mobile Endgeräte eine technologische Revolution. Das Konsumieren von Texten, Fotos und Videos auf Tablets und Smartphones ist damit genauso angenehm wie das Lesen eines Magazins. Hinzu kommt: Das Klicken, Scrollen, Wischen gehört inzwischen in allen Generationen zur Kulturtechnik und die mobilen Endgeräte ermöglichen die Unabhängigkeit vom Zeitungs-Kiosk.
Onlinejournalismus kann eigentlich alles: die schnelle Nachricht, Hintergründiges, Fotos einzeln und als Bilderstrecke publizieren, vertonte Audioslideshows, Inhalte über Hypertext miteinander verknüpfen sowie das Verlinken auf Inhalte anderer Angebote, Videos, Grafik - auch interaktiv, multimediale Webreportagen und dazu auch noch Datenjournalismus. Ein beachtlicher Katalog. Online-Geschichten sind weder für die Macherinnen und Macher noch für die User ein fixes, sondern ein dynamisches Produkt - auch nach der Veröffentlichung. Denn sie sind ständig aktualisierbar und zudem noch personalisierbar.
Crossmediales Denken und Arbeiten
Der digitale Journalismus hat mit diesen Möglichkeiten ein erhebliches Verdrängungspotenzial gegenüber den alten Medien erreicht.
Ein beeindruckendes Online-News-Projekt stammt aus dem Jahr 2007 über den Einsturz der 35W Bridge in Minneapolis. Die WebseiteStartribune.com zeigt auf einer Aufnahme von der zerstörten Brücke alle in diese Katastrophe verwickelten Fahrzeuge, Regina McCombs, die damals zum Onlineredaktionsteam der Regionalzeitung "Star Tribune" gehörte, wollte online zeigen, "was weder die Zeitung noch das Fernsehen kann".
Alle Überlebenden sind gefragt worden, in Wort, Bild oder Film ihre Gedanken zur Katastrophe zu äußern. So entstand eine Art "Memorial", eine digitale Gedenkstätte im Netz.
McCombs' geschilderte Herangehensweise ist ein entscheidender Hinweis auf das notwendige Umdenken in Redaktionen: Crossmediales Denken und Arbeiten.
Heute wird in den Medienhäusern vielfach noch ein ursprüngliches Print-, Fernseh- oder Radiostück im Netz präsentiert und im Nachhinein überlegt, was für die Onlinepräsenz noch notwendig ist. Sinnvoll wäre es in der Nachrichtenwelt von heute, für jede größere Geschichte eine crossmediale Publikationsstrategie zu entwickeln. Dann lauten die entscheidenden Fragen: Zu welchem Aspekt brauchen wir Bewegtbild, also Video? Was lässt sich am besten mit Texten schildern? Welchen Mehrwert liefert eine Grafik im konkreten Fall? Die Plattformen werden bei dieser Arbeitsweise als gleichberechtigt wahrgenommen, ihre journalistischen Akteurinnen und Akteure auch.

Trotzdem wird es weiter Formate geben, die auch im Informationsbereich ein "Lean‑back"-Bedürfnis erfüllen, das heißt linearen Medienkonsum ohne aktives Auswählen und Klicken ermöglichen. Das sind zum Beispiel - für die Nachrichtenwelt gesprochen - längere Reportagen und Dokumentationen im Fernsehen und Radio; oder aber abendliche Nachrichtensendungen, die durch ihre zeitliche Begrenzung das Gefühl des kompletten Überblicks zumindest situativ suggerieren. Noch ist das so.
In der besten aller Medienwelten, der US-Serie "The Newsroom", steht die Diskussion über Crossmedialität ganz am Anfang. Die Entscheidung für einen durchlaufenden Nachrichten-Crawl während der Sendung begründet der Chefredakteur mit den Gewohnheiten der Twitter-Nutzer. Das lineare Medium adaptiert vom Internet geprägte Standards.
Die totale Vermessung des Users
Zur Online-Strategie gehört die Nähe zum User, das heißt auch: Wissen, wie der User tickt. "Meist gelesen" heißt eine Rubrik auf vielen Onlineportalen. Ehrlicher wäre "Meist geklickt", denn die Verweildauer auf den Seiten ist äußerst kurz. Die Konsequenz für Online‑Zeitungsmacher daraus ist, herauszufinden, was die Nutzer und Nutzerinnen lesen und anschauen wollen - und auch, wofür sie bezahlen würden. Dafür müssen akzeptable Bezahlsysteme entwickelt werden. Diese Fragen zielen auf die Vermessung des Users - oder auch: des Kunden. In den USA ist das längst Medienalltag. Der Chefredakteur der "Washington Post", Marty Baron, sagt in einem "Spiegel"-Interview:
"Früher haben wir uns als Journalisten mit der Konkurrenz verglichen, aber wir haben nie gemessen, ob unsere Kunden auch so denken."
Jetzt - also seit Amazon-Chef Jeff Bezos Eigentümer des Traditionsmediums "Washington Post" ist - wird nicht nur die Beliebtheit der eigenen Inhalte gemessen, sondern auch geschaut, welche Namen und Begriffe in den sozialen Netzwerken gerade Beachtung finden. Was hat "Buzz", das heißt Gesprächswert? Das will die Redaktion rechtzeitig wissen, also noch während des Produktionsprozesses, um die Leser zu bedienen mit den Themen, die sie gerade beschäftigen. Im Idealfall läuft das im direkten digitalen Dialog. Es ist ein zentrales Element der Leserbindung und der Akzeptanz von Bezahlsystemen.
Die totale Vermessung des Users ist zwiespältig. Unsere Daten sind nicht nur viel Geld wert, sondern auch schützenswert, weil wir das Recht auf informationelle Selbstbestimmung haben. Dieses Recht ist in der Tat mehr als Geld wert. Die Nutzer sollten souverän entscheiden können, wem sie ihre Daten zur Verfügung stellen wollen.
Schon immer stand insbesondere der Zeitungsjournalismus im Spannungsfeld zwischen ideellen und kommerziellen Werten. Die ökonomische Verantwortung veränderte sich im Laufe der Berufsgeschichte analog zu den technologisch bedingten Veröffentlichungsmöglichkeiten. Die Entwicklung der Telegrafie, des Nachrichtenagenturwesens und des Massendrucks sorgte nicht nur für die zunehmende Professionalisierung des journalistischen Berufs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sondern auch für ein neues Selbstverständnis der Journalisten. Der Historiker Jörg Requate hält fest, dass Journalisten zunehmend Angestellte wurden, keine Herausgeber mehr.Der ökonomische Erfolgsdruck lag von da an vorwiegend auf den Schultern der Verleger. Heute stehen die neuen "Herausgeber", die nur online publizieren, in direkter Konkurrenz zu den klassischen Medienunternehmen: Beide müssen damit Geld verdienen. Nur einen Klick entfernt sind aber auch die öffentlich-rechtlichen oder stiftungsfinanzierten Websites im Wettrennen um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer und ‑nutzerinnen.
Orientierung geht dabei vor Originalität
Es scheint paradox: Je mehr Leser und Leserinnen die Tageszeitungen und Magazine verlieren, je rapider die Anzeigeneinnahmen im Printbereich sinken, je mehr Empörung Massenentlassungen von Journalisten auslösen und je mehr TV‑Sender auf der Welle des Infotainments mitschwimmen, desto interessanter und vernünftiger wird die Diskussion über den Journalismus als Profession. Denn es gibt durchaus auch gedruckte Zeitungen und Magazine, die zugewinnen – "Die Zeit", "Brand Eins" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonntag" zum Beispiel. Eine Quintessenz aus dieser Debatte: Nur zuverlässige Qualität bindet die Kundschaft langfristig.
Aber auch Qualität braucht Verkaufsstrategien - und das gerade im Informationsdschungel des Internets, wo das Interesse schwer zu erhaschen ist. Das Surfen im Netz gleicht tatsächlich einer Fahrt über Boulevards: Was erreicht das scannende Auge, mit welchen Signalwörtern wird die Aufmerksamkeit geweckt, wenn der digitale Zeitungsjunge seine Schlagzeilen anpreist?
Eines der größten Missverständnisse über den Journalismus im Netz ist, dass er flüchtig sei. Doch kaum etwas ist nachhaltiger als ein Bericht im Netz, wo er - falls so gewollt - für immer auffindbar ist. Das Bewusstsein darüber ist mit der Macht der Algorithmen und der Raffinesse der Suchmaschinen vor allem in den letzten zehn Jahren enorm gewachsen. Wer weiß, wie die Suchmaschine funktioniert, erstellt gute Inhalte, die eine Verlinkung wert sind und schnell gefunden werden. Orientierung geht dabei vor Originalität - für den User und die Suchmaschine. Das Netz ist genau der Ort, wo die Menschen nach Informationen suchen. Gehaltvoller Content von Onlinemedien sollte deshalb zu den ersten Suchergebnissen gehören.
Alles ist im Fluss. Die Dynamik des digitalen Journalismus wird weiter zunehmen. Immer neuer Handlungsbedarf entsteht - nicht nur durch neue Soziale Medien. Reagieren müssen die Onlineportale auch auf die Veränderung der Algorithmen bei Facebook, wenn zum Beispiel dem Anwender nicht mehr die neueste Nachricht, sondern das meist Kommentierte präsentiert wird. Es tauchen Fragen auf, ob das Kommunikationssystem WhatsApp auch als Nachrichtendistribution genutzt werden kann wie es das Schweizer Fernsehen testet. Oder ob wie bei der BBC der Einsatz von Instagram für 15‑Sekunden‑Nachrichtenvideos modellhaft ist. Diese Programme haben Millionen Menschen auf ihren mobilen Endgeräten installiert. Dort will man sie erreichen.
Der Trend geht zur dezentralen und personalisierten Nutzung
Die Redaktionen brauchen Trendscouts und sollten ihnen zuhören. Sie müssen diskutieren über Thesen wie "App frisst Web". Denn die mobile Internetnutzung überholt gerade die stationäre. Das ist die eigentliche Herausforderung. Der Trend geht zur dezentralen und personalisierten Nutzung.
Medien, die konkurrenzfähig bleiben wollen, werden zu hundert Prozent crossmedial arbeiten. Das schließt die Entwicklung von Apps nicht nur mit ein, sondern setzt sie sogar an den Anfang crossmedialer Strategien. Journalistische Portale müssen neben Bezahlsystemen auch Anzeigenkonzepte fürs Netz entwickeln. Eine Alternative sind Stiftungsmodelle, auf dieser Grundlage arbeitet der britische "Guardian" und nutzt diesen Spielraum beispielhaft für innovativen digitalen Journalismus.
Neugierige und experimentierfreudige Blicke wandern seit zwei Jahrzehnten nach Nordamerika und Großbritannien, ein Grund für die vielen Anglizismen in der Branche. Die angelsächsischen Kollegen und Kolleginnen sind oft Vorreiter im Netz. Sie sind nur einen Klick entfernt im World Wide Web. Konkurrierende Anbieter sind dort nicht mehr nur die "üblichen Verdächtigen", also die längst bekannten Player im Medienbusiness.
Schauen heißt aber nicht kopieren und es genauso machen, sondern klare Entscheidungen treffen, wie hintergründiger und einordnender Journalismus bei möglichst Vielen auf Interesse stößt. 20 Jahre Onlinejournalismus haben die Medien verändert und verändern sie noch. Die gesellschaftliche Funktion der Presse als vierte Gewalt ist dabei notwendiger denn je, unterstützt durch den zielgerichteten Dialog mit der Community. Denn es ist eine Illusion, die Welt verstehen und erklären zu können, wenn man lediglich Infohäppchen, Tweets und Posts hinterher rennt. Das gilt für uns alle als digitale Weltbürger.




