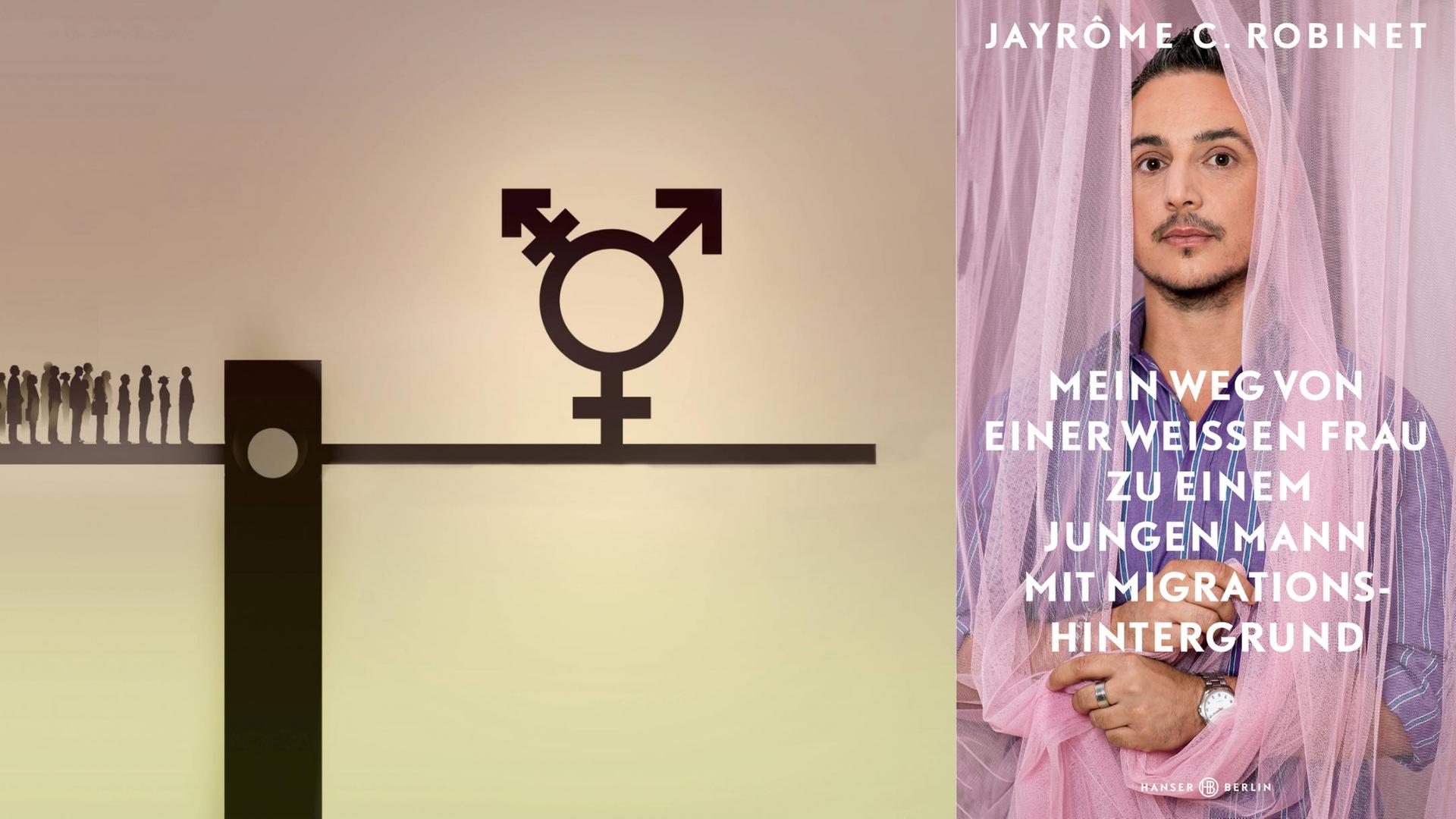Der Wochenendausflug auf Usedom mündet im Debakel. Während die Kinder schlafen, sitzen die lose befreundeten Eltern im Wohnzimmer des Ferienhauses und schlittern in den Affront. Von Brennpunktschulen mit hohem Ausländeranteil ist die Rede, davon dass niemand am Tisch seine Kinder dort hinschicken wolle. Während am Rotwein genippt wird, fallen die obligatorischen Vokabeln: Multikulti, Migrationshintergrund, Herkunft. Und bitte, auch sie, Özlem, würde sich doch beschweren, wenn ihre Tochter Emilia so einer Schule zugewiesen worden wäre. Plötzlich liegt alles auf dem Tisch, unschön und unverstellt: Vorurteile über Räume, die man nie betreten hat, Pauschalurteile über Minoritäten, die man nicht kennt, sowie Stempel und Schubladen für Personen wie Özlem, die offensichtlich nie so richtig dazugehören können. Die Fronten sind gezogen, da hilft der anschließend herumgereichte Sanddornschnaps auch nicht mehr.
Alltagsrassismus an der Tagesordnung
In ihrem Roman "Ich bin Özlem" widmet sich Dilek Güngör einem Thema, das aktueller nicht sein könnte. In der Biographie ihrer Figur verhandelt sie Fragen nach Alltagsrassismus, kultureller Zugehörigkeit und der Penetranz, mit der jeder und jede mit Identitätsetiketten zugekleistert wird. Der Usedomer Streit fördert dabei jene Erfahrungswerte und Gedankengänge zutage, die Güngörs Ich-Erzählerin seit ihrer Kindheit in Schwaben begleiten. Bereits in jungen Jahren ist ihr Alltag vom Gespenst einer Differenz geprägt, die beim Intimsten einsetzt, das einem Menschen eigen ist, beim Namen:
"In Wirklichkeit hieß Jack nicht Jack, er hieß Jochen, aber in Englisch hatten wir alle englische Namen. Stefan hieß Steve und Eva hieß Eve, auf Özlem passte nichts, also nahm ich Nancy, das hatte die Englischlehrerin vorgeschlagen."
Alles wird zum Verweis auf Özlems "türkische Wurzeln"
Dieses Muster begleitet Özlem durch Jugend und Erwachsenenleben. Alles kann zum Verweis auf ihre sogenannten türkischen Wurzeln werden, auch wenn sie die Türkei nur aus Urlauben und Familienerzählungen kennt. Ihr Alltag ist niemals unbescholten, jede Lappalie kann zur negativen Offenbarung werden. Als Kind bemerkt sie, dass die Familie ihrer damaligen Freundin Stephanie gefaltete Servietten zum Essen benutzt, bei ihr zu Hause gibt es nur Küchenrolle. In der Straßenbahn verdeckt die erwachsene Özlem, eine ausgebildete Sprachlehrerin, ihr Deutschbuch – schließlich könnte jemand annehmen, sie lerne die Sprache als gerade erst Hinzugezogene. Zugleich meidet Özlem türkische Supermärkte, um der penetranten Neugierde der Inhaber und Verkäuferinnen zu entgehen. Deren Nachfragen empfindet sie als Kumpanei und Vereinnahmung.
"Hört das denn nie auf? Wenn ich mit den Kindern zu meinen Eltern reise, fürchte ich mich jedes Mal vor dem Moment, in dem der türkische Fahrer fragen könnte, wohin es gehe und die Kinder antworten zu nene und dede. Denn dann muss ich mich zu erkennen geben, mich mit dieser Person verbrüdern, eine Nähe schaffen, die ich nicht möchte. Die Fragen gleichen sich: 'Woher aus der Türkei bist du? Bist du hier geboren? War das dein Mann? Ist er Deutscher?' Ich will solche Fragen nicht beantworten müssen und tue es doch lammfromm und ergeben, als hätte ich keine andere Wahl."
Zu jedem Essen Börek mit Spinat
Der doppelte Fokus ist die Stärke von Güngörs Roman. Die Autorin zeichnet ihre Hauptfigur als einen Kultur-Automaten, der zwanghaft den immergleichen Service runterrattert: Özlem bedient Schablonen, die ihr einerseits die türkischstämmige Familie, andererseits ihr Umfeld in Deutschland anlegen. Zugleich gesteht Güngör ihrer Hauptfigur eine lebensnahe Widersprüchlichkeit zu: Sie wird nicht ausschließlich als das Opfer ihrer sozialen Umwelt portraitiert, dessen Leid einem deterministischen Weltbild entspringt. Nein, so sehr Özlem das identitäre Raster verabscheut, so sehr arbeitet sie ihm immer wieder zu, bringt beispielsweise zu jedem Essen bei Freunden Börek mit Spinat mit, als sei das ihre und nur ihre Aufgabe. Der identitären Obsession kann sich die Figur nicht entledigen – sie ist ihr längst ins Blut übergegangen. Mit ihrem zweiten Roman erzählt Dilek Güngör keine simplizistische Emanzipationsgeschichte, die allzu einfach von der Unterdrückung zur Selbstbestimmung führt. Im Gegenteil, an zahlreichen Stellen weist der Text auf die Hilflosigkeit seiner Figuren hin:
"'Wie soll man denn fragen, wenn man wissen will, woher jemand ist?', hat Philipp einmal gefragt. Ich weiß es nicht, meistens verkneife ich mir die Frage und warte darauf, dass sich mir der Akzent, der ungewöhnliche Name, die Hautfarbe einer Person nach und nach erschließen."
Analytische Narration, keine atmosphärische
Dabei bleibt die eigentliche Erzählung mit ihrer Handlung und ihren Figuren auf den gut 150 Seiten einigermaßen grob. Narrative Elemente dienen der Autorin vorwiegend als Sprungfedern, die in regelmäßigen Abständen angezogen werden, um den nächsten reflexiven Schub vorzubereiten. Deshalb sind die Pointen auch nicht szenischer, stilistischer oder atmosphärischer, sondern analytischer Art. Das gestalterische Repertoire, das der Roman als literarische Gattung bereitstellt, wird kaum ausgeschöpft. Hier ist nahezu alles Dialog, Kommentar und soziologische Abwägung. So vermisst man sie doch recht schnell, die ästhetischen Evidenzen, die einen Text flimmern und schwingen lassen, das eine unerwartete Bild, das alles sprengt, die eine Auslassung, die mehr preisgibt als tausend Worte, den Wirbel der Fiktion, bei dem sich alles auf den Kopf stellt.
Resignierter Rückzug ins Private
Güngörs Roman endet weder mit einem Manifest für mehr identitätspolitisches Engagement noch wirft sich die Hauptfigur allen in einer konzilianten Umarmung entgegen. So einfach ist es nicht, so plakativ beziehungsweise naiv will dieser Zwitter aus Roman und Essay nicht sein. Nachdem wir uns durch die oftmals dogmatische Identitätsarena gekämpft und wenig mehr als Frontlinien und verbrannte Erde vorgefunden haben, tritt Özlem einen so folgerichtigen wie folgenschweren Rückzug an:
"An die freie Wand neben dem Tisch habe ich Bilder aus der Zeitung geklebt, erst nur eine Aufnahme aus dem Film 'Stein der Geduld', es zeigt die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani, wie sie aus ihrem Haus kommt und den Blick zum Himmel hebt. Ihre Schönheit hat es mir angetan, aber mehr noch das niedrige Haus, eher grau als weiß, und die mintgrünen Fensterrahmen. Meine Großeltern haben in so einem Haus gewohnt, die Fenster im selben Grün, wie Zahnpasta so hell. Später kam ein historisches Foto aus Sarajevo dazu, ein Portrait von Dora Maar, kleine Kunstdrucke aus dem Museumsshop, dazwischen eine Zeichnung von Emilia und zwei, drei Bilder, die ich gemalt habe und gerne mag."
Wir werden Zeuge einer Inventarisierung des Privaten. Abseits des öffentlichen Lärms stellt Özlem sich ein individuelles Koordinatensystem zusammen – mit eigenen Vorbildern und familiären Glücksmomenten. Der Roman endet in Resignation und formuliert hierüber eine grundsätzliche Kritik an der identitätspolitischen Debatte, die oftmals lautstark auf der Stelle tritt, ohne die Beteiligten in ihr Recht zu setzen. Die Aussprachen nach dem Streit auf Usedom, die Özlem mit den Freunden führte, haben keine endgültige Klärung gebracht. Wieder hängen Vorwürfe wie Gewitterwolken in der Luft: pauschal, übersensibel, selbstgerecht. Das Gespenst der Differenz lässt sich nicht abwimmeln. Seinem Spuk – darauf läuft "Ich bin Özlem" von Dilek Güngor hinaus – begegnet man am besten mit der nüchternen Benennung erfahrener Ungerechtigkeit und der scheu gehegten Hoffnung, im Allerkleinsten die ersten Bausteine eines anderen Zusammenlebens zu legen.
Dilek Güngör: "Ich bin Özlem"
Verbrecher Verlag, Berlin, 160 Seiten, 19 Euro
Verbrecher Verlag, Berlin, 160 Seiten, 19 Euro