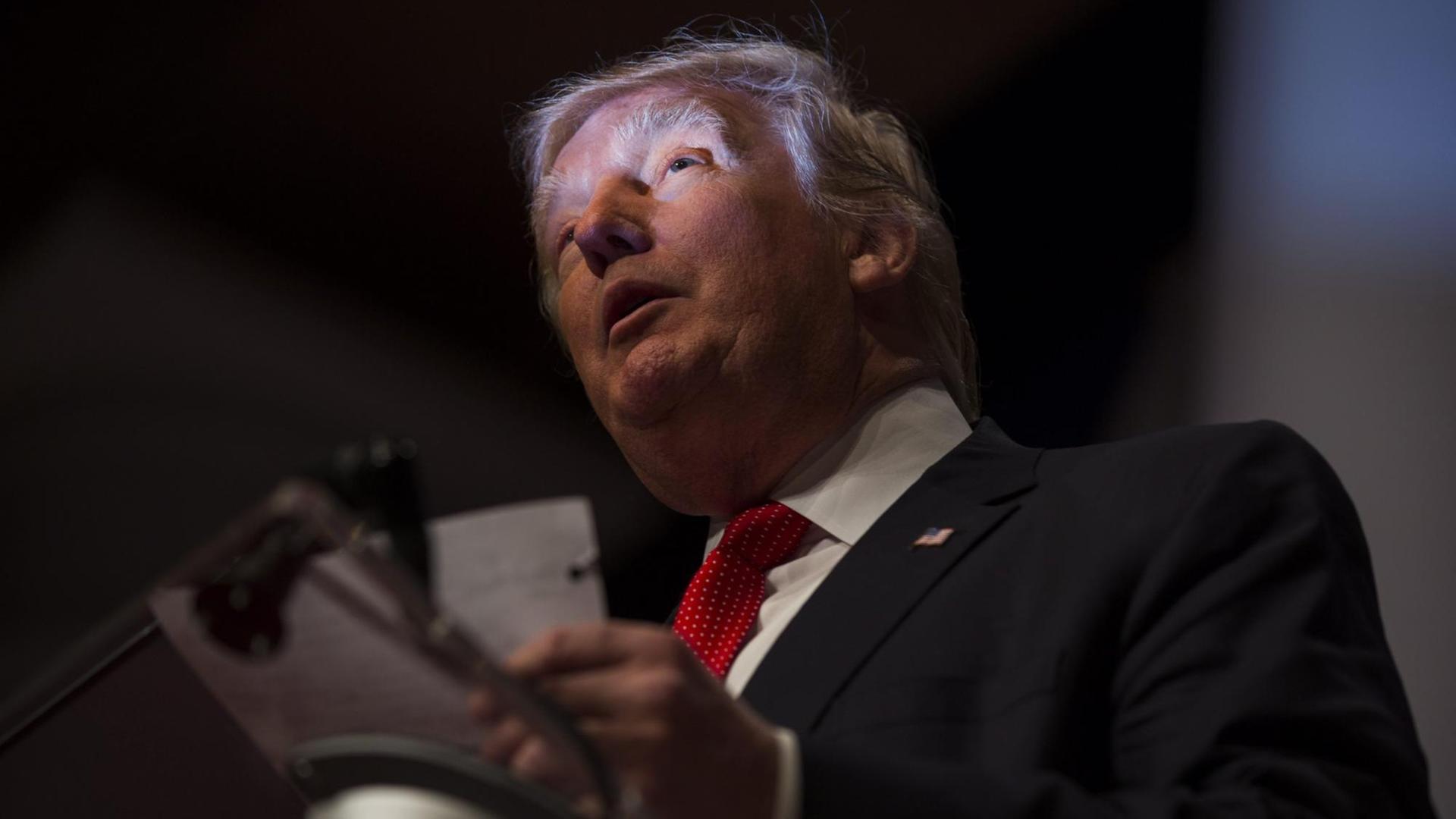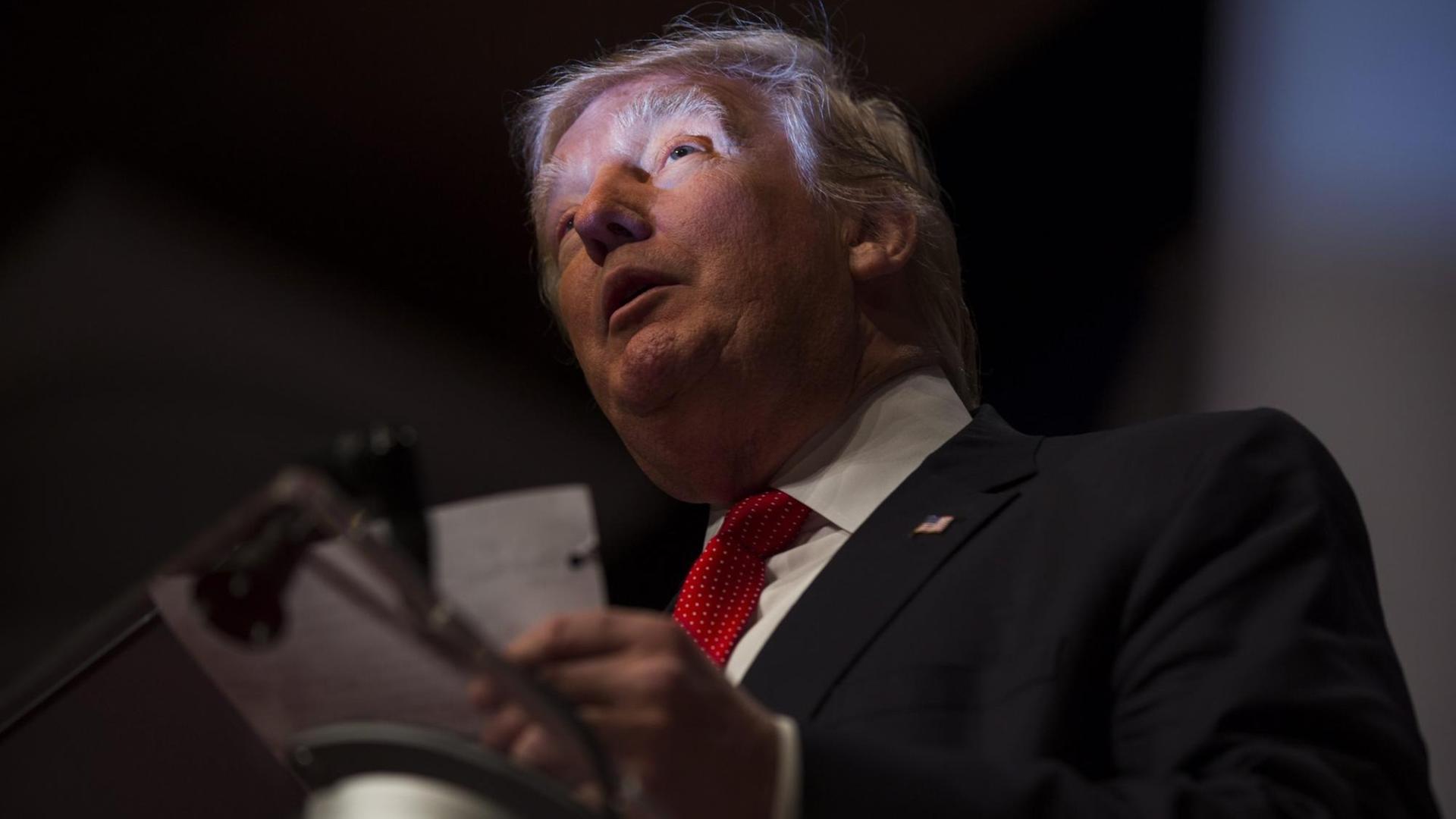
Zuspruch bekommen die Muslime von unterschiedlicher Seite. Nicht nur vom Boxer Muhammad Ali, der selbst Muslim ist und die Politik aufrief, Verständnis für den Islam zu wecken. Auch Mark Zuckerberg, wie Donald Trump Milliardär und außerdem Chef von Facebook, sagte, er könne sich nur vorstellen, welche Angst Muslime derzeit davor empfänden, "für die Taten anderer verfolgt zu werden". Seit dem Terror von Paris, und mehr noch seit den 14 von einem islamistischen Paar ermordeten Menschen in San Bernardino im US-Bundesstaat Kalifornien, hat die ohnehin scharfe Rhetorik in Sachen Migration noch einmal zugelegt. So sehr, dass Präsident Obama sich veranlasst sah, vor Bigotterie zu warnen - in Anspielung auf Trump, aber ohne ihn zu erwähnen.
2,8 Millionen Muslime in der USA
Trump, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden will, wetterte bis vor kurzem noch vor allem gegen illegale Einwanderer aus Mexiko. Jetzt geht es um die Muslime im Land, und die, glaubt man ihren Lobbyorganisationen, haben zunehmend Grund dazu, Angst zu haben. Der Sprecher des Rats für amerikanisch-islamische Beziehungen (CAIR), Ibrahim Hooper, ein aus Kanada stammender Konvertit, sagt, es sei so schlimm wie seit den Tagen nach dem 11. September 2001 nicht mehr. Zu den von CAIR aufgelisteten Vorkommnissen der vergangenen Wochen gehört ein vor einer Moschee in Philadelphia abgelegter Schweinekopf, Beschimpfungen auf offener Straße, tätliche Angriffe und Todesdrohungen (eine detaillierte Liste kann man in der LA Times nachlesen.). "Es ist wirklich beängstigend", sagt Hooper.
Den Beginn der Einwanderung von Muslimen in die USA datieren Wissenschaftler in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dauerte es, bis ihre Anzahl merklich zu wachsen begann. Heute leben etwa 2,8 Millionen Muslime in den USA (zum Vergleich: Im deutlich kleineren Deutschland sind es mehr als 4,2 Millionen.).
Muslime gelten als gut integriert
In der Einwanderergesellschaft der Vereinigten Staaten sind Araber und Muslime damit ein relativ junges Phänomen. Sie sind sozusagen "the new kids on the block", also die Neuen in der Nachbarschaft. Regionale Schwerpunkte sind Dearborn bei Detroit im Bundesstaat Michigan, wo die größte Moschee der USA steht, und Paterson in New Jersey, das oft auch als "Little Ramallah" bezeichnet wird. Ansonsten sind Muslime über die städtischen Zentren verteilt. "Das ist anders als in Europa, wo sie oft in Vorstädten konzentriert sind, etwa in den Banlieues von Paris", erklärt Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies. Auch diese Verteilung trägt wohl dazu bei, dass Muslime - die dort keineswegs hauptsächlich Araber sind - in den USA als recht gut integriert gelten. Laut Thunert verfügen sie häufiger über Collegeabschlüsse als weiße Amerikaner und sind in höheren Einkommensgruppen entsprechend ihrer Zahl vertreten.
Ein weiteres Beispiel für den Stand der Integration? Tanzila "Taz" Ahmed und Zahra Noorbakhsh, die zusammen den Podcast "Good Muslim, Bad Muslim" betreiben. Darin schimpfen sie auf den so genannten Islamischen Staat, machen aber auch zum Thema, dass Muslime ständig aufgefordert werden, sich von Terroranschlägen zu distanzieren. Dabei lachen sie sich krumm darüber, dass in dem englischen Wort "condemnation" für "Verurteilung" phonetisch ein Kondom enthalten ist. Albern, aber definitiv integriert.
Als Sündenböcke herhalten
Muslime sind die jüngste Gruppe, die amerikanischen Nativismus zu spüren bekommt, also die Abschottung gegen als fremd empfundene Einflüsse. Im 19. Jahrhundert waren es die Katholiken. Im Zweiten Weltkrieg die Bürger japanischer Abstammung, die aus Angst vor deren unterstellter Loyalität zu Tokio interniert wurden. Zuletzt hatten Menschen aus dem Nachbarland Mexiko das schlechteste Ansehen. "Nach der Gräueltat von Paris", so schrieb kürzlich das britische Magazin The Economist, "haben in den USA die Muslime die viel verleumdeten Mexikaner als Objekt des Zorns abgelöst." Der Economist macht drei Umstände aus, die für solche inneren Abschottungen verantwortlich sind: ökonomische Probleme, nationale Sicherheit und religiöses Unbehagen. "Diese drei Neurosen sind in der heutigen Post-Rezessions-Panik über Muslime und den Islamischen Staat brandgefährlich verbunden." In unserem Interview sagt Professor Christian Lammert von der FU Berlin: "Die Muslime müssen momentan als Sündenböcke herhalten, die von anderen Problemen ablenken sollen."
Trump ist der schärfste, aber nicht der einzige republikanische Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur, der die amerikanischen Muslime als Wahlkampfthema entdeckt hat. "Seit 20 Jahren habe ich solche Intoleranz und solchen Hass von politischen Führern in dieser Gesellschaft nicht gehört", sagte der CAIR-Vorsitzende Nihad Awad dem Guardian. Es stellt sich die Frage, was dies mit den Bürgern macht.

Im Sommer 2011 beschrieb das Pew Research Center nach einer Umfrage unter muslimischen Amerikanern deren Gemütszustand als "deutlich überwiegend zufrieden" mit ihren Lebensumständen. Trotz der Klagen über Misstrauen seitens Sicherheitsbehörden oder Mitbürgern sei ihre Sicht auf die USA, zehn Jahre nach 9/11, nicht ernüchtert. Anzeichen für zunehmenden Extremismus sah die Studie ebenfalls nicht. Und nun? Haben die jüngsten Attacken auf muslimische Identität in den USA im Kielwasser von Terror und Wahlkampf - verbal wie handgreiflich, im politischen Resonanzraum wie auf der Straße - Auswirkungen darauf, wie sehr Muslime sich in den Vereinigten Staaten noch als dazugehörig fühlen können?
Trump radikalisiert die Muslime
"Rechte gewalttätige Extremisten könnten sich von den schockierenden Äußerungen von Politikern ermutigt fühlen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen", sagt der amerikanische Politikwissenschaftler Muqtedar Khan. Die Xenophobie in der amerikanischen Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahren verstärkt. Dieses Mal, mit Trump, "ist es die totale Eskalation", sagt Khan am Telefon in Delaware. Und auch auf Seiten der Muslime sieht er eine Gefahr: die der Radikalisierung, wenn sie sich in den USA zurückgestoßen fühlen. "Wenn Sie mich fragen, wer der gefährlichste Imam ist, antworte ich: Das ist Donald Trump. Er ist derjenige, der Muslime am meisten radikalisiert."
"Der Islam war in den USA noch nie eine besonders populäre Religion", sagt der Heidelberger Politikwissenschaftler Martin Thunert. Die latente Vermutung, die Glaubenssätze des Islam könnten unvereinbar mit den amerikanischen Werten sein, sei weit verbreitet. Thunert weist aber auch darauf hin, dass in den Vereinigten Staaten nach wie vor mehr Hassverbrechen gegen Homosexuelle und Juden als gegen Muslime registriert werden.
Auf Twitter und Facebook überschlägt sich die xenophobe Begeisterung für Trump derzeit (ebenso aber die Kritik an ihm). Verstörenderweise berufen sich dort viele Unterstützer Trumps als Präzedenzfall tatsächlich auf die Internierung der japanischstämmigen Amerikaner, ein gewiss eher dunkles Kapitel amerikanischer Geschichte. (Trump selbst tut das nicht, jedenfalls nicht direkt. Er macht geltend, seine Ideen seien nicht schlimmer als die damals von Präsident Roosevelt verfügte Unterbringung von 120.000 Menschen in Lagern kurz nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour.) Thunert: "Die sozialen Medien scheinen gut geeignet zu sein, um schlichte Botschaften zu verbreiten." Trump versuche offensichtlich, die Zustimmung, die er dort erfahre, am Kochen zu halten. Mindestens bis zur ersten Vorwahl in Iowa im Januar.
Weder Thunert noch Khan glauben, dass Trump eine reelle Chance hat, republikanischer Kandidat zu werden, geschweige denn Präsident. Aber die Sorge darüber, was er anrichten kann, während er es versucht, ist groß.
Sumbul Ali-Karamali, die in mehreren Büchern versucht hat, ihren Landsleuten den Islam zu erklären ("The Muslim Next Door"), schreibt per E-Mail aus Kalifornien: "Ich fühle mich äußerst frustriert. Trumps Äußerungen beschädigen nicht nur die amerikanischen Muslime, sie beschädigen die gesamte amerikanische Gesellschaft." Muslime, so Sumbul, tragen viel zur Gesellschaft bei, sind gut ausgebildet und verdienen gut. Trumps verbale Angriffe? Lächerlich, sagt sie. Und schließt mit versöhnlichen Worten: Trotz der Islamophobie gebe es viele, die sich für ein gegenseitiges Verständnis und für Pluralismus einsetzten.
Die Musikjournalistin Lorraine Ali, eine preisgekrönte irakischstämmige Autorin, die für die New York Times, für den Rolling Stone und für Newsweek schreibt, fasste per Twitter ihre Gefühlslage in der Causa Trump so zusammen: "Ich habe bisher dazu geschwiegen, weil es so schmerzhaft ist. Aber ich habe mich nie so gefühlt, als wären mein Glaube und mein Land im Konflikt. Und das tue ich immer noch nicht."