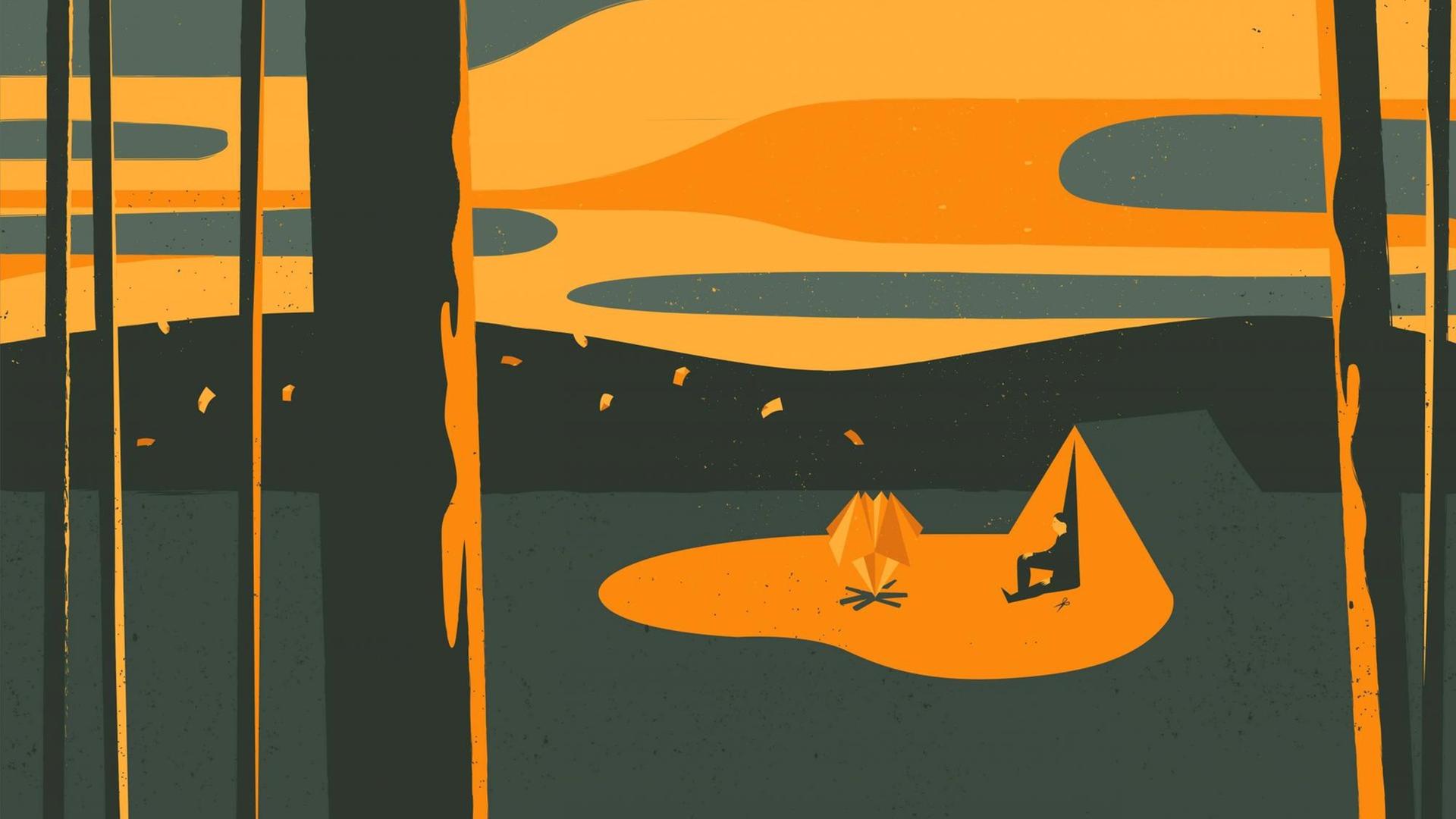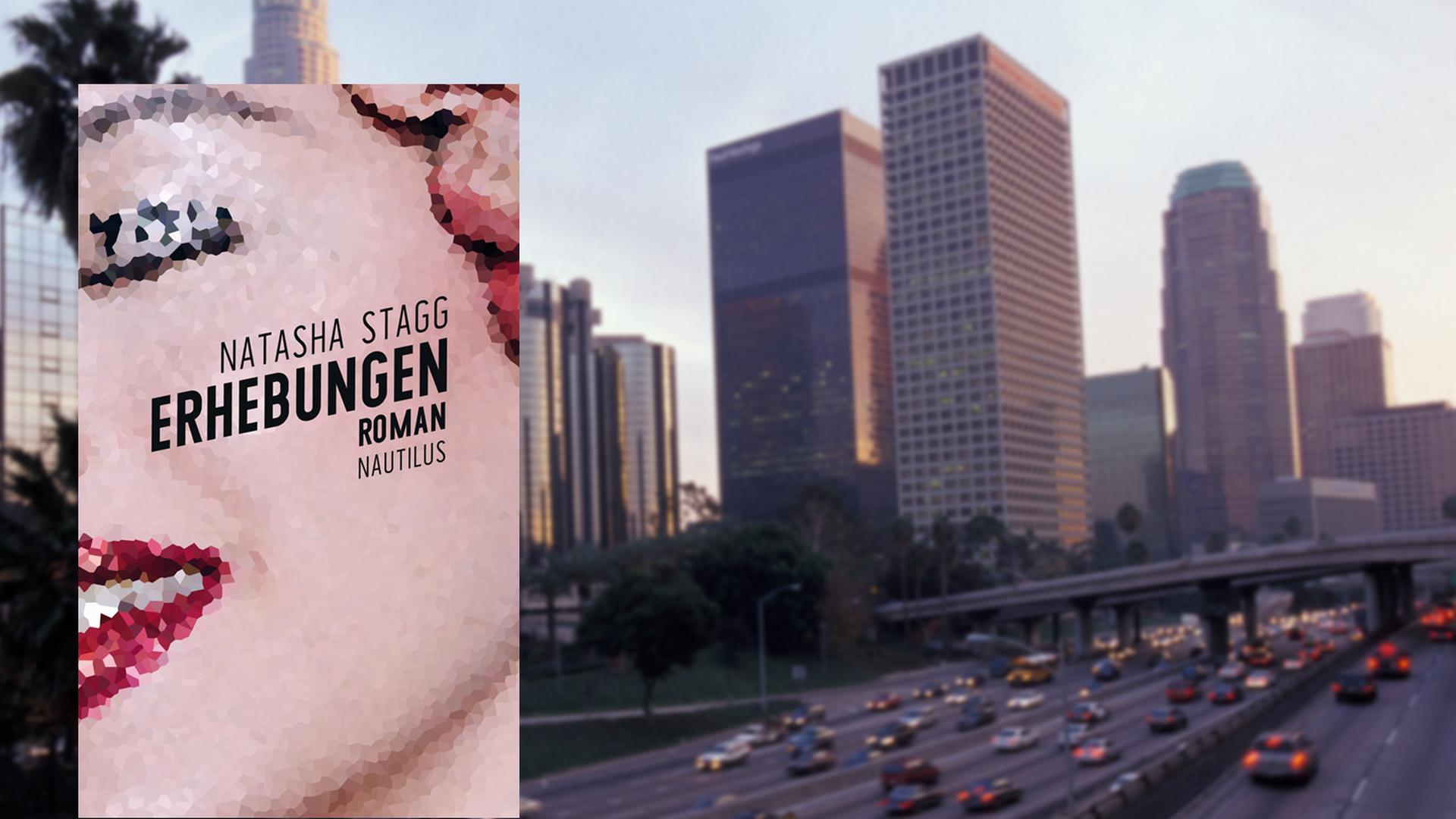"Mein ganzes Leben war ich einsam, überall. In Kneipen, im Auto, auf der Straße, in Geschäften, überall. Es gibt kein Entrinnen vor der Einsamkeit. Ich bin Gottes einsamster Mann."
Die Hauptfigur in Martin Scorseses Film Taxi Driver ist ein drastisches Beispiel für einen Zustand, der das gesamte Dasein aushöhlen kann und die Umwelt bemerkt es nicht. Denn Einsamkeit ist ein Gefühl ohne Gesicht. Man kann niemandem seine Einsamkeit ansehen. Und anders als Freude, Spaß oder Liebe ist sie unteilbar, trifft immer nur den einen, den Einsamen. Das macht sie auch für die Wissenschaft so unbequem. Die Psychologie hat einen recht allgemeinen Zugriff gefunden, sagt Susanne Bücker von der Ruhr-Universität Bochum:
"Wir definieren Einsamkeit als die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den tatsächlichen und den gewünschten sozialen Beziehungen. Das meint sowohl die Tiefe oder Intimität einer Beziehung als auch die Anzahl der Freunde oder Sozialkontakte, die man sich wünscht."
So betrachtet ist Einsamkeit eine tiefe Sehnsucht, die sich körperlich und seelisch für jeden Menschen anders anfühlt und in anderen Situationen spürbar wird. Man kann sehr alleine sein und sich nicht einsam fühlen, aber ebenso umgeben von Menschen tiefe Einsamkeit empfinden. Die Neurobiologie meint in bildgebenden Verfahren, Einsamkeit im Gehirn dort zu erkennen wo auch der körperliche Schmerz sitzt. Psychologen sprechen deshalb von einem sozialen Schmerz.
"Das Schwinden der Gemeinschaft in den letzten Jahrzehnten ist still und trügerisch vonstattengegangen.(…) Geschwächtes soziales Kapital manifestiert sich in den Dingen, die nahezu unbemerkt verschwinden – Partys mit der Nachbarschaft und Treffen mit Freunden, die bedenkenlose Freundlichkeit von Fremden, das geteilte Streben nach dem Gemeinwohl anstelle einer einsamen Jagd nach privaten Gütern."
Ein Gefühl, das krank macht
Das Bild, das in diesem Zitat der US-amerikanische Politologe und Soziologe Robert Putnam zeichnet, ist eine Standarderzählung der neueren Sozialwissenschaften: Wir durchlaufen eine unumkehrbar scheinende Untergrabung der Gemeinschaft. Der Individualismus durchdringt jede Lebensfaser und macht uns zu einsamen Hedonisten in einer Gesellschaft der Singularitäten. Stimmt diese Erzählung? Ist die Heimsuchung des Zeitgenossen die Einsamkeit? Der Soziologe Janosch Schobin stellt fest:
"Die Statistiken, die wir haben, zeigen eher eine Abnahme von Einsamkeit, zumindest in Deutschland."
Der Wissenschaftler von der Universität Kassel forscht seit vielen Jahren über das Thema. Eine neue Epidemie sieht er nicht.
"Einsamkeit ist recht stabil geblieben über die letzten 40 Jahre, wenn nicht sogar ein kleines bisschen zurückgegangen."
Bestätigt die Psychologin der Ruhr-Uni-Bochum. Sie hat an einer großen Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums mitgearbeitet, die gerade abgeschlossen wurde. Auch wenn es keinen Anstieg gebe, sei es notwendig, dem "stillen Unglück" der Menschen auf die Spur zu kommen, meint die junge Wissenschaftlerin:
"Es ist ein Thema, von dem man weiß, dass es gravierende Konsequenzen hat beispielsweise für die mentale oder physische Gesundheit und deshalb halte ich es auch durchaus für wichtig, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und als gesellschaftliche Herausforderung unserer Zeit anzuerkennen."
Vor dem Hintergrund seiner eigenen biografischen Studien unterscheidet der Soziologe Schobin die Einsamkeit noch einmal von dem Zustand der sozialen Isolation und der Vereinsamung.
"Soziale Isolation ist eine Zustandsbeschreibung. Leute haben wenig Kontakt zu Personen zu denen sie eine positive affektive Bindung haben. Also notwendig ist, es müssen schon gute Bindungen sein und die müssen fehlen. Das andere ist Einsamkeitsempfindungen, die können Menschen ohne soziale Isolation haben, einfach weil ihnen etwas fehlt, was nicht da ist."
Im Jugendalter beispielsweise eine unerreichbare Liebe oder im späteren Alter der Verlust des Lebenspartners.
"Davon ist noch einmal zu unterscheiden aus meiner Sicht Vereinsamung. Das ist ein Prozess, der kann mit sozialer Isolation oder Einsamkeitsempfindungen anfangen. Was man aber aus biografischen Studien kennt ist, dass es andersherum läuft. Leute fühlen sich einsam und fangen an sich zurück zu ziehen, weil die Bindungen in denen sie sich befinden für sie nicht Hinreichen oder Makel aufzeigen. Und dieser kontinuierliche Prozess, in dem sich soziale Isolation und Einsamkeitsempfindungen gegenseitig verstärken, das nennen wir Vereinsamung."
Oft klagen Einsame nicht einmal über ihren Zustand, entweder aus Scham oder aus Mangel an Zuhörern. Einsamkeit gilt allgemein eher als Makel, als soziales Ungenügen. Dabei ist es vermutlich auch ein Zeichen von gesellschaftlichem Versagen.
"Alle Gefühle haben eine subjektive Komponente. Was für Soziologen wichtig ist, dass es um geäußerte Gefühle geht.// Wenn man sich fragt, was ist eigentlich die soziale Funktion von dem Zeigen von Einsamkeit, dann ist es natürlich, um zum Ausdruck zu bringen, ich brauche mehr soziale Unterstützung, ich brauche mehr Nähe."
Daneben aber gab und gibt es auch die Vorstellung, dass wir Einsamkeit brauchen, um als Mensch zu wachsen. So schrieb der Dichter Rainer Maria Rilke:
Ein Topos der Literatur
"Lieben Sie Ihre Einsamkeit, und tragen Sie den Schmerz, den sie Ihnen verursacht, mit schön klingender Klage."
Für die Psychologie ein unüberwindbarer Widerspruch.
"Wir werden häufig gefragt, naja, aber wo sind die positiven Seiten der Einsamkeit? Aus unserer Sicht gibt es die nicht. Einsamkeit ist tatsächlich etwas gravierend Negatives, zumindest, wenn es chronisch anhält. Klassisch wird Einsamkeit auch als ein Warnsignal unseres Körpers verstanden, uns zu motivieren und mit unseren sozialen Netzwerken auseinander zu setzen und Anschluss zu suchen."
"Was nun die Menschen gesellig macht, ist ihre Unfähigkeit, die Einsamkeit und in dieser sich selbst zu ertragen." (Arthur Schopenhauer)
Einsamkeit ist in Gedanken wie im echten Leben zumeist ein schmerzhaftes Gefühl, etwas fehlt und zwar elementar. Als solches ist sie auch ein zentraler Topos der Literatur:
"Weil jedes Buch zunächst mal eine Art Selbstgespräch ist – und wenn man über Einsamkeit nachdenken möchte, ist das ein schönes Medium."
Sagt die Literaturwissenschaftlerin und österreichische Autorin Friederike Gösweiner. Und Bücher könnten durchaus Gesellschaft leisten. Ein Leser sei vielleicht allein, aber selten einsam.
"Bei gelingendem Lesen, also wenn man sich wirklich schön in eine Geschichte vertiefen kann und sich selbst dabei vergisst, auch seine Schwächen vergisst, seine Probleme vergisst, hat es immer auch tröstende Wirkung und auch eine Wirkung, dass ich meine eigene Einsamkeit einfach vergesse."
Lesen ist eine nach innen gerichtete Kommunikation, meint die Schriftstellerin. Man begegnet in den Büchern sich selbst und trifft Fremde. Viele Schriftsteller der Weltliteratur thematisieren dabei ganz konkret das Thema Einsamkeit, insofern sie menschliche Beziehungen darstellen und von ihren Gefühlen in der Welt zu sein erzählen.
"Ich fühle mich so grässlich einsam, dass ich an Selbstmord gedacht habe. Was mich zurückgehalten hat, ist die Vorstellung, dass niemand über meinen Tod erschüttert wäre, dass ich im Tod noch einsamer wäre als im Leben." (Jean Paul Sartre – Der Ekel)
"Was Literatur glaube ich so gut kann, wie sonst keine Kunst ist Gedanken zu formulieren, nachzudenken über den Menschen und sein Empfinden in dieser Welt. Da spielt Einsamkeit immer eine ganz zentrale Rolle, weil es ja trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse noch nicht geklärt ist, warum wir sind und warum es uns geht, wie es uns geht. Dazu dient die Literatur, darüber nachzudenken."
Einsamkeit gilt seit langem auch als ein besonderer Resonanzboden, der anders widerhallt als direkte soziale Kommunikation. Das Nachdenken in und über Einsamkeit jedenfalls pendelt seit jeher zwischen Isolation und Inspiration – schmerzhaft empfundener Lücke und Raum für Neues.
Bietet Freiraum für Gedanken
"Das Kloster ist der Ort, wo ursprünglich Einsiedler dieses einsame Leben führen. Tatsächlich geht es bis heute darum, dass man für sich einsam in einer Gruppe lebt, das ist eigentlich der Gedanke des Klosters, das wiederum im Wort Claustrum eben diesen abgeschlossenen, gegenüber der Welt abgesicherten Raum beschreibt. Da ist man drinnen und gleichzeitig aus der Welt weg. Das beinhaltet schon wesentlich die Grundmomente der Einsamkeit."
Placidus Heider ist Theologe, Philosoph und ehemaliger Benediktiner Mönch aus Süddeutschland. Entsprechend ist er in Theorie und Praxis ein Experte in Einsamkeitserfahrungen. Als junger Mann, fast noch Jugendlicher, entschied er sich für das Leben in der klösterlichen Stille und Abgeschiedenheit. Jahrelang hat er mehr oder weniger schweigend mit etwa 50 Mönchen zusammengelebt. Eine Herausforderung, die ihn an die Grenze des erträglichen geführt hat, sagt er heute, diesseits der Klostermauern.
"Sie müssen sich das mal vorstellen am Abend im Refektorium, im Speisesaal, im Hufeisen sitzen sie da alle die Mönche, die Kapuzen ins Gesicht gezogen, schweigend und löffeln da ihre Suppe in sich hinein. Der Mönch der da im Kloster lebt ist eigentlich der, der für sich alleine lebt, der meint in diesem sich zurückziehen einen Platz zu finden, an dem man sich selber verändert, dass man vielleicht ganz neue Zugänge zur Welt, zu sich selber und vielleicht auch zu dem, was diese Welt begründet und zusammenhält findet. Das ist das eigentliche Ziel."
Die Einsamkeit ist dabei das Instrument, das die Sicht auf eine tiefere Schicht des Lebens freigeben soll. Ohne Ablenkung durch andere und anderes als die Gedanken. Als Askese und Meditation kennen das viele Religionen und spirituelle Praktiken.
"Da ist eine ganz ursprüngliche Berührung nach diesem Streben nach Erkenntnis aber nicht als Selbstzweck sondern als Öffnung für etwas. Man lässt die Welt nicht einfach hinter sich zurück, um die Welt zu verlassen, sondern man lässt einen bestimmten Umgang mit der Welt hinter sich zurück, um zur Welt wieder zurück zu kehren."
Der Mönch kehrte tatsächlich zurück in die Welt vor den Klostermauern, wo er allerdings erneut die Erfahrung großer Einsamkeit machte. Denn zunächst passte so gut wie nichts von seinem gewohnten Leben in Klausur und Zelle auf das 21. Jahrhundert.
"Ich habe damals wirklich gemerkt, dass ich da irgendwo ganz aus der Welt herausgefallen bin. Und dass ich mich sehr schwer damit getan habe, das was da in mir vorgegangen ist, anderen zu vermitteln."
Eine Frage der Kultur
Die Erfahrung ganz anders zu sein, fremd, kann einsam machen. Heimweh ist dafür ein gängiger Begriff. In ihm steckt der Verlust des Vertrauten. Und fehlendes Vertrauen untergräbt oft die spontane Direktheit in unseren Beziehungen. Relativ sicher weiß man, dass der kulturelle und soziale Kontext von Einsamkeit dabei eine wichtige Rolle spielt.
"Man kann sehr deutliche Unterschiede hinsichtlich der kulturellen Bewertung von Einsamkeit finden. Das sieht man, wenn man lateinamerikanische Kulturen mit Nordeuropäischen wie unseren vergleicht."
Das hat der junge Soziologe aus Kassel getan. Er hat in Chile, New York und Deutschland einsame Menschen aufgesucht und in Interviews ihren Umgang und den Kontext ihrer Vereinsamung verglichen. Der Grund der Einsamkeit war jeweils der Tod des Lebenspartners.
"Nach der Verwitwung steht eine Trauerphase an, die ist normalerweise auch sozial eingehegt, die ist zeitlich begrenzt."
Die meisten kennen wohl noch das Trauerjahr, das zumindest auf dem Lande einzuhalten ist. Wer im Dorf zu früh das muntere Leben wieder aufnimmt, läuft ebenso Gefahr aus der Gemeinschaft zu fallen, wie jemand, der aus der Trauer nicht mehr herausfindet. Anders in Lateinamerika, wo eine stark religiös grundierte Trauerpraxis das soziale Umfeld einbezieht.
"Da spricht die Witwe über ihre Vereinsamung, die Familienmitglieder sind integriert, es gibt Heiligenverehrungen die dazu gehören."
Die oder der Trauernde verfolgt ein Ritual der Trauer, das Bild des Verstorbenen wird zu den Heiligen gestellt und täglich umsorgt. So kümmert sich die Witwe um das Wohlergehen der Familie, worüber regelmäßig auch gesprochen werde, erklärt der Soziologe Schobin die Praxis in Chile:
"Das bindet die Einsamkeit der Witwe ein in einen sozialen Kontext und lindert die auch und erkennt die Einsamkeit als eine bestimmte menschliche Leistung an. Bei uns ist das weniger üblich. Wir haben eher die Vorstellung, dass es ein privates Gefühl ist, man muss selber damit zurechtkommen. Es gibt keine Anerkennung für dieses Gefühl und das macht Vereinsamung viel schwieriger bei uns."
Es sind oft einschneidende Lebensereignisse, die unser soziales Netzwerk durcheinanderwirbeln und Einsamkeitsphasen mit sich bringen: Auszug aus dem Elternhaus, Tod, schwere Krankheiten, Alter, der Umzug in eine fremde Stadt. Um dann nicht in eine chronische oder krank machende Vereinsamung zu fallen, braucht es wohl vor allem Verständnis und Anerkennung für den stillen Schmerz, der eben oft nicht zu einer "schön klingenden Klage" wird, wie es Rilke formulierte, die für die Umwelt deutlich hörbar wäre. Helfen könnten handfeste Strukturen einer solidarischen Gesellschaft, meint die Psychologin Susanne Bücker:
"Da könnte man über viel konkretere Dinge sprechen, wie die Stärkung von Familie und Beruf oder den Wohnausbau auch für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind und trotzdem in Kontakt mit anderen Menschen bleiben wollen."