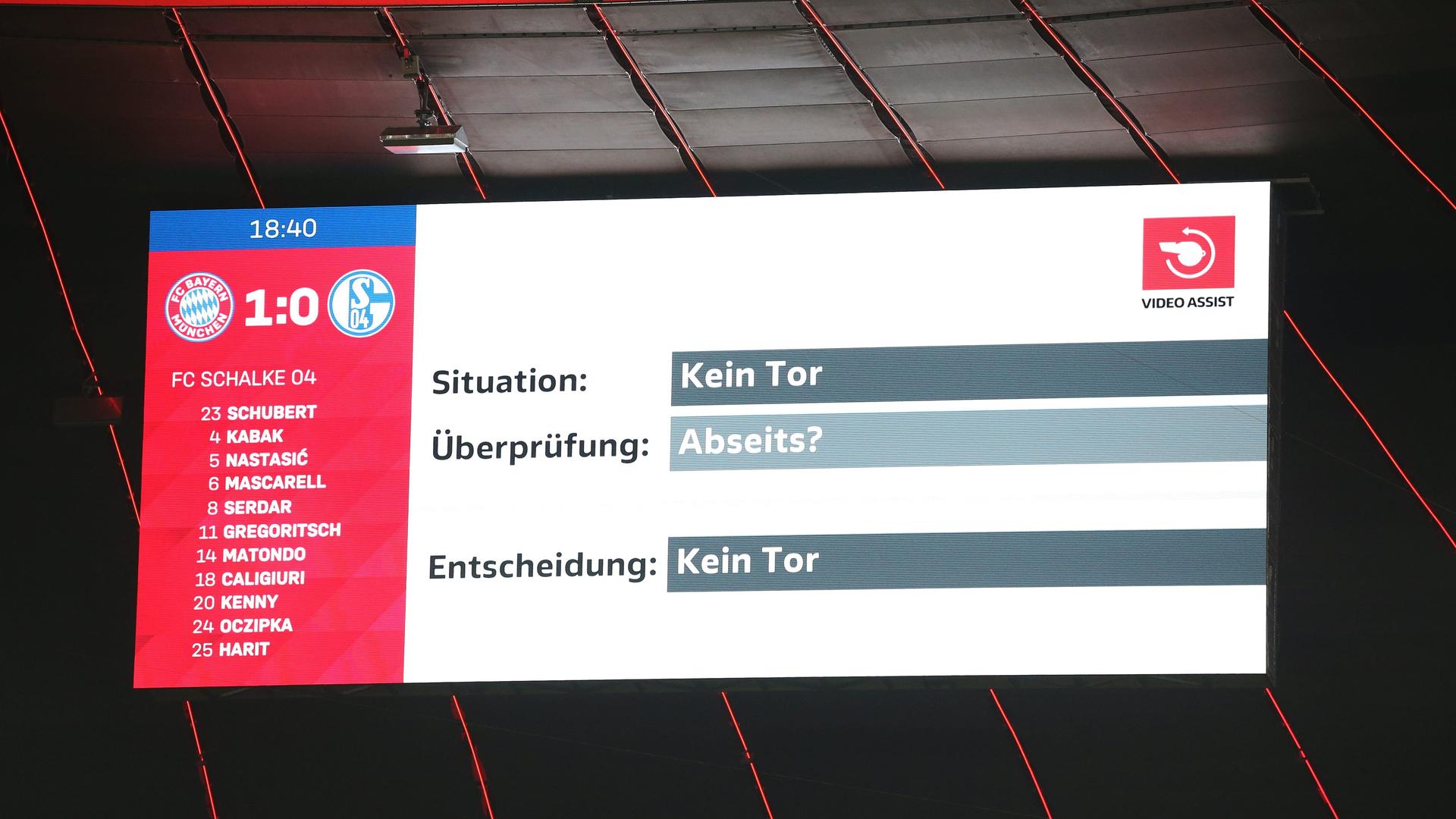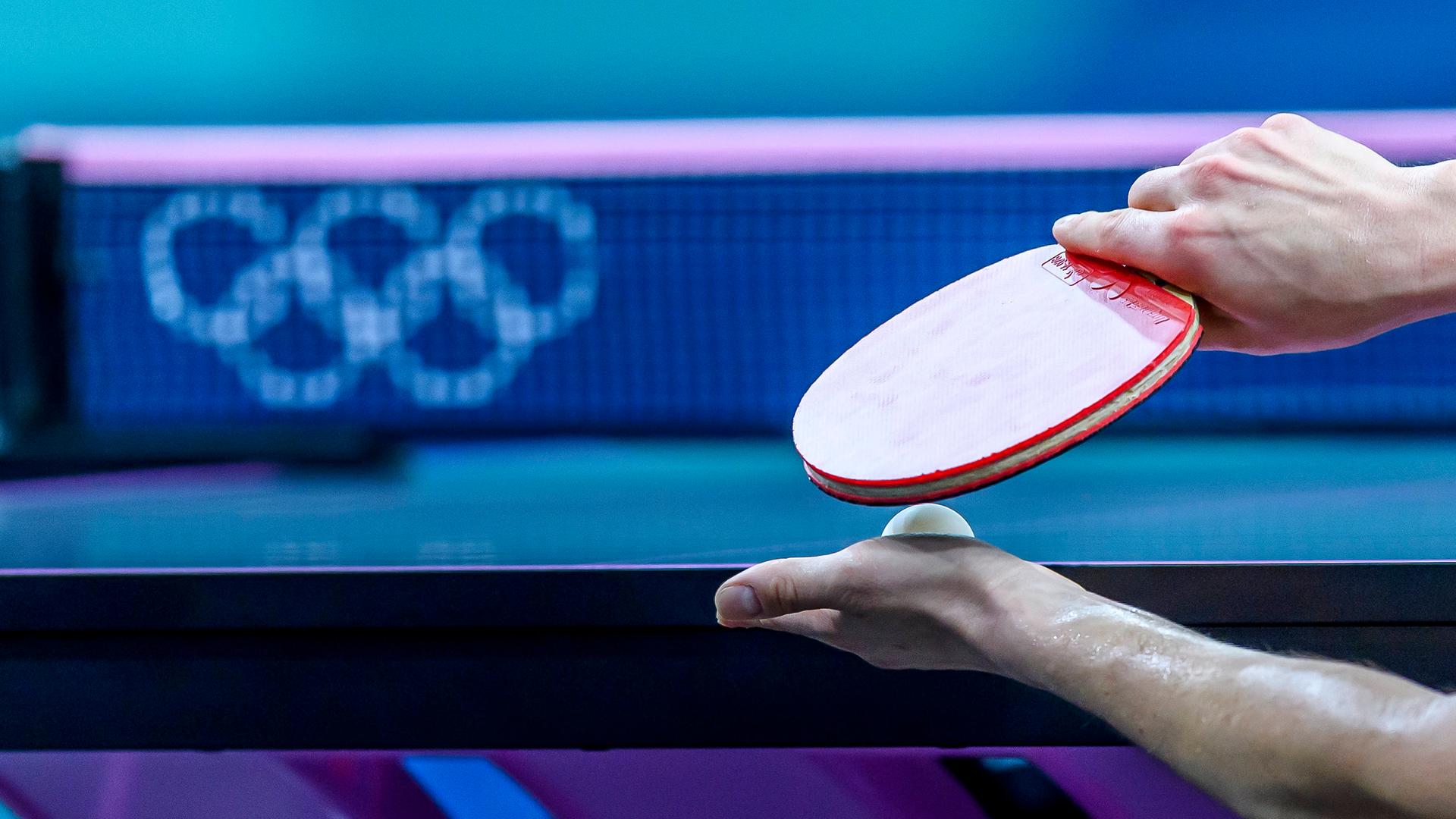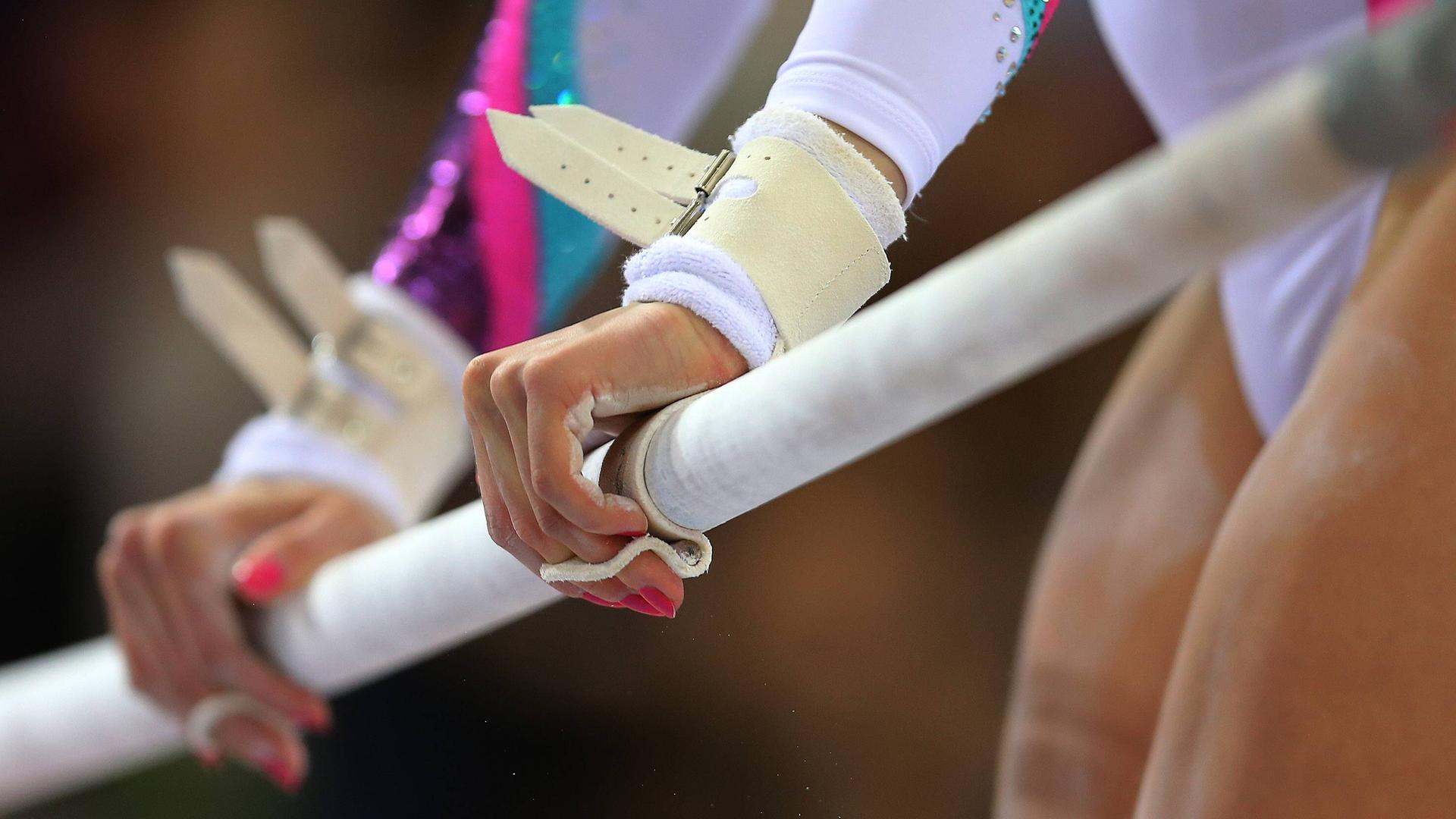Nicht nur die Münchner Arena ist das Ziel der Frankfurter Eintracht an diesem Wochenende. Vor dem Bundesliga-Topspiel besucht eine Gruppe um Präsident Peter Fischer das Konzentrationslager Dachau: "Das sind für uns Veranstaltungen, die quasi normal sind“, sagte er vor wenigen Tagen in der DFB-Zentrale bei der offiziellen Auftaktveranstaltung des diesjährigen Erinnerungstags: „Wo wir junge Leute einfach dahinführen, wo es richtig weh tut, wo es nicht nur Bildchen sind, sondern dort, wo Millionen Menschen brutalst ermordet wurden.“
Seit fast 20 Jahren begeht die Bundesliga Ende Januar den Erinnerungstag, um die Schrecken des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Insbesondere die Ultras in den Fankurven setzen sich an vielen Orten dafür ein. Jahr für Jahr gibt es beispielsweise von der Münchner-Fangruppe „Schickeria“ eine besondere Choreo vor dem Spiel – auch 2023: „Ich weiß, dass die Fans aus Frankfurt, dem Judenclub und München, dem Judenclub, zusammen etwas vorbereitet haben, dass dem Ziel des „Nie wieders“ darstellt“, sagt Eberhard Schulz.
"Tretet, beißt, kreischt, spuckt!"
Nie wieder, so heißt auch die Initiative, die Schulz mitgegründet hat und damit den Anstoß zum Erinnerungstag gegeben hat. Seit dem Aufruf 2004 sei viel passiert, das Bewusstsein in Vereinen und vor allem bei den Fans geschärft worden. Auch Studienfahrten beispielsweise nach Dachau helfen dabei. Besonders lobte er im Deutschlandfunk-Sportgespräch die Fan-Projekte: „Sie haben verstanden, dass das für Ihre Jungs und Ihre Mädchen erstmal interessant ist und dass, wenn so eine Fahrt angeboten wird, diese Fahrten auch voll werden.“
Die Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen der Nazis, sie lassen Eintracht-Präsident Peter Fischer nicht kalt. Er hat für sich verstanden, dass aus der Erinnerung aber auch ein Aufstehen und aktives Dagegenstellen folgen muss, weshalb er schnell emotional wird: „Wir sind so scheiß leise. Die anderen sind unglaublich laut, wenn sie mit ihren Fackeln durch die Straßen ziehen mit ihren Scheißhausparolen. Wir sind so leise, unsere Gesellschaft, alle sind lieb und nett. Ihr müsst lauter werden, tretet, beißt, kreischt, spuckt, egal, was ihr macht – wehrt euch vor allen Dingen.“
Klare Positionierung gegen die AfD
Seit einem Interview in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ Ende 2017 ist Fischer so etwas wie zu einem politischen Vorreiter im deutschen Profifußball geworden. Damals hatte er gesagt, wer die Afd wählt, könne kein Eintracht-Mitglied sein. Das hat „mich natürlich zum großen Feind der AfD gemacht“ erinnert er sich im Deutschlandfunk-Players-Podcast. Eine heftige Debatte entbrennt, Populismus wird ihm vorgeworfen, Drohungen und Beleidigungen habe er in vielen Aktenordnern in seinem Büro gesammelt. Das störe ihn aber nicht, ganz im Gegenteil, sagt er. Denn andersherum ist die Unterstützung auch enorm groß, so groß, dass viele Fans anderer Vereine schreiben und Eintracht-Mitglied werden wollen.
„Wenn wir gegeneinander spielen, wollen wir euch weghauen. Aber so wie du dich positionierst und wie dein Verein dasteht, möchte ich mich diesem Verein anschließen und dich unterstützen als passives Mitglied", erzählt er nicht ohne Stolz. Vor einem Jahr bekommt er die Buber-Rosenzweig-Medaille für christlich-jüdische Zusammenarbeit und steht damit in einer Reihe beispielsweise mit Angela Merkel, Navid Kermani oder Daniel Barenboim.
„Mir ist die Kraft und Energie von Fußball und von Sport im Allgemeinen schon sehr bewusst“, sagt er in der Rückschau, war aber auch überrascht über das Echo auf diesen einen Satz 2017: „Aber mir war natürlich nicht klar, dass man diese Energie in diesem emotionalen Umfeld, auch im heterogenen emotionalen Umfeld, andere für mich monsterwichtige Nachrichten und Botschaften platzieren kann, die seriös ankommen und gehört werden.“
Schon den Kleinen zeigen, wie wichtig Zusammenhalt und Demokratie sind
Gehört wird er seitdem in ganz Deutschland. Und das motiviert ihn, weiter zu machen. Auch eine ganz persönliche Begegnung mit seinem Sohn hat dazu geführt. Der spielt für den jüdischen Sportverein Makkabi, bei dem man aber mitmachen darf, egal welcher Religion man angehört. Und eines Tages habe sein Sohn nach einem Spiel gefragt: „Papa, warum beschimpfen die mich mit Scheiß Jude? Ich bin doch gar kein Jude. Papa, wie erkennt man denn einen Juden? Wie sieht denn ein Jude aus? Warum sind denn Juden böse? Warum werden die denn gehasst? Was machen die denn, Papa? Wenn Du sowas hörst, hast Du ein bisschen Tränen in den Augen zweifelsohne“
Auch da habe er verstanden, noch mehr tun zu wollen und zwar schon früh anzufangen, bei den Kleinsten, bei denen, die in Zukunft, auf der Welt entscheiden. „Kein Kind, was auf die Welt kommt, ist Rassist, kein Kind, was auf die Welt kommt, ist in irgendeiner Form versaut von einem Umfeld, ist jemand, der in sich böse ist.“
Seine feste Überzeugung: Schon mit den Kleinen in der Grundschule muss man sprechen und ihnen beibringen, wie wichtig Zusammenhalt und Demokratie sind, „und gemeinsam dafür arbeiten, dass dieses so sensible Geflecht von Demokratie zerstört wird. Weil, was danach kommt, das haben wir schon mal erlebt. Also nie wieder!“