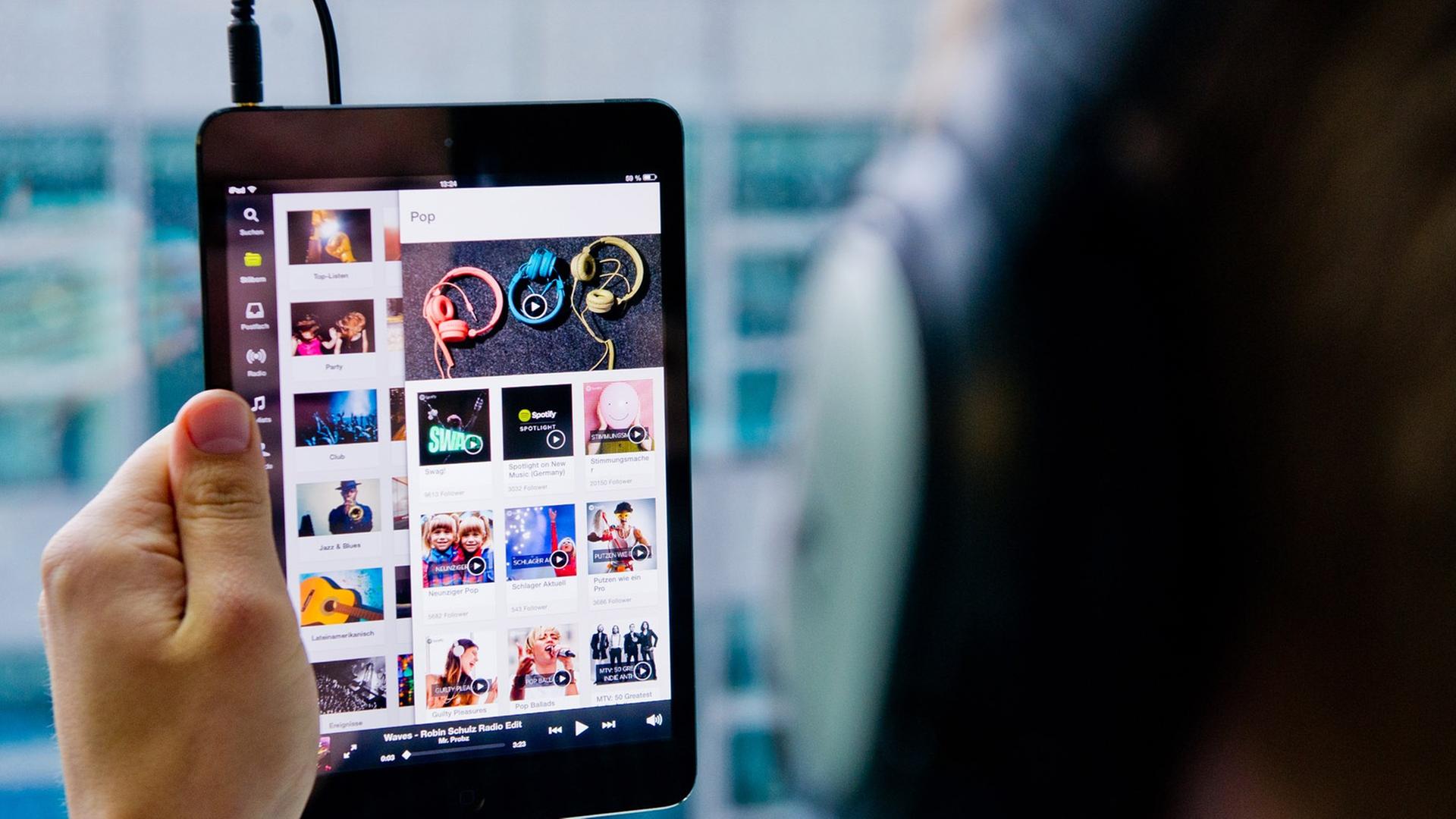Im Obergeschoss der Ausstellung stellt Maxime Neveu gerade den Minimoog ein. Der erste Kompakt-Synthesizer, ab 1970 und bis 1981 in den Vereinigten Staaten produziert, sorgte für eine musikalische Revolution. Nachzuhören beispielsweise auf dem Album 'Dark Side of the Moon' von Pink Floyd, sagt Maxime Neveu, der die Ausstellungs-Besucher betreut:
"Heute kommen immer mehr Musiker auf den Minimoog zurück. Denn jede Maschine hat ihren ganz eigenen Charakter. Der Alterungsprozess verändert den Klang, selbst Synthesizer ein und derselben Serie hören sich mittlerweile sehr unterschiedlich an. Viele Besitzer hängen sehr an ihrem Instrument, dabei besteht das doch nur aus einem Holzkasten und elektronischen Bauteilen."
Musik zum anfassen
Am Synthesizer im Obergeschoss klebt eine Tafel: Bitte ausprobieren! Der Minimoog im Erdgeschoss jedoch steht in einer verschlossenen Glasvitrine: Er gehörte dem Avantgarde-Komponisten John Cage. Hier im ersten Saal wird chronologisch der Bogen gespannt, von historischen elektronischen Instrumenten über Laborgeräte bis zu topmodernen digitalen DJ-Steueranlagen. Ausstellungsleiter Jean-Louis Frechin blickt über 71 Jahre Entwicklungsgeschichte:
"Nach Ende des 2. Weltkriegs begannen viele Tonlabors der großen Radios in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder auch Philipps in Holland, für die Entwicklung neuer Musik mit neuer Technik zu experimentieren. Technologien, die für Kriegszwecke entwickelt wurden, wie beispielsweise Oszilloskopen, Ton- und Frequenzgeneratoren. Da forschten Physiker und Techniker zur Entstehung von Tönen. Während gleichzeitig Künstler, Musiker, anfingen, mit konkreten Tönen, ersten Natur-Aufzeichnungen, zu arbeiten. Diese konkreten Töne zum einen und die synthetischen Klänge zum anderen bilden die Basis der elektro-akustischen Musik."
In der Mini-Disco im Untergeschoss thront ein Plattenspieler: Die Boombox. Per Tellerdrehung scratcht sich der Besucher durch die Tanzmusik der letzten vier Jahrzehnte.
Fähigkeit zur Innovation
Ob Raver mit Karl Heinz Stockhausen und seinem 1956 uraufgeführten 'Gesang der Jünglinge' etwas anfangen können, ist fraglich. Dabei handelt es sich um die Weiterentwicklung der Avantgarde zum heutigen Mainstream. Jean-Louis Frechin:
"Was die elektronische Musik charakterisiert, ist ihre strukturelle Fähigkeit zur Innovation. Sie hat vieles neu erfunden: die Art, Musik zu kreieren, die Instrumente, den Künstler-Status. Früher gab es berühmte Komponisten wie Pierre Boulez, Stockhausen, Schostakowitsch. Heute kann jeder Künstler werden. Man könnte glauben, dass es so mit der musikalischen Qualität bergab ginge, aber nein - ständig entsteht Neues."
Neue Instrumente beispielsweise wie Noisy Jelly, das zwei französische Industriebau-Studenten erfanden. Noisy Jelly ist: Wackelpudding aus Algenpulver, mit Sensoren und digitalen Chips ausgestattet, die bei Berührung sehr eigene Töne generieren. Ein Besucher, Musikstudent und Nachwuchsmusiker, testet das Thérémini, digitale Neuauflage eines der allerersten elektronischen Instrumente.
"In der elektronischen Musik wird es, denke ich, wieder mehr Richtung Experimentelles gehen. Weg vom heutigen Mainstream. Aber: Wer kann schon in die Zukunft blicken?"