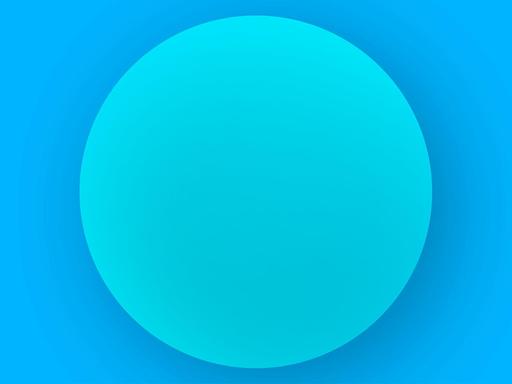Die elektronische Patientenakte (ePA) gibt es schon seit 2021. Allerdings wurde das Angebot bislang nur wenig genutzt. Das ändert sich nun durch einen Beschluss des Bundestags vom Dezember 2023: Ab dem 15. Januar 2025 soll für jeden gesetzlich Versicherten automatisch eine ePA angelegt werden, falls Versicherte dem nicht aktiv widersprochen haben. Getestet wird die ePA aber vorerst an 250 Standorten in Hamburg, Franken und Teilen Nordrhein-Westfalens.
Erst nach mindestens vier Wochen soll die ePA bundesweit in die Praxis überführt werden – wenn alles funktioniert. Möglicherweise dauert die Testphase auch länger.
Ende der Zettelwirtschaft, Zusammenfassung von Gesundheitsdaten: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte das Projekt vorangetrieben. Doch es gibt weiterhin Kritik, vor allem von Daten- und Verbraucherschützern.
Inhalt
- Was ist die elektronische Patientenakte?
- Was ist mit der elektronischen Patientenakte möglich?
- Wer bekommt eine elektronische Patientenakte?
- Wie kann man die elektronische Patientenakte ablehnen?
- Wer befürwortet die elektronische Patientenakte und mit welchen Argumenten?
- Welche Kritik gibt es an der elektronischen Patientenakte?
Was ist die elektronische Patientenakte?
Bei der elektronischen Patientenakte handelt es sich um einen persönlichen Datenspeicher, der Patientinnen und Patienten ein Leben lang bei allen Arztbesuchen begleitet. Bislang ist es in der Regel so: Die Hausarztpraxis eines Patienten speichert all das, was das medizinische Personal für relevant hält, in einer Akte: Befunde, Diagnosen und weitere Informationen zur individuellen Krankheitsgeschichte.
Diese Akte wird von der Hausarztpraxis vor Ort geführt und verwahrt – oft in Papierform, zusätzlich inzwischen meist auch digital auf den Computern der Praxis bzw. in einer Software aus der Riege zahlreicher Praxisverwaltungssysteme. Besucht der Patient nun eine Facharztpraxis, zum Beispiel für Innere Medizin, wird dort ebenfalls eine Akte für ihn angelegt.
Möchte die Allgemeinarztpraxis nun wissen, was die Untersuchung der internistischen Facharztpraxis ergeben hat, muss der Patient dem Datenaustausch zustimmen. Ein zentrales Dokument, das Einsicht in alle einzelnen Praxis-Akten eines Patienten bietet, gab es lange Zeit nicht. Genau das will die elektronische Patientenakte leisten.
Was ist mit der elektronischen Patientenakte möglich?
Die ePA bündelt zahlreiche Patientenakten aus unterschiedlichen Praxen und Kliniken zentral an einem (digitalen) Ort. Beim Bundesgesundheitsministerium heißt es zur ePA: „Sie wird den Versorgungsalltag für Patientinnen und Patienten und Leistungserbringer erleichtern – im ersten Schritt durch die Einführung der digitalen Medikationsliste. In enger Verknüpfung mit dem E-Rezept können so ungewollte Wechselwirkungen von Arzneimitteln besser erkannt und vermieden werden. Zudem werden Ärztinnen und Ärzte im Behandlungsprozess unterstützt.“
Nach und nach werde die Akte ausgebaut.
Von den Patientinnen und Patienten selbst wird die ePA über eine App aufgerufen, die die jeweilige Krankenkasse zur Verfügung stellt. Ärztinnen und Ärzte stellen bestimmte Dokumente ein. Doch sie, genauso wie Apotheken, haben laut Ministerium „nicht automatisch Zugriff“. Die Versicherten müssen die Daten freigeben.
Die ePA soll eine patientengeführte Akte sein. Das bedeutet nach Darstellung der Verbraucherschützerin Sabine Wolter aber auch einige Mühen: „Gerade wenn ich die Daten selber verwalten möchte über die ePA-App oder ich bestimmen möchte, wer was sieht in der Akte, insbesondere ob ich jetzt bestimmten Ärzten eine Berechtigung gebe, muss ich mich selber darum kümmern.“ Man könne die Akte aber auch passiv nutzen.
Wer bekommt eine elektronische Patientenakte?
Seit dem 15. Januar 2025 erhalten alle gesetzlich Versicherten automatisch ein E-Akte. Es sei denn, man hat aktiv widersprochen.
Die Patientinnen und Patienten sollten sich sorgfältig und im Detail darüber informieren, welche Daten sie zur Einsicht freigeben wollen, sagte Jürgen Windeler, ehemaliger Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Dies sei unter Umständen eine große Herausforderung.
Kann man die elektronische Patientenakte ablehnen?
Ja. Es gibt keine Pflicht, die ePA zu nutzen. Wer die elektronische Patientenakte nicht möchte, muss allerdings selbst aktiv werden und dies seiner Krankenkasse mitteilen. Diese Notwendigkeit des aktiven Widerspruchs wird als Opt-out-Verfahren bezeichnet. Alternativ können bestimmte Befunde und Laborwerte auch geschwärzt werden. Die ePA kann man außerdem jederzeit löschen lassen, betonen die Krankenkassen.
Wer befürwortet die elektronische Patientenakte und mit welchen Argumenten?
Schnellere und gezieltere Behandlungen
Einige Fachleute verbinden mit einer großen Verbreitung der ePA vor allem die Hoffnung, dass individuelle Informationen über Patienten schneller abgerufen werden können als bisher. Das könnte im Ernstfall sogar Leben retten, heißt es. Beispielsweise dann, wenn ein Notarzt sofort weiß, dass sich ein Medikament, das er einsetzen will, nicht mit den Tabletten verträgt, die der Patient regelmäßig einnimmt.
Auch generell könnte eine mit relevanten Informationen befüllte E-Akte einen zeitlichen Vorteil beim Beginn der (richtigen) Behandlung bedeuten – verglichen mit der bisherigen Praxis, bei der all diese Daten einzeln von unterschiedlichen Ärzten abgefragt werden müssen.
Die Pläne, eine elektronische Patientenakte einzuführen, bekamen vor allem durch den Lipobay-Skandal kurz nach der Jahrtausendwende Schwung. Bei Patienten, die sowohl den von Bayer entwickelten Blutfettsenker Lipobay einnahmen als auch bestimmte andere Medikamente, traten in Tausenden Fällen schwere Wechselwirkungen auf.
Unnötige Behandlungen vermeiden
Das Bundesgesundheitsministerium wirbt für die elektronische Patientenakte noch mit einem weiteren Argument: „Statt einer Lose-Blatt-Sammlung zu Hause oder einzelnen Befunden in den Praxissystemen verschiedener Praxen haben Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten alle relevanten Dokumente auf einen Blick sicher verfügbar. So können beispielsweise belastende Mehrfachuntersuchungen vermieden werden.“
Einen großen Mehrwert durch die geplante Digitalisierung sieht die Gesundheitsexpertin Martina Stamm-Fibich (SPD). Gerade im Bereich der Notfallversorgung sei es wichtig, dass die Patientendaten "jederzeit und überall verfügbar" seien, so die Bundestagsabgeordnete. Informationen zu Vorerkrankungen und Medikamentenunverträglichkeiten seien mit der Akte schneller verfügbar.
Wenig effiziente Behandlungen identifizieren
Der Gesundheitsökonom Boris Augurzky vom RWI-Leibniz-Institut in Essen erhofft sich durch eine stark verbreitete ePA zudem eine bessere Vergleichbarkeit im Gesundheitswesen: „Dann haben Sie auch Transparenz über das Versorgungsgeschehen und können mal schauen, welche Versorgungsmaßnahmen was bringen", betont er. Bisher habe das deutsche Gesundheitswesen nicht den Hang zum Qualitätswettbewerb.
Welche Kritik gibt es an der elektronischen Patientenakte?
Vor allem Datenschützer stehen der ePA bisher kritisch gegenüber. Denn in der Akte können persönlichste Informationen gespeichert werden, wie etwa Angaben über psychische Erkrankungen. In einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) monierten zum Beispiel die Deutsche Aidshilfe, der Bundesverband der Verbraucherzentralen, Patientenorganisationen und der Chaos Computer Club, dass die Einführung zu früh komme. Es sprechen von erheblichen Sicherheitsbedenken.
Martin Tschirsich vom Chaos Computer Club sagte, es habe eine Woche gedauert, um Zugangsschlüssel für alle 70 Millionen Akten zu generieren: „Es war tatsächlich erschreckend einfach.“ Vor diesem Hintergrund empfiehlt er Patientinnen und Patienten, sich zu überlegen, "was einem persönlicher wichtiger ist: die Vertraulichkeit der Daten oder dass die Daten nutzbar sind"; vor allem Patientinnen und Patienten mit Diagnosen, die selbst im Gesundheitswesen als stigmatisierend empfunden werden.
IT-Sicherheitsexperten wiesen verschiedene Lücken bei der ePa nach. Ihre Ergebnisse präsentierten sie auf dem vergangenen Chaos Communication Kongress in Hamburg. Größtes Problem: Die Zugangsberechtigungen zu den E-Akten seien viel zu einfach. Es sei etwa mit wenig Aufwand möglich, sich die gesamten elektronischen Patientenakten einer gesamten Krankenkasse zu ziehen. Unter anderem fehle an bestimmten Stellen ein Zwei-Faktor-Identifizierungsverfahren.
Der Bundesgesundheitsminister versprach dagegen: „Die elektronische Patientenakte wird nicht ans Netz gehen, wenn es auch nur ein Restrisiko für einen großen Hackerangriff geben sollte.“ Bei den technischen Problemen seien „nur noch Kleinigkeiten“ zu lösen.
Die Deutsche Aidshilfe äußerte die Sorge, Menschen mit HIV zum Beispiel könnten stigmatisiert werden. Man kann allerdings in der ePA einzelne Dokumente sperren oder nur für bestimmte Ärzte freigeben oder Daten auch dauerhaft löschen. Das muss man aktiv tun.
Neben den Sicherheitsbedenken verweist Verbraucherschützerin Sabine Wolter auch darauf, dass Menschen ohne digitales Endgerät auf Hilfe angewiesen seien: durch eine Vertrauensperson, die für den Betroffenen die ePA-App nutzt, oder durch die Ombudsstelle der Krankenkasse.
Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) hatte zuvor unter anderem auch den erforderlichen aktiven Widerspruch moniert und sich unzufrieden darüber geäußert, wie die Akte befüllt werden soll. Er forderte Nachbesserungsbedarf im Falle der sensibelsten Gesundheitsdaten.
jma, bth