
"Was wir im Hintergrund rattern hören, das ist ein Dauerprüfstand für kinetische, elektromagnetische Energiewandler."
Jedes Staubkorn wird bestehen aus:
Sensoren.
Kommunikatoren.
Und:
Energie!!!
Endlich ernten! – Energy Harvesting: Maschinen nabeln sich ab
Von Piotr Heller
Von Piotr Heller
Frank Schmidt steht im Erdgeschoss eines unauffälligen Bürogebäudes in Oberhaching bei München. In dem Dauerprüfstand sind vier kleine Bauteile eingespannt. Vier mal pro Sekunde drücken elektrische Finger zu. Auf einem Bildschirm schlägt dann der Graph eines Diagramms aus. Er zeigt den Energiepuls an.
"Das ist ein elektromechanischer Harvester. Der hat eine kleine Feder und das erste, was passiert, ist: Wenn ich mit dem Finger dort Druck ausübe, dann spanne ich die Feder, das heißt: Ich bringe Energie ein und spanne eine Feder. An einem bestimmten Punkt reicht diese eingebrachte mechanische Energie aus, um dort ein kleines Blechteil umzuklappen."
"Wir leben in einem Ozean von Energie, wir müssen den nur nutzen"
Die Spule zeigt dann einen Induktionsimpuls an ihren Kontakten, das sind etwa 100 Mikrojoule Energie. Der kleine Energiewandler ist gedacht für ein Ding, das jeder täglich benutzt: einen Lichtschalter. Frank Schmidt hat ihn erfunden. Seine Schalter feuern beim Draufdrücken ein Funksignal ab. Eine Lampe empfängt es und geht an. Damit hat der Physiker die Lichtschalter von Kabeln befreit.
"Wir haben gedacht: Wenn wir etwas monitoren, einen physikalischen Vorgang, dann passiert ja was, da ändert sich was. Und da ist immer ein Energiefluss damit verbunden. Warum können wir nicht die Energie nutzen, um Funksensoren zu betreiben? Und das war die Geburtsstunde der Idee: Wir leben in einem Ozean von Energie, wir müssen den nur nutzen. Und das war dann auch der Name, den wir dann der Firma gegeben haben. "Enocean", der Energie Ozean."
Es sind nicht nur die Schalter von Frank Schmidt, die aus diesem Ozean schöpfen. Mittlerweile ernten verschiedenste Maschinen Energie aus ihrer Umgebung, betreiben also "Energy Harvesting". Sie machen Gebäude effizienter, helfen der Industrie und der Medizin, leisten sogar einen Beitrag zur Energiewende. Sie funktionieren an Orten mit harschen Bedingungen. Und wenn man manchem Visionär glaubt, reisen sie irgendwann sogar zu fremden Sternen.
"Im Endeffekt, wenn Sie mal 200 Jahre zurückgehen, dann waren die Energiequellen, die wir hatten, diejenigen, die in der Umwelt verfügbar waren. Das war im wesentlichen Wasserkraft oder auch Windkraft. Erst mit dem Einsatz fossiler Brennstoffe hat man begonnen, gespeicherte Energie zu verwenden - und das tun wir schwerpunktmäßig bis heute. Das heißt, Energy Harvesting ist in sich eine sehr alte Technik, die wir jetzt neu entdecken. Und wir in Freiburg nennen das bewusst Micro Energy Harvesting."
Peter Woias von der Universität Freiburg ist Sprecher des Graduiertenkollegs Micro Energy Harvesting. Das "Micro" bezieht sich auf die Leistung, die die Maschinen ernten. Es sind einige Mikrowatt, also etwa ein Millionstel von dem, was man so braucht, um eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Nicht viel also. Genaugenommen sogar ziemlich wenig. Und trotzdem kann man neuerdings so einiges damit bewegen.
"Stellen Sie sich vor, Sie haben große Bürogebäude oder Verwaltungsgebäude, große Universitäten. In den Unis sind Zehntausende von Heizkörperstellantrieben. Das sind typischerweise diese thermostatischen Antriebe, die niemand betätigt. Das bedeutet, die sind entweder zu oder sie sind immer offen und werden nie wieder angefasst."
Der Albtraum eines jeden Hausmeisters. Experten gehen davon aus, dass große Gebäude bis zu 30 Prozent an Heizenergie sparen könnten, wenn man sie automatisieren würde. Doch da gibt es ein Problem: Automatische Steuerungen brauchen Batterien – bei Zehntausenden Heizkörpern will die keiner wechseln. Die Lösung könnte ein kleines weißes Kästchen sein. Es hängt bei Fritz Volkert im Büro seiner Firma Micropelt an einem Heizungsventil.
"Das ist ein energieautarker Heizkörperstellantrieb. Der ist insofern energieautark, als dass er die Energie, die er benötigt für die Funkkommunikation und für das motorische Verfahren, aus der Temperaturdifferenz gewinnt, der Temperaturdifferenz zwischen dem Heizkörper und der Umgebung."
Thermogeneratoren nutzen Heizungswärme zur Energiegewinnung
Die automatischen Heizungsventile bekommen eine vorgegebene Temperatur von einem Sender, prüfen, wie die Heizung tatsächlich eingestellt ist, und öffnen oder schließen das Ventil mit einem Elektromotor. Ihr Herzstück ist ein Thermogenerator, der Energie nach einem altbekannten Prinzip sammelt.
"Es gab einen Herrn Seebeck, der hat das 1821 erfunden. Er hat festgestellt: Wenn ich zwei unterschiedliche Metalle nehme, die zusammenführe und dort eine Temperaturdifferenz anlege, dann fließt elektrischer Strom. Der Seebeck Effekt ist bekannt, seit langem. Er beispielsweise wird auch in der Raumfahrt eingesetzt, um Energie in Satelliten zu gewinnen. Man baut dort eine Wärmequelle ein und erzeugt so die Energie für den Fall, dass irgendwelche Solarenergiequellen nicht vorhanden sind."

Die Thermogeneratoren von Fritz Volkert nutzen nur die Wärme der Heizung. Er produziert sie in einem Reinraum in Halle, aus dem Material Bismuttellurid, nach dem gleichen Prinzip wie Mikrochips für Computer. So sehen sie auch aus: Es sind zwei mal drei Millimeter kleine Rechtecke, die die gesamte Energie für den Stellantrieb liefern.
Beim Energy Harvesting geht es nicht so sehr um die Menge an Energie, die ein System erzeugt. Es geht um die Energie, die man spart, weil man große Anlagen mit vielen kleinen Sensoren steuert. Ölbohrtürme, Raffinerien, Druckereien profitieren heute schon. Auch Peter Woias arbeitet an energieautarken Sensoren:
"Sensoren, die an Eisenbahngleisen angebracht werden, um das Annähern eines Zuges zu detektieren und die Achsen zu zählen. Genauso auch ein Projekt, wo wir einen Schrittzähler am Turnschuh realisiert haben. Genauso haben wir ein Projekt aus der Wildtierforschung, wo wir Wildtiere mit Halsbändern versehen wollen, die Funksender tragen. Das ist an und für sich nichts Neues. Aber wir wollen diese Funksender energieautark aus der Abwärme des Tieres versorgen."

Was alle diese Systeme gemeinsam haben: Sie müssen ihre Informationen per Funk versenden. Denn es bringt nichts, sich das Stromkabel zu sparen, aber die Maschinen an Datenkabel zu binden. Die Technik muss sich komplett abnabeln. Keine einfache Aufgabe.
"Technisch ist die größte Herausforderung bei dieser Art Systeme, dass man mit kleinsten Energiemengen zuverlässige Funktion gewährleisten muss. Wenn Sie ein Funksystem energetisch betrachten, dann haben Sie dort immer verschiedene Parameter, die dort wichtig sind. Eins ist die Reichweite. Und man braucht eine Zuverlässigkeit in der Übertragung: Das heißt, Kollisionen mit anderen Funksystemen oder den eigenen Funksystemen, die muss man sehr gering halten, sodass das Ganze stabil arbeitet", erklärt Frank Schmidt, der für seinen Lichtschalter den batterielosen Funk entwickelte. Dabei musste er kreativ sein. Ein Beispiel: Wer funkt, muss immer darauf achten, dass seine Signale sich nicht mit anderen überlagern. In ausgefeilten Systemen, wie dem W-Lan-Router zu Hause, übernehmen das spezielle Algorithmen.
"Wir haben keinen Algorithmus implementiert, der dort erstmal verhandelt: Auf Welchem Funkkanal sende ich? Und wer darf zuerst? Weil dafür haben wir gar nicht die Energie. Wir haben eine einfache Strategie gewählt zu sagen: Ich sende die Informationen immer mehrmals, aber ich tue das mit zeitverzögerten, redundanten Aussendungen. Das ist ein Grundbaustein von unserem Funkprotokoll."
Mehrmals senden, irgendwas wird schon ankommen: Mittlerweile stellt Schmidts Firma verschiedene Sensoren her, die auf diese Art funken: Sie messen Temperatur, erkennen, ob Menschen im Raum sind oder Fenster geöffnet. Über 150 Unternehmen nutzen sie in Ihren Produkten. Von großen Herstellern wie Philipps bis hin zu kleinen Start-ups wie Micropelt aus Freiburg mit ihrem Heizkörperstellantrieb. Als Frank Schmidt mit seinen Leuten in den 90ern mit der Entwicklung anfing, waren sie jedoch nicht alleine.
"Wir haben das erst hinterher mitbekommen, dass zum Beispiel in den USA an Universitäten an ganz ähnlichen Konzepten gearbeitet wurde. Also man könnte sagen: Das lag irgendwie in der Luft."
Was da in der Luft lag, war unter anderem Staub. Intelligenter Staub.
Spionage im Staub-Format: Das Projekt Smart Dust
1997 ging bei der Darpa ein Antrag ein. Die Darpa, das ist die Forschungsbehörde des US-Militärs. Der Titel des Antrags: Smart Dust. Ein frühes Energy-Harvesting-Projekt. Und ein spektakuläres. Das Konzept sah folgendes vor: Jedes der Sensor-Staubkörnchen ist ein Mini-Computer. Militärs können zig Tausende von ihnen hinter feindliche Linien befördern. Mittels Artillerie oder Drohnen. Dort bilden die Minirechner ein Netzwerk. Jeder einzelne kommuniziert nur mit seinen Nachbarn – so decken sie in der Masse ganze Quadratkilometer ab, und ihre Sensoren belauschen die Umgebung: Spionage im Staub-Format.
Entsprungen ist die Idee dem Kopf von Kristofer Pister. Im kalifornischen Berkeley erforscht er winzige Roboter. Die Fördermittel für den Smart Dust hat er damals erhalten und es geschafft, die Sensoren auf Reiskorn-Größe zu bringen. Ob sie es jemals hinter feindliche Linien schafften, ist nicht klar, aber es gibt sie.
"Sie sind auf der ganzen Welt verteilt. In Industrieanlagen in der saudischen Wüste und nördlich des Polarkreises. Sie überwachen Erdölbohrungen und Zugwaggons, und sogar Parkplätze in San Francisco. Ich glaube, unsere Sensoren sind auf jedem Kontinent bis auf die Antarktis."
Kristofer Pister hat eine Firma gegründet, die die Sensoren nach dem Smart-Dust-Prinzip an die Industrie verkauft. Doch dabei musste er feststellen: Nicht jeder ist bereit für die Technologie.
"Ursprünglich sollte Energy Harvesting ein absolut kritischer Teil unserer Maschinen sein. Doch um das zu schaffen, machten wir unsere Geräte so sparsam, dass sie locker zehn Jahre mit einer einfachen Batterie klar kamen. Und potenzielle Kunden bevorzugen – noch – die Batterie."
Peter Woias:
"Energy Harvesting spielt seine Stärken überall dort aus, wo wir Kabel schwer verlegen können, oder wo der Schaden an einem Kabel sehr schrecklich wäre in seiner Konsequenz oder wo eine Batterie nicht geeignet ist, weil es zu warm ist, zu kalt ist, zu viele Vibrationen vorhanden sind oder schlicht, wo ich die Batterie schlecht wechseln kann."
Energy Harvesting als Chance für die Energiewende
Rieder, ein kleines Städtchen im Harz, ein Umspannwerk. Der Informatiker Carsten Brockmann schaut auf Hochspannungsleitungen.
"Wir können das Astrose-System sehen. Und zwar hier direkt am ersten Mast. Und wenn man jetzt gegen den Himmel blickt, dann sehen wir hinter den Isolatorketten eine kleine, eiförmige, schwarze Kugel und das ist unser erster Sensor. Und wenn wir mit dem Auge der Trasse folgen, dann sehen wir, dass an jedem Masten ein weiterer Sensor installiert ist. Wir haben keine Batterie oder auch keinen Akku in dieses System eingebracht. Sondern die Energie wird aus dem elektrostatischen Randfeld des Leiterseils geharvestet, also gewonnen."

Das elektrische Randfeld des Hochspannungsseils ist das Feld, das zwischen dem Seil und der Erde besteht.
"Wir werden jetzt einfach mal die Trasse entlangfahren und uns jetzt aus der Ortschaft Rieder herausbewegen."
Grund für den Aufwand, den Carsten Brockmann vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration gemeinsam mit einem weiteren Forschungsinstitut, einem Hardwarehersteller und einem Stromversorger betreibt, ist die Energiewende.
"Wir haben durch die Einspeisung von regenerativen Energien eine relativ hohe Dynamik in den Stromnetzen. Und grade zu den Spitzenzeiten ist es notwendig, bestimmte Reserven, die in den Netzen vorhanden sind, optimal nutzen zu können."
Momentan werden die Reserven nicht optimal genutzt. Der Grund: Die Seile dürfen nicht zu sehr durchhängen. Der Stromfluss erwärmt die Leitungen und dehnt sie aus. So ergibt sich ein maximaler Stromfluss. Bisher berechnet man den nach einem Worst-Case-Szenario: Sonneneinstrahlung und kein Wind, der die Seile kühlt. Tatsache ist aber, dass die Seile unter echten Bedingungen sehr wohl gekühlt werden und man mehr Strom durchschicken könnte. Wie viel? Das weiß keiner.

Der Plan hinter dem Projekt ist also: Die Sensoren messen die Neigung jedes Seils einer Stromtrasse auf 0,01 Grad genau und können so den Durchhang berechnen. Die Information geben sie von Sensor zu Sensor nach dem Prinzip der stillen Post weiter. So können die Betreiber der Trasse genau sehen, wie viele Reserven gerade in der Leitung schlummern. Hier im Harz testet Carsten Brockmann eine Pilotanlage mit 59 Knoten.
"Das Besondere ist, dass wir eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit brauchen und ein sehr wartungsarmes System. Und wir unter allen Umständen vermeiden wollen, dass Leitungen abgeschaltet werden müssen. Wir sind jetzt hier am Knoten 35. Wir befinden uns komplett außerhalb von Infrastruktur. Der nächste Ort ist knapp zehn Kilometer entfernt."
Carsten Brockmann geht durch das hohe Gras auf eine kleine Anhöhe.
"Wir haben den Mast hier vor uns und gleich nachfolgend den nächsten und übernächsten, wo wir immer wieder an demselben Leiterseil die Systeme sehen können. Wir haben an dieser Stelle vor allem Entfernungsmessungen für die Funkreichweite durchgeführt."
Die Pilotanlage in Peine läuft seit 2014. Das Konsortium will ein fertiges Produkt entwickeln und es den Betreibern von Stromtrassen anbieten. Die könnten dann vielleicht an mancher Stelle auf neue Leitungen verzichten – trotz Windstrom. In den Niederlanden arbeitet derweil ein Forscher an einer ganz neuen Energiequelle.
"Wir gehen jetzt runter, da ist unser Laboratorium. Es ist hier herrlich warm. Unsere Pflanzen lieben das auch. Ich zeige erstmal eine kleine Aufstellung. Dieser Schrank ist speziell entwickelt, um Pflanzen zu wachsen. So hat man das Licht, gute Bedingungen. Und man sieht hier eine große grüne Pflanze. Die wächst auf in diesem kleinen durchsichtigen Behälter und das ist unsere pflanzenmikrobielle Brennstoffzelle."
Die Pflanze gehört zur Gattung der Schlickgräser. Sie hat lange Halme und in dem hell leuchtenden Schrank sieht sie aus, als wäre sie auf der Intensivstation. Aus der Erde ragen Kabel, an denen ein Spannungsmesser hängt, Schläuche versorgen sie mit Wasser und Sauerstoff. Streng kontrollierte Bedingungen, unter denen David Strick von der Universität Wageningen seine Gräser erforscht. Biomasse.
"Typisch 20 bis 40 Prozent der organischen Stoffe, die eine Pflanze macht, wird in den Boden transportiert. Dort leben Bakterien, die oxidieren die organischen Stoffe, produzieren Elektronen. Wir holen die Energie da raus."
Die Bakterien-Brennstoffzelle
Die Energie rausholen – das schafft David Strik, indem er zwei Elektroden in den Boden steckt. Die eine nimmt die Elektronen der Bakterien auf, die andere gibt sie an Sauerstoff aus der Luft ab und produziert so Wasser. Das Prinzip funktioniert umso besser, je mehr organisches Material die Pflanze in den Boden abgibt. Das tun sie dann, wenn sie unter Druck geraten.

"Was wir auch versuchen, ist, die Pflanzen zu stressen. Zum Beispiel hier das dritte System, da sieht man auch viele braune Stämme. Diese Pflanze wächst noch ein kleines bisschen, die hat noch einen grünen Stamm, aber ist teilweise auch abgestorben. Und auf diesem Weg lässt die Pflanze mehr organische Stoffe in den Boden."
Die Bakterien-Brennstoffzelle funktioniert nur in Feuchtgebieten wie Mooren oder an Küsten. Und die hat der Forscher in seinem Labor nachempfunden. Wer sich vom Schrank aus durch umherwuchernde Pflanzen kämpft, kommt zu einer Kubikmeter großen Tonne voller Erde, Wasser und Gräser. Sie dient dem Forscher als künstliches Ufer. Es gibt sogar eine Pumpe, die für die Gezeiten sorgt. Aus der Erde ragen an manchen Stellen Schläuche – das sind die Elektroden.
"Wir wollen nicht den ganzen Boden kaputt machen. Deswegen haben wir ein neues System entwickelt, das in einen Schlauch hineinpasst. So einen Schlauch kann man hineindrücken, ohne den ganzen Boden kaputt zu machen."
Seit den Anfängen hat David Strik die Effizienz der Brennstoffzelle verfünfzigfacht – doch besonders viel Leistung liefert sie immer noch nicht: Ein Viertel Watt pro Quadratmeter. Das Ziel ist ein halbes Watt. Zum Vergleich: Eine Solaranlage bringt über 200 Mal mehr. Doch mit der will der Forscher gar nicht konkurrieren. Denn Moore und andere Feuchtgebiete sind da und man kann sie nicht mit Solaranlagen zupflastern. Man könnte sagen, dass David Strick damit die Grundidee hinter Energy Harvesting aufgreift. Er findet und nutzt Energie dort, wo sie verfügbar ist, ohne dabei die Umgebung zu sehr zu verändern. Und er denkt in großen Maßstäben. Bisher läuft ein solches System auf dem Dach seiner Universität. Als nächstes könnten sie die Reisfelder erobern.
"Ein Bauer kann dort Reis anbauen, essen und in der gleichen Zeit auch Elektrizität produzieren. Und diese Bauern, die brauchen nicht so viel Elektrizität. Wenn die zehn Quadratmeter haben, dann haben die schon genug für die Lichterzeugung oder für einen Laptop. Das ist eine neue Quelle für Elektrizität. Ich glaube, die Menschen brauchen das und die Natur auch."
Was David Strik macht, ist kein Micro Energy Harvesting mehr. Dafür erntet er einfach zu viel Energie. Mit seiner Ernte kann man größere Geräte mit Strom versorgen. Beim Micro Energy Harvesting ist das nicht vorgesehen.
"Die Frage, ob wir mit Micro Energy Harvesting Kraftwerke ersetzen können, wird manchmal gestellt und ist ziemlich klar mit "Nein" zu beantworten."
Dafür können die Maschinen Energiequellen anzapfen, die bisher unerreichbar waren.
Sven Kerzenmacher:
"Also hier im Labor wird auch mit Bakterien gearbeitet. Deshalb haben wir hier ein biologisches Labor und da ziehen wir uns einen Schutzkittel an. Wir gehen in diese Richtung. Sie sehen hier viele sogenannte Inkubatoren oder Brutschränke stehen. Das sind im Prinzip große Glaskästen, die mit einer Heizung ausgerüstet sind, um die Experimente auf einer gewissen Temperatur zu halten. Und bei den beiden hier sehen sie: Die sind auf etwa 37 Grad, sprich Körpertemperatur."
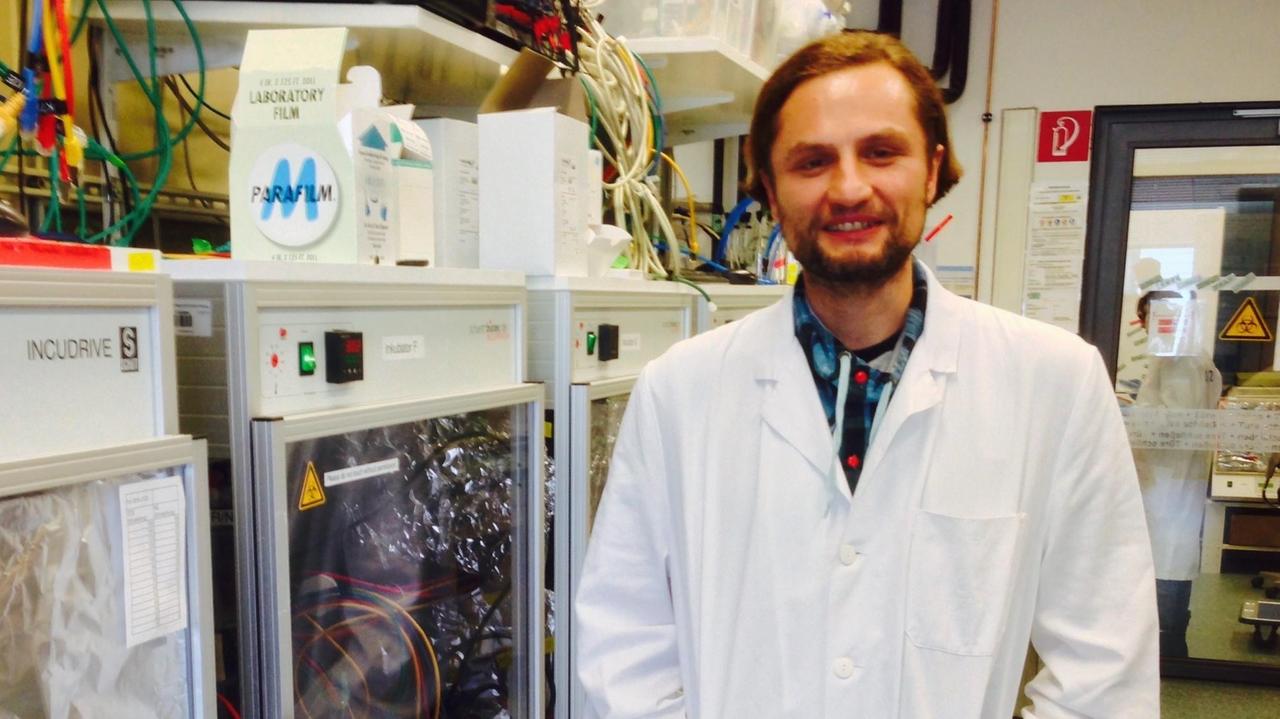
Sven Kerzenmacher geht durch das Labor seiner Arbeitsgruppe an der Freiburger Uni. In den Inkubatoren stehen kleine Plastikgefäße, sogenannte Bioreaktoren. In ihnen hängen je sechs Brennstoffzellen in einer Flüssigkeit mit Glucose und etwas Luftsauerstoff.
"Sie kennen vielleicht das Prinzip einer klassischen Wasserstoff-Brennstoffzelle. An der Anode führt man Wasserstoffgas zu, das Wasserstoffgas wird dann dort oxidiert. Und beim Oxidieren werden Elektronen frei. Und diese Elektronen kann ich dann als elektrischen Strom von der Anode zur zweiten Elektrode, der Kathode leiten. Da kann ich elektrische Energie generieren."
Eine Brennstoffzelle für den menschlichen Körper
Eine solche Brennstoffzelle soll es bald auch für den Körper geben. Der Wasserstoff kommt dann aus der Glucose, also dem Blutzucker. Bereits in den 60ern arbeiteten Forscher bei Siemens an diesem Konzept. Damals produzierte die Firma den ersten implantierbaren Herzschrittmacher.
"Was dann passiert ist, ist, dass die Lithium-Iod-Batterie auf den Markt kam. Das sind die Batterien, die heute noch gebräuchlich sind. Und die haben dann Lebensdauern von acht bis zehn Jahren ermöglicht. Und dann hat man damals gedacht, dass das für die Anwendung ausreichend ist, die Firmen haben die Forschung eingestellt. Und wir haben uns das Mitte der 2000er-Jahre angeschaut. Vor dem Hintergrund, dass es viel mehr Implantate als damals gibt, viel mehr Mikrosysteme werden implantiert."
Seitdem arbeitet Sven Kerzenmacher mit seinem Team an der implantierbaren Glucose-Brennstoffzelle. Im Labor funktionieren die Prototypen bereits.
"Wir stellen uns das so vor, dass wir die Brennstoffzelle auf die Oberfläche des Implantats aufbringen. Wenn Sie das Beispiel Herzschrittmacher betrachten, der ist ungefähr drei Mal drei Zentimeter groß. Die Gehäuseoberfläche sind etwa 20 Quadratzentimeter. Und wir möchten die Brennstoffzelle dort als Beschichtung aufbringen."
Die soll sich aus der Gewebeflüssigkeit mit Glucose versorgen. Doch die Aminosäuren machen Sven Kerzenmacher zu schaffen. Sie setzen sich auf der Brennstoffzelle ab, die Glucose kommt nicht mehr durch.
"Wir haben herausgefunden, dass die Aminosäuren, die am stärksten die Elektrode vergiften oder der Elektrode zusetzen, dass die eine positive Ladung haben. Und was wir zum Beispiel jetzt im Moment ausprobieren: Können wir mit positiv geladenen Membranen diese Aminosäuren von der Elektrode fernhalten über elektrostatische Abstoßung?"
Ideen für Anwendungen gibt es jetzt schon reichlich.
Sven Kerzenmacher:
"Man kann sich zum Beispiel implantierbare Blutdrucksensoren vorstellen, implantierbare Temperatursensoren. Man kann sich das aber auch weiter vorstellen im Hinblick auf eine künstliche Bauchspeicheldrüse. Also ein Mikrosystem, das kontinuierlich den Blutzuckerspiegel misst. Und wenn der Blutzuckerspiegel unter einen gewissen Wert fällt, Insulin dem Körper verabreicht automatisch. So ein System bräuchte auch elektrische Energie."
Ein künstliches Organ also. Peter Woias sieht da noch große Herausforderungen:
"Das Hauptproblem ist zunächst die Schaffung des künstlichen Organs. Und ich denke, dass da auf der biomedizinischen, auf der chemischen Seite, auf der biochemischen Seite noch sehr viele Probleme zu lösen sind, bevor man über Energieversorgung überhaupt nachdenken kann."
Doch man könnte sagen: Wenn die Medizin so weit ist, wird es für die Energieversorgung zumindest ein Konzept geben.
Natürlich stellt sich die Frage: Was wird Energy Harvesting noch bewegen?
"Was, wenn man ein Sensornetz im Körper aufbauen könnte, das den kompletten Kreislauf aufzeichnet? Es würde die Gesundheit rund um die Uhr auf Krankenhausniveau überwachen. Man würde nie wieder unerwartet krank werden. Und man würde nie wieder einen Tumor finden, wenn es schon zu spät ist."
Klingt nach Science Fiction. Und tatsächlich lässt sich nicht nur Smart-Dust-Erfinder Kristofer Pister davon inspirieren. Viele Forscher aus der Energy-Harvesting-Gemeinde kennen die Klassiker des Genres.
"Wenn man Stanisław Lem als Autor nimmt: Er war ein sehr vorausschauender Autor."
Bereits 1964 beschrieb Stanisław Lem Energy Harvesting in seinem Buch "Der Unbesiegbare". Darin macht sich die Mannschaft eines Raumschiffs auf die Suche nach einem verschollenen Schwesterschiff.

"Mit Parallelen zu Lem muss man vorsichtig sein, er beschreibt eine dunkle und angsteinflößende Zukunft."
Die Männer landen auf einem wüstenartigen Planteten, auf dem alles Leben ausgestorben ist. Doch bald werden sie von einer mysteriösen Wolke angegriffen.
"Lem hat sehr viel zu diesen Themen geschrieben. Und er hat im Prinzip als Visionär die Entwicklung von mikroskopischen Einheiten, die sich zu Funktionseinheiten selber zusammenschließen und kommunizieren können, vorhergesagt."
Die Wolke entpuppt sich als Ansammlung winziger Maschinen. Sie stammen wahrscheinlich aus dem Absturz eines Raumschiffes, den nur die Automaten überlebt haben. Die komplizierten unter ihnen waren auf radioaktive Vorräte angewiesen. Die gingen bald zur Neige und mit ihnen gingen die großen Maschinen unter. Es blieben nur einfache, kleine Roboter übrig, die Ihren Strom aus der Umgebung gewinnen: Energy Harvesting als Überlebensgrundlage. Und das schon vor 50 Jahren. Aber wie sieht es mit der Zukunft aus?
"Ein Kollege von mir meint, wir sollten Smart Dust zu anderen Sonnensystemen schicken. Man müsste die Sensoren auf einen vernünftigen Teil der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und die Dinger würden während ihrer interstellaren Reise schlafen. Und irgendwann, wenn sie nahe genug an einer anderen Sonne wären, aufwachen, sich verständigen, wo sie sind, und eine Kommunikation aufbauen."
Natürlich ist das nicht mehr als eine Vision. Aber die kleinen, energieautarken Maschinen haben bereits die Industrie erobert. Sie dringen in unseren Alltag vor und in unsere Körper. Warum sollen sie nicht die letzten Grenzen überwinden? Alles, was sie brauchen, ist ein bisschen Energie.
Regie: Friederike Wigger
Redaktion: Christiane Knoll
Deutschlandfunk 2015
Redaktion: Christiane Knoll
Deutschlandfunk 2015
