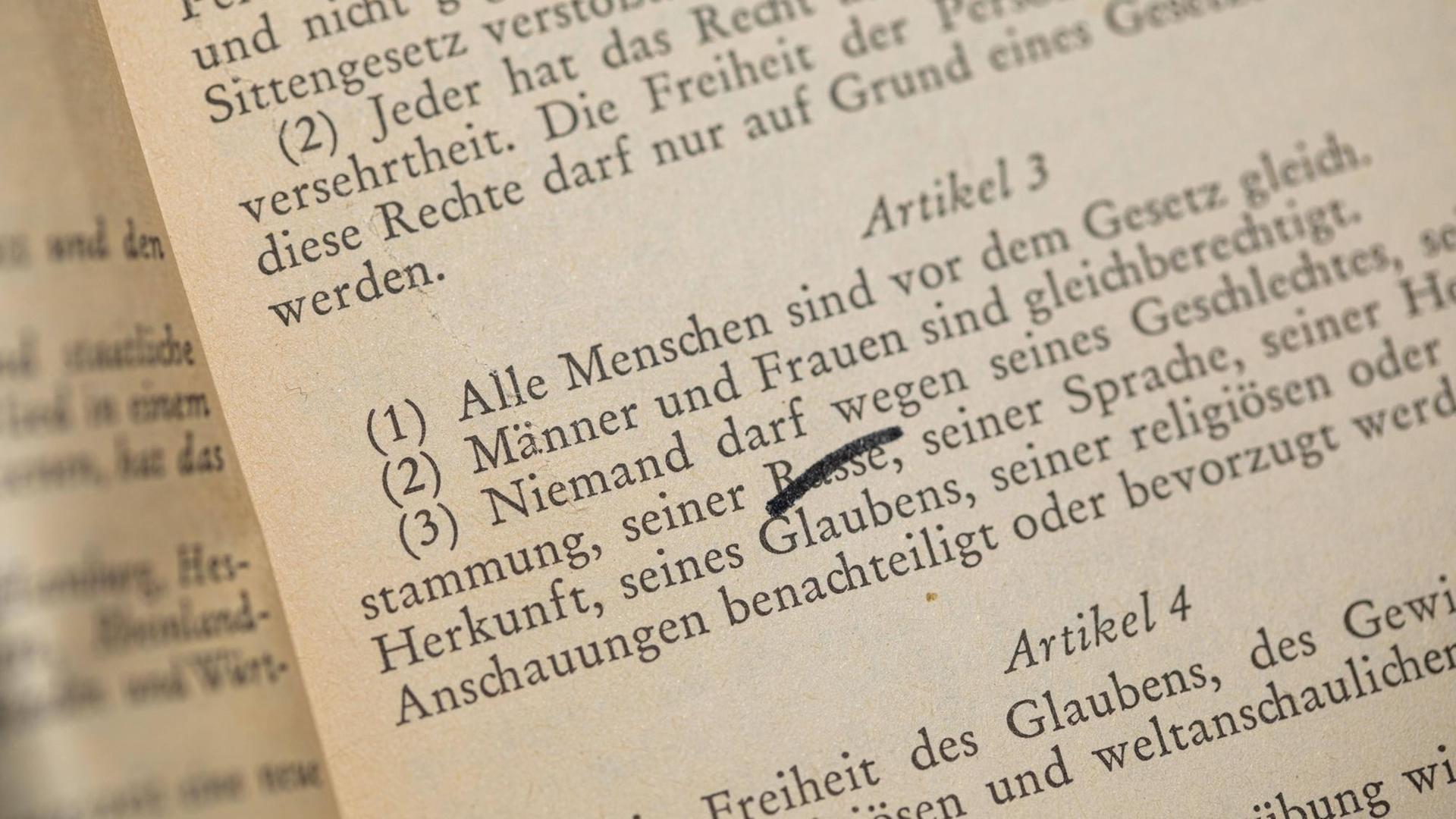"Blackfacing" - auf Deutsch: sich das Gesicht schwärzen - ist ein Begriff aus den USA. Er geht zurück auf die "Minstrel Shows" des 18. und 19. Jahrhunderts und bedeutet, dass sich ein weißer Mensch das Gesicht mit Farbe bemalt, um auf der Bühne eine Figur mit dunkler Haut darzustellen – und sie dadurch abwertet. Die "Minstrel Shows" waren Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen, bei denen oft weiße Musiker die Sprache und den Tanz von Afroamerikanern karikierten – mit schuhcremeschwarz geschminktem Gesicht und grotesk überzeichneten dicken roten Lippen, Gestik und Mimik.
Rassistische Kunstform
Dabei wurden Stereotype bedient: der immer fröhliche Sklave, der seinen Sklaventreiber liebt; der dümmliche, gutherzige schwarze Freund. In den USA wurden diese Shows schon Anfang des 20. Jahrhunderts als rassistisch erkannt. In Großbritannien zeigte man "Minstrel Shows" noch bis in die 1980er-Jahre auch in der öffentlich-rechtlichen BBC. Inzwischen findet "Blackfacing" als Bühnenpraxis in vielen Ländern als rassistische Kunstform nicht mehr statt. In Deutschland ist das erst seit wenigen Jahren der Fall.
Hier gab es zwar keine "Minstrel Shows"; auch das Wort "Blackfacing" ist im deutschen Kulturkreis noch nicht sehr lange bekannt. Die entsprechende, vermeintlich komische Praxis war auf der Bühne oder im Film auch selten mit der erkennbar bösen Absicht verbunden, Menschen nicht-weißer Hautfarbe zu diffamieren. Und doch ist genau das beim "Blackfacing" der Fall. Dass viele Formen von Alltagsrassismus unbewusst geschehen, macht die Sache aber nicht besser.
Debatte um Blackfacing in Deutschland
Auf deutschen Bühnen wurde die Debatte über diese Form von kulturellem Rassismus 2012 durch ein Werbeplakat des Berliner Schlosspark-Theaters für eine anstehende Premiere ausgelöst. Darauf war der weiße Schauspieler Joachim Bliese mit schwarz bemaltem Gesicht, Hals, schwarzen Händen und weit aufgerissenen Augen neben seinem Kollegen Dieter Hallervorden zu sehen. Auch Michael Thalheimers Inszenierung "Unschuld" am Deutschen Theater in Berlin kurz darauf sorgte für Proteste: Zwei Schauspieler traten darin mit karikaturesken roten Mündern und schwarz geschminkten Gesichtern auf.
Auch in Deutschland musste der Kulturbetrieb erst lernen, dass "Blackfacing" - Kunstfreiheit hin oder her - eine herabwürdigende Bühnenpraxis ist. Nicht zuletzt durch die kolonialistische Vergangenheit sind auch hier rassistische Denkmuster im Alltag und auf der Bühne bis heute fest verankert.
Krude Rechtfertigung
Doch was bedeutet das nun für die Praxis: Sollten schwarze Figuren nur noch und ausschließlich mit Schauspielerinnen und Schauspielern schwarzer Hautfarbe besetzt werden? Das ist eine der vielen Fragen, die die "Blackfacing"-Diskussion angestoßen hat. Das Schlosspark-Theater versuchte sich vor acht Jahren damit zu rechtfertigen, man könne keine schwarzen Schauspielerinnen oder Schauspieler ins feste Ensemble aufnehmen, weil es für sie nicht genügend Rollen gebe. Das Theater gestand also ein: Weiße können alles spielen – Schwarze aber nur Schwarze.
Das sollte gerade im Theater, dem Medium der Verwandlungskunst schlechthin, nicht der Fall sein. Umgekehrt kann die Lösung jedoch nicht in der Forderung von Aktivisten liegen, schwarze Figuren gar nicht mehr mit weißen, sondern nur noch mit Spielern dunkler Hautfarbe zu besetzen. Das käme einer anderen Form von Diskriminierung gleich. Innerhalb dieses Debattenknäuels wird das Kind rasch mit dem Bade ausgeschüttet. Im aktivistischen Berlin würde sich momentan wohl kaum eine Theatermacherin trauen, Farbe in jedweder Art auf der Bühne zu benutzen, um Hautfarben zu markieren, und sei es nur ein Strich auf der Wange. Das wiederum beschneidet die Kunstfreiheit.
Keine einfachen Lösungen
Eine einfache oder schnelle Antwort gibt es nicht. Keine Lösung kann jedenfalls sein, einen Vietnamesen nur noch von einem Vietnamesen spielen zu lassen und einen Kongolesen von einem Kongolesen. Am schönsten wäre, die Theaterensembles wären mit Ethnien, Hintergründen, Hautfarben und Geschlechtern so divers vertreten, dass jeder und jede kreuz und quer besetzt werden kann. Damit das äußere Erscheinungsbild, hier also: die Herkunft, ihre Zeichenhaftigkeit verliert. Doch es wird noch eine Weile dauern, bis eine Person of Colour den "Hamlet" spielen kann, ohne dass Zuschauende darin eine inhaltliche Inszenierungsabsicht sehen.
Bis es soweit ist, muss sich jede Regisseurin genau überlegen, ob, wann und wie es überhaupt nötig und möglich ist, eine Herkunft oder Hautfarbe auf der Bühne zu markieren.