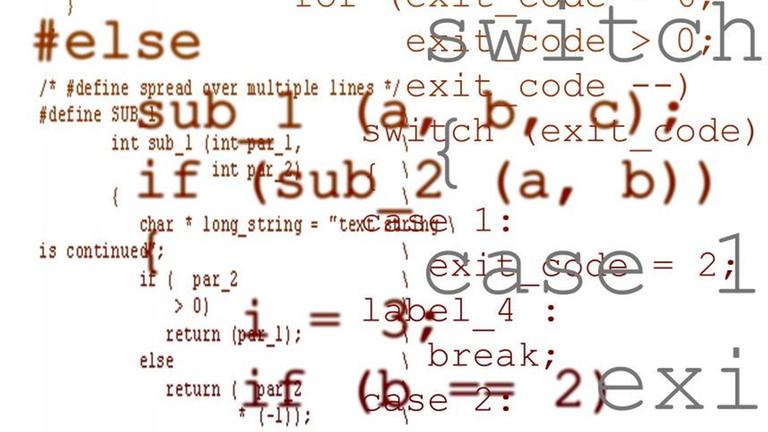Mitten in München, zwischen Odeonsplatz und Universität sitzt eines der wenigen deutschen Einhörner, also ein Start-Up, das mindestens mit einer Milliarde US-Dollar bewertet ist. Es hört auf den Namen Celonis – benannt nach dem griechischen Gott des Strebens, Zelos. Die Münchner sind in einem fünfstöckigen Hinterhofgebäude untergebracht, in dem sie gerade Etage um Etage erobern. Während im Erdgeschoss an diesem Tag 130 neue Mitarbeiter aus aller Welt für die sogenannte Onboarding Week zu Gast sind, sprechen die drei Gründer ganz oben über ihre Idee: eine Software für Process Mining.
„Das ist eine Zukunftstechnologie für die Zukunft der Arbeit und Wertschöpfung in Unternehmen. Worum es bei Process Mining geht, ist, dass in unserem alltäglichen Leben überall Prozesse sind, ob das jetzt im Krankenhaus ist, wo Patienten behandelt werden, oder in der Buchhaltung eines Unternehmens, ob es darum geht, bei einem Supermarkt die Milch in den Kühlschrank zu bekommen und um die ganze Lieferkette. Und diese Prozesse kann man eigentlich immer noch deutlich besser machen.“
Sagt Alexander Rinke. Der Mathematiker mit den neugierigen Augen ist zuständig für die Produktstrategie.
Bestehende Daten nutzen
Dabei macht sich das Unternehmen zunutze, dass viele dieser Prozesse auf Basis computerisierter Systeme ablaufen. Und diese generieren Daten. Genau dort dockt Celonis mit seiner Software an, extrahiert und analysiert die Daten, und zeigt, wo etwas schiefläuft und wie sich Probleme beheben lassen. Der 30-Jährige öffnet ein Fallbeispiel auf seinem Laptop. Ein senkrechter, dicker blauer Strich unterbrochen von Rauten, die Teilschritte eines Prozesses darstellen, taucht auf.
„Was wir hier sehen, ist ein Einkaufs- und Versorgungsprozess aus dem Krankenhaus. Dieses Krankenhaus hat in einem Jahr über 104.000 Waren bestellt. Die häufigste Variante dieses Ablaufs ist: Das Krankenhaus braucht einen Artikel, schickt eine Bestellung ab, der wird rechtzeitig geliefert und angewendet. Da läuft alles wie geschmiert. Allerdings hat das System auch knapp 700 Abweichungen von diesem Ablauf gefunden und mit Celonis kann ich mir jede einzelne der Abweichungen anschauen.“
Hohes Einsparpotential durch die richtige Datenanalyse
Alexander Rinke klickt und eine weitere mit dem Hauptstrang verbundene Raute erscheint. Die Analyse zeigt: In 6.281 Fällen bekommt das Krankenhaus den falschen Artikel geliefert. Noch ein Klick mehr und es öffnet sich eine Liste. Darin ist dokumentiert, bei welchem Lieferanten das Problem am häufigsten auftritt. Um dieses künftig zu verhindern, kann die Software nun automatisch den Lieferanten benachrichtigen oder per Alarm rechtzeitig die zuständige Abteilung erinnern. Die Daten sind fiktiv, aber hätte das Krankenhaus alle ermittelten Abweichungen behoben, hätten 167 Millionen Euro eingespart werden können. Die vermiedene Mehrarbeit nicht einberechnet.

Was theoretisch hinter Process Mining steckt, erklärt Martin Klenk. Der hochgewachsene, gelassene Mitgründer ist Leiter der Softwareentwicklung.
„Die Technik an sich beschäftigt sich in erster Linie damit: Ich habe ein Event-Log. Dort steht drin, was ist passiert und wann ist das passiert. Und wie kann ich auf Basis von den Informationen ein Modell erstellen und das Modell verbessern. Wenn wir aber bei unseren Kunden schauen, was sie zusätzlich wissen wollen: Die wollen wissen, welche Materialien waren davon betroffen, welche Lieferanten waren betroffen. Die wollen sich vielleicht die komplette Lieferkette anschauen. Und das ist, würde ich sagen, unser Beitrag, dass wir sehr viel Kontext an die Daten fügen. Und die wissenschaftliche Herausforderung geht normalerweise sehr in Richtung, welche Qualität hat mein Modell.“
Studentisches Projekt als Keimzelle
Erfunden hat Celonis Process Mining nicht. Die Theorie wurde um das Jahr 2000 vom niederländischen Professor Wil van der Aalst erdacht. Darauf gestoßen sind Martin Klenk und seine zwei Mitstreiter bei einem studentischen Projekt für den Bayerischen Rundfunk. Der Sender hatte angefragt, wie sein IT-Servicemanagement verbessert werden könnte. Nach einigem Experimentieren und Anpassen fanden die drei eine datenbasierte Lösung, woraus schließlich der Prototyp entstand.
„Das, was dann dazu geführt hat, dass wir drei gesagt haben, ja, das ist eine gute Idee und wir wollen das auch als Unternehmen vorantreiben, war, dass alle, denen wir das gezeigt haben – egal, aus welchem Bereich sie kamen – extrem begeistert waren. Weil es einfach Wissen war, wie die eigene Firma eigentlich funktioniert, was ihnen davor noch nie jemand gezeigt hat. So ist es dann gekommen, dass wir uns entschieden haben, wir machen ein Produkt daraus und gehen damit an den Markt.“
Danach ging es Schritt für Schritt, Projekt für Projekt weiter. Zusätzlich vertrauten große Firmen dem 2011 gegründeten Start-up in der frühen Phase. Heute benutzen bekannte Mittelständler wie auch Weltkonzerne die Software. Mehrere 100 Apps für alle möglichen Prozesse haben die Münchner im Angebot – vom Einkauf über die Lieferung bis hin zur Rechnungsstellung. Auf die Frage, was sie mit den 250.000 Euro Preisgeld des Deutschen Zukunftspreises anstellen würden, sagt Bastian Nominacher, zuständig für die Gesamtstrategie im Unternehmen:
„Erst mal muss man gewinnen, und deshalb ganz ehrlich: Wir haben da noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das Wichtigste ist vor allem die Anerkennung für unser Team, weil wir immer den Horizont des Machbaren erweitern wollen. Und das geht nur, wenn jeden Tag viele Celonauten aufstehen und das vorantreiben.“