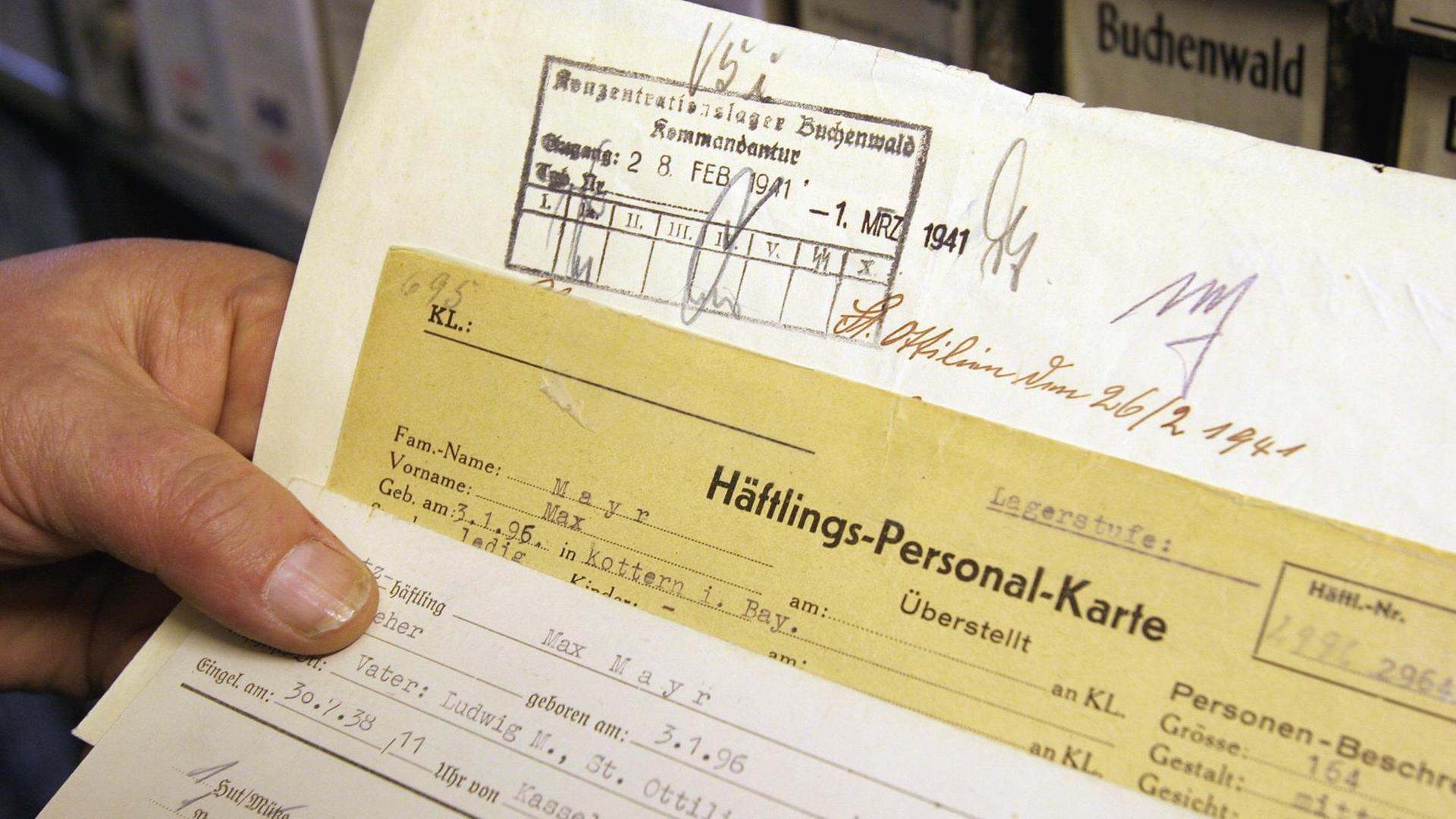Jüdisch sein im Schatten des Holocaust und der Menschlichkeit – das sind Themen, die Peter Pogany-Wnendt begleiten. 1954 wurde er in Budapest geboren. Seine jüdischen Eltern hatten nur knapp die Verfolgung der Nazis überlebt, viele Angehörige wurden ermordet – ein Verlust, der die Familie tief prägte. 1956 flohen seine Eltern mit dem Zweijährigen während des ungarischen Volksaufstands nach Chile, 1970 dann, aus Angst vor der linken Regierung unter Salvador Allende, nach Deutschland. Nach seinem Abitur studierte Peter Pogany-Wnendt Medizin und ließ sich zum Facharzt für Psychiatrie ausbilden. Als er seine Frau Ute 1979 kennenlernte, begann er, sich intensiv mit seiner jüdischen Identität auseinanderzusetzen.
Doch mit der Frage, was die für ihn als nicht religiöser Mensch nach dem Holocaust eigentlich bedeuten könnte, fühlte er sich lange allein, bis er 1995 – und nach einer Ausbildung zum Psychotherapeuten – endlich auf Gleichgesinnte stieß, die wie er den Nachwirkungen des Nationalsozialismus in ihren Familien nachspürten. Bald war der Arbeitskreis für intergenerationelle Folgen des Holocaust (PAKH) geboren, dessen Vorsitzender Peter Pogany-Wnendt heute ist. Hier sprechen Kinder von Verfolgten, aber auch Kinder von Tätern und Mitläufern über ihre Familiengeschichte und suchen den Austausch. Mittlerweile sind auch Enkel und Urenkel dabei. Peter Pogany-Wnendt hat eine erwachsene Tochter und lebt mit seiner Frau in Köln.

Melanie Longerich: Sie wurden 1954 in Budapest geboren, da war Ungarn seit fünf Jahren Volksrepublik und neun Jahre war der Holocaust vorbei, der Ihre Familie tief geprägt hat. Wie war die Familie, in die Sie hineingeboren wurden, was beschäftigte sie, war sie religiös?
Peter Pogany-Wnendt: Na ja, wie Sie gerade gesagt haben, der Holocaust war gerade mal neun Jahre vorbei, und insofern lebte meine Familie natürlich unter dem Eindruck des Holocaust, sowohl aufseiten meines Vaters wie aufseiten meiner Mutter. Denn neun Jahre sind keine besonders lange Zeit, um die Schrecken des Holocaust natürlich zu verarbeiten. Insofern bin ich in eine gar nicht religiöse, aber doch ja die jüdischen Traditionen einigermaßen einhaltende Familie hineingeboren, aber die waren sehr vom Holocaust in erster Linie geprägt. Das war das eine. Mein Vater hatte ja seine Eltern gerade mal neun Jahr vorher im Alter von 19 Jahren verloren, die sind umgebracht worden. Er selbst war im Arbeitslager, das heißt, er war traumatisiert im Grunde genommen. Er hat dann meine Mutter '53 geheiratet. Und auf der anderen Seite hatte ich eine Mutter sozusagen, die den Holocaust dadurch überlebt hat, im Alter von 13 Jahren, indem sie sich gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester auf dem Land versteckt hat. All diese Erfahrungen waren natürlich, als ich geboren wurde, nicht vorbei. Hinzu kam natürlich, dass nach dem Krieg Ungarn ja unter der sozialistischen kommunistischen Herrschaft geblieben ist. Mein Großvater hatte vor dem Krieg und auch nach dem Krieg eine sehr große Fabrik, eine Textilfabrik, mein Großvater mütterlicherseits. Und nach dem Krieg galt er als Kapitalist für die Russen, für die Kommunisten. Und insofern wurde er wieder verfolgt, wenn man so will – viele Kapitalisten sind tatsächlich in russische Lager gekommen. Mein Großvater durfte offenbar in seiner eigenen Fabrik, die natürlich enteignet wurde, aber er durfte da als Direktor bleiben, angeblich weil er als Fachmann, als Chemiker besonders gut war in seinem Fach.
"Aber wo wollte man nach dem Krieg hingehen, also wo gab es keinen Antisemitismus?"
Longerich: Nach diesen ganzen traumatischen Erlebnissen, warum sich Ihre Eltern dann dazu entschieden, trotzdem erst einmal in Budapest zu bleiben? Da muss doch auch alles an die getöteten Eltern Ihres Vaters erinnert haben.
Pogany-Wnendt: Ja, ich glaube, dass das für meine Eltern, damals zumindest, nicht infrage gekommen ist, weil meine Eltern fühlten sich im Grunde genommen – und meine Großeltern auch – auch als Ungarn, auch wenn sie jüdisch waren. Wissen Sie, ich meine, natürlich gab es in Ungarn Antisemitismus und es gab Pogrome, aber wo sollte man als Jude nach dem Krieg hingehen, also wo gab es keinen Antisemitismus, frage ich so herum. Ungarn war immer ein Land, wo es immer Antisemitismus gegeben hat, aber wo die Juden sich immer irgendwie, auch während des Krieges, relativ gut arrangiert haben mit dem Land und mit der Bevölkerung sozusagen.
Longerich: 1956, da gingen Ihre Eltern trotzdem dann mit Ihnen, da waren Sie zwei Jahre alt, und '56 war der Ungarn-Aufstand und Ihre Eltern hatten Angst vor den politischen Entwicklungen in Ungarn und gingen mit Ihnen nach Chile. Warum gerade Chile?
Pogany-Wnendt: Na ja, wir sind aus Ungarn geflüchtet unter der sicherlich dramatischen Situation wie damals ungefähr 200.000 Flüchtlinge. Meine Eltern sind ungefähr zwei Wochen vorher alleine weggegangen, weil nachdem sie zweimal versucht hatten, mit mir zusammen als zweijähriges Kind zu flüchten und das nicht gelungen ist und ihnen fast das Leben gekostet hätte, da haben die entschieden, erst mal alleine wegzugehen. Ich muss auch sagen, meine Mutter war zu der Zeit auch schwanger. Zwei Wochen später bin ich mit meinen Großeltern rausgegangen. Und haben uns versteckt, unter Zügen uns versteckt. In Chile gab es einen Großteil der Familie. Mein Großvater mütterlicherseits, der Kapitalist sozusagen, der hatte sechs Geschwister. Und vier davon waren schon in den 20er-Jahren nach Südamerika ausgewandert, sodass in Chile vier Geschwister meines Großvaters lebten. Und die konnten uns sozusagen helfen. Wir hatten mehr oder weniger nur die Kleider, was wir am Leib hatten, aber ansonsten nichts.
Longerich: Nach außen sieht das ja jetzt erst mal aus wie ein Neuanfang, der vielleicht auch einfacher war, weil es Familie gab, anderer Kontinent, andere Sprache. Und trotzdem nahmen Ihre Eltern ihr Inneres und ihre Geschichte ja mit. Können Sie sich noch daran erinnern, also war der Holocaust bei Ihnen zu Hause Thema, also versuchten Ihre Eltern, mit Ihnen darüber zu sprechen? Oder war das eher so, dass sie Sie und Ihren Bruder, der ja dann auch geboren wurde in Chile, lieber schützen wollten, indem sie das vielleicht verschwiegen haben?
Pogany-Wnendt: Der Holocaust war nie, wie soll ich sagen, es war kein Geheimnis. Meine Eltern haben mir immer die Geschichten erzählt. Die Geschichte meines Vaters, der im Arbeitslager war, der dann zu Fuß, nachdem die Partisanen das Arbeitslager Bor – das war eine Kupfermine in Jugoslawien –, und nachdem das befreit wurde, mein Vater musste mehr oder weniger zu Fuß zurück nach Budapest. Und dann entdeckte er, dass seine Eltern schon nicht mehr lebten, getötet waren, nur seine Großmutter lebte. Auf der anderen Seite mehr oder weniger eine Heldengeschichte, wie man Großvater es geschafft hat, mit viel Geschick, aber auch mit Glück sicherlich, seine Familie zu retten, indem er sich versteckt hat. Diese Geschichten wurden mir immer erzählt. Insofern wusste ich von Anfang an, dass es den Holocaust und die Verfolgung gegeben hat. Aber das Interessante ist, dass in diesen Geschichten wurde eben vieles nicht erzählt, die Dramatik, die Schrecken, zum Beispiel in dieser Zeit, wo sie sich versteckt haben. Das hab ich viel später durch meine Tante erfahren. Das heißt, ich wurde da gleichzeitig geschont, meine Eltern haben sich selbst wahrscheinlich verschont, also von ihrem eigenen Schmerz, aber es war immer Thema in der Familie. Es lag immer so eine dunkle, so eine etwas dumpfe Atmosphäre, wo meine Großeltern so als eine Art Geister oder Gespenster – also die ermordeten Großeltern.
"Die Traurigkeit meines Vaters, die Ängstlichkeit meiner Mutter"
Longerich: Sie haben auch einmal beschrieben, dass Sie alles getan haben, um ein gutes Kind zu sein, so haben Sie es formuliert, weil Sie instinktiv Ihr Möglichstes versuchten, um diese Verletzungen zu heilen. Das ist ja jetzt eine ziemlich große Aufgabe für ein Kind – wie hat Sie diese Aufgabe geprägt?
Pogany-Wnendt: Na ja, ich sag' mal so, ich habe mir diese Aufgabe natürlich nicht ausgesucht, sondern ich denke – und das sind alles Erklärungen, Dinge, die ich später, viel später verstanden habe –, dass ich als Kind natürlich die Traurigkeit meines Vaters, die Ängstlichkeit meiner Mutter, all diese unterschwelligen, zum großen Teil unterschwellig, aber zum Teil auch offenen Gefühle natürlich gespürt und gesehen habe. Und ich mehr oder weniger instinktiv angefangen habe, zum Beispiel meinem Vater immer wieder irgendwas Gutes zu tun. Er hatte immer ein relativ trauriges Gesicht. Und immer wieder wurde mir erzählt, er ist deswegen so traurig, weil er seine Eltern verloren hat. Dadurch versuchte ich ja eben, ein gutes Kind zu sein, also keine großen Schwierigkeiten… Ich war relativ gut in der Schule, ich war immer einer der Besten, schon in der Grundschule, obwohl ich da zum Teil auch viel Mist auch gebaut habe und immer wieder vom Unterricht ausgeschlossen wurde. Und als Strafe in eine dunkle Garage eingesperrt wurde, weil ich immer wieder gestört habe. Die Erklärung meiner Mutter war, ich war so intelligent, dass ich alles so schnell kapiert habe, und dann hab ich mich gelangweilt. Aber auch meine Mutter, diese Ängstlichkeit, sie machte aus Kleinigkeiten irgendwelche große Katastrophen. Und ich versuchte immer zu beschwichtigen. Das sind alles Dinge, die ich als Kind versucht habe, instinktiv zu machen, um meine Eltern irgendwie glücklich zu machen. Wobei ich dazu sagen muss, dass natürlich der Holocaust eine wichtige Rolle gespielt hat, aber die aktuelle, die reale Situation, in der meine Eltern lebten – als Flüchtlinge, Neuanfang und so weiter –, das natürlich eine sehr belastende Situation war, die sehr viel von mir verlangte sozusagen als Kind an Anpassung.
Longerich: Aber Ihr Vater, hat der sofort eine Stellung dann in Chile gefunden? Er war ja Arzt.
Pogany-Wnendt: Mein Vater war Arzt, er war Facharzt für Gynäkologie. Er musste in Chile – sein Titel wurde ihm nicht anerkannt, er musste erst die Sprache lernen, und dann musste er seinen Titel praktisch neu machen. Das hat ungefähr bis 1960 gedauert. Er hat eine Anstellung bekommen in einer kleineren Stadt südlich von Santiago – die Stadt Rancagua, so hieß das, eine Stadt von ungefähr 90.000 Einwohnern. Und dort hat er erst mal als Arzt gearbeitet, aber er musste ohne sozusagen einen validen Titel zu haben. Erst 1960 hat er seinen Titel bekommen, das heißt, wir mussten eine ganze Existenz erst mal aufbauen. Abgesehen davon, dass wir einfach die Kultur nicht kannten oder meine Eltern zum großen Teil nicht. Mein Vater hat sich in Chile eigentlich nie wirklich ganz heimisch gefühlt.
Longerich: Ihre Eltern haben erlebt, wie schmerzhaft es ist, benachteiligt und verfolgt zu werden, und diese Erfahrung sollten Sie und Ihr Bruder ja nicht machen. Sie sollten zwar schon Jude sein, allerdings – so haben Sie es einmal formuliert – ohne sich zu erkennen zu geben, Jude im Geheimen also, aber so richtig daran gehalten haben Sie sich doch nicht, oder? Da gab es ja auch diese jüdische Jugendbewegung, in der Sie waren, können Sie uns das mal erzählen?
Pogany-Wnendt: Ja, ((man muss?)) es unterscheiden. In Chile war es natürlich klar von Anfang an, dass wir Juden sind, da haben meine Eltern das sofort gesagt, weil natürlich ein Großteil der Familie dort war. In dieser Stadt, in Rancagua, gab es ein paar, eine Handvoll Juden, die uns auch geholfen haben ganz am Anfang. Insofern konnte ich das nicht verstecken, dass ich Jude bin. Allerdings hatten meine Eltern nach dem Holocaust ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Judentum. Sie waren Juden, sie hatten viel gelitten, weil sie Juden waren, deswegen konnten sie das nicht so ohne Weiteres leugnen. Aber auf der anderen Seite empfanden sie das irgendwie als so eine Art Makel. Und sie hatten auch immer Angst vor erneuter Verfolgung. Deswegen hätten sie es am liebsten gehabt, wenn ich und mein Bruder später mit dem Judentum wenig oder gar nichts zu tun haben. Ich bin zum Beispiel auch nicht beschnitten worden, mein Bruder auch nicht, also ich sollte nicht daran erkannt werden. Später – wir sind 1965 nach Santiago gegangen –, da bin ich diese Organisation Makkabi gekommen, da war ich ungefähr zwölf, 13 Jahre, durch einen Cousin von mir, das war eine zionistische Organisation. Und da habe ich natürlich eine andere Form des Judentums, einen besonderen Stolz darauf, jüdisch zu sein, kennengelernt, die mich natürlich auch auf der anderen Seite geprägt hat. Meine Eltern haben es mir nicht verboten, aber sie haben es immer sehr ängstlich angeschaut.
Longerich: Aber Sie haben es dann trotzdem gemacht. Und Sie haben mal erzählt, Sie mussten da ganz viel Wache schieben und auch mit dem Stock kämpfen lernen. Wie sah es aus mit Antisemitismus in Chile?
Pogany-Wnendt: Es gab im Sommer immer ein Sommerlager. Und in Chile – ich meine, wir reden von der Zeit um 1967, also der Sechstagekrieg in Israel –, in Chile gab es damals, und ich glaube bis heute noch, einen relativ starken Antisemitismus. Damals gab es auch Übergriffe auf jüdische Gebäude, auf jüdische Institutionen und so weiter. Vor allem von Arabern, denn gut, Araber und Israelis oder Juden waren damals im Krieg. Das heißt, die jüdischen Institutionen, das war ja nicht so damals wie hier, dass sie alle unter Polizeischutz genommen worden sind, sondern die Juden mussten sich in Chile einfach selbst zur Wehr setzen. Und in diesem Sommerlager gab es einen Platz in der Mitte, wo auch die Flagge sozusagen gehisst wurde tagsüber, die israelische Flagge, und nachts – ich war damals 13, 14 Jahre alt – musste man mit einem Stock, mit einem Messer in der Hand und einer Pfeife Wache schieben zu zweit. Weil wenn ein Angriff kommen sollte, musste man dann laut pfeifen, damit alle anderen rauskommen und wir uns zur Wehr setzen. Es gab einen gewissen Plan sozusagen bei einem Angriff, wer was zu tun hat. Ja, das hört sich nach Abenteuergeschichten an, aber es war ernst, denn einmal – ich war allerdings nicht da – ist tatsächlich ein Jeep mit einem Maschinengewehr reingefahren. Und die wurden dann überwältigt von den Älteren in dem Lager. Also es war Abenteuer, aber es war auch ernst.
Longerich: Aber diese neue selbstbewusste Haltung, die Sie da ja gegenüber dem Judentum in dieser Organisation erlebt haben, Makkabi Hazair hieß sie, war ja jetzt was ganz anders, als was Ihre Eltern Ihnen vermittelt haben, nämlich das Jüdischsein eher nicht so zu betonen. Es muss doch auch dann zu Konflikten gekommen sein.
Pogany-Wnendt: Ich war damals in der Pubertät, im heranwachsenden Alter. Das waren vielleicht die ersten Ansätze, wo ich angefangen habe, gegen meine Eltern ein bisschen so im Verborgenen zu rebellieren, indem ich mich da durchgesetzt habe und mich von den Ängsten meiner Eltern nicht hab unterdrücken lassen sozusagen. Ich glaube, dass meine Eltern insgeheim auch stolz darauf waren, das ist ja immer diese Ambivalenz. Nach außen hatten sie Angst, aber irgendwie waren sie ja doch stolz, dass ich da hingegangen bin. Das waren sozusagen die ersten Versuche, seine eigene Haltung auch in dieser Frage zu bekommen, die nicht nur geprägt war vom Holocausterleben, von der Angst meiner Eltern.
"Meine Eltern hatten Angst, wieder in einer kommunistischen Gesellschaft leben zu müssen"
Longerich: Im Herbst 1970 änderte sich dann wieder Ihr Leben komplett, nämlich da gewann Salvador Allende in Chile die Präsidentschaftswahl. Er wollte ja auf demokratischem Weg eine sozialistische Gesellschaft etablieren. In Lateinamerika wurde er dafür als großer Hoffnungsträger gefeiert. Für Ihre Eltern bedeutet das eher das Gegenteil, sie hatten große Angst und packten wieder die Koffer mit Ihnen und Ihrem Bruder und zogen nach Deutschland.
Pogany-Wnendt: Wir lebten mitten in der Stadt, ungefähr fünf Straßen vom Präsidentenpalast. Und tagtäglich, also vor den Wahlen, gab es bürgerkriegsähnliche Zustände. Mein Eltern hatten natürlich Angst, als Allende gewählt worden ist. Er ist zunächst mal gewählt worden, aber er hatte nicht die absolute Mehrheit. Meine Eltern hatten natürlich Angst, wieder in einer kommunistischen Gesellschaft leben zu müssen, deswegen hatten die schon vorher überlegt, also wenn Allende gewinnt, zu überlegen, woanders hinzugehen. Wir sind im September dann weggegangen, wir waren in Buenos Aires, mehr aus der Angst heraus, da könnte ein Bürgerkrieg entstehen. Meine Eltern haben versucht, in Amerika, in Australien, in anderen Ländern ein Visum zu bekommen, das ist nicht gelungen. Und durch viele Zufälle ergab sich die Situation, dass man meinem Vater den Tipp gegeben hat – ich glaube, meine Großmutter hatte ihm den Tipp gegeben –, warum versuchst du es nicht in Deutschland. Und zwar deswegen, weil mein Vater Deutsch konnte …
Longerich: Warum?
Pogany-Wnendt: Ja, weil sein Vater ist in [unverständlich] groß geworden, gehörte zum Burgenland, und die sind zu einem Teil in einer deutschen Tradition groß geworden, und dadurch ist mein Vater mit Deutsch groß geworden und auch meine Mutter. Jetzt war es so, dass meine Großmutter sagte, ja, warum nicht nach Deutschland, da kannst du die Sprache, da kannst du vielleicht direkt arbeiten. Mein Vater war erst mal völlig außer sich, nach Deutschland konnte er sich gar nicht vorstellen. Aber dann haben die ihm gesagt bei der Botschaft, ja, wenn er hierherkommt und sich eine Stelle sucht, dann könnte er auch hier vermutlich arbeiten. Und so ist er hier nach Deutschland gekommen und hat tatsächlich eine Stelle als Oberarzt in einem Krankenhaus in der Nähe von Aachen, in Bardenberg, bekommen. Und so sind wir dann nachgerückt im Dezember 1970.
"Ich hatte keine großen Probleme, mich hier einzuleben"
Longerich: Das ist ja wahrscheinlich nicht gerade das, was man so als 16-Jähriger so mitten in der Pubertät gebrauchen kann, oder? Die Freunde weit weg, dann auch noch ausgerechnet Deutschland, mit all diesen Familiengeschichten im Kopf. Können Sie sich noch daran erinnern, an dieses Land, das auf einmal Ihr Zuhause sein sollte, wie das auf Sie wirkte?
Pogany-Wnendt: Ich hatte im Vorfeld, als die Rede davon war, dass wir auswandern würden, wenn Allende gewinnt, da hatte ich relativ große Angst, meine Freunde dort zu lassen und so weiter. Aber als ich hier in Deutschland war, war merkwürdigerweise eine ganz andere Erfahrung für mich. Ich hatte keine großen Probleme, mich hier einzuleben. Ich hab im ersten Jahr zum Beispiel genossen, weil ich meine, Chile war damals ja ein relativ armes Land. Und viele Dinge kannte man da nicht. Man kannte diese Supermärkte, was weiß ich, diesen Luxus, diese Einkaufsmöglichkeiten, was wir hier in Europa, in Deutschland haben, davon haben wir nur geträumt als Jugendliche. Wir haben immer im Fernsehen gesehen, wie es in Europa, in Amerika, in der USA aussieht – Kaugummis, ganz blöde Sachen oder bunte Filzstifte. Wenn Eltern zum Beispiel aus Europa zurückkamen und Filzstifte als Geschenk brachten, das war wie ein Wunder. Und plötzlich war ich hier, genau in diesem Land meiner Träume und hatte das alles. Und ich habe das, muss ich sagen, in dem ersten Jahr sehr genossen, obwohl die andere Seite war, dass Deutschland für mich immer, wie soll ich sagen, das personifizierte Böse war – nicht durch den Holocaust, das war auch eine Vorstellung von Deutschland, aber als ich hier war, habe ich mich relativ schnell sowohl in der Schule als auch in meinem allgemeinen Leben… Ich meine, ich hatte eine chilenische Mentalität, relativ offen, ich habe Leute kennengelernt. Und dann bin ich sofort zu denen nach Hause gegangen, so wie sich das in Chile gehört. Und dadurch habe ich relativ schnell Kontakt bekommen, sodass ich diese Phase nicht als eine, wie soll ich sagen, traumatisierende oder besonders schwierige, sondern als eine spannende Phase erlebt habe. Nach etwa einem Jahr änderte sich langsam die Sache, da fing ich an, viele Dinge kritischer zu sehen. Und dann hatte ich eine längere Phase, wo ich eine lange Sehnsucht hatte wieder zurück nach Chile. Das dauerte ungefähr bis 1979, wo ich tatsächlich in Chile war für sechs Wochen und dort die Erfahrung machen musste, dass ich mich so geändert hatte, dass ich auch in Chile nicht mehr hinpasste. Chile war vom Moralischen her, von der Art und Weise, wie man mit Jugendlichen umgeht, ein viel weniger freies Land, als was ich hier… Ich meine, in den 70er-Jahren die Jugendbewegungen, die langen Haare, die Rockmusik, die sexuelle Befreiung und so weiter. Alles das war in Chile viel, viel weniger fortgeschritten. Da merkte ich, ich kann in Chile auch nicht leben. Und da konnte ich mich eigentlich ganz gut damit abfinden, dass ich hier Deutschland bleiben werde.
Longerich: Wie ging es dann mit Ihrem Jüdischsein weiter? In Chile, also in der Jugendorganisation, hatte man Ihnen eine stolze, heldenhafte Einstellung zum Judentum vermittelt, das haben wir schon gehört. Aber in Deutschland, wie reagierten da die Klassenkameraden? Das war ja jetzt wahrscheinlich nicht so Thema.
Pogany-Wnendt: Na ja, ich war am Anfang sehr rebellisch. Ich bin am ersten Tag in die Schule gegangen und habe lauthals gesagt: Ich bin Jude. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe das erzählt. Und, tja, mein Vater ist ausgeflippt. Er war ziemlich böse.
Longerich: Im Land der Täter, oder warum?
Pogany-Wnendt: Im Land der Täter, und die hatten Angst vor Verfolgung – wobei ich denke, dass das vielmehr das Subjektive, das Innerseelische der Grund war als das Faktische, Objektive. Dann bin ich am nächsten Tag in die Schule gegangen, und dann habe ich gesagt, na ja, das mit dem Juden, das wäre ein Missverständnis gewesen, das wäre ja gar nicht so, ich wäre kein Jude. Und so habe ich dann akzeptiert im Grunde genommen, weil ich gespürt habe, dass meine Eltern wirklich in einen Angstzustand gekommen sind, dass ich auch mein Jüdischsein für die nächste Zeit werde verstecken müssen. Und ich muss auch sagen, in dieser Zeit hat mich die Frage auch gar nicht so sehr bewegt, weil ich hatte Frauen im Kopf, ich hatte Beziehungen, ich hatte Musik, ich hatte Freunde. Und all diese Dinge haben mich viel mehr beschäftigt als mein Jüdischsein.
Longerich: Mitte der 70er-Jahre begannen Sie zu studieren in Münster, Medizin wie auch Ihr Vater. War das für Sie von Anfang an klar, dass Sie diese Familientradition weiterführen wollen?
Pogany-Wnendt: Ich denke, dass sicherlich der Einfluss von meinem Vater bewusst unbewusst gewesen ist, weil ich eine Zeit gezögert hab. Ich habe mich nach dem Abitur sehr viel mit Philosophie auseinandergesetzt, mit Camus, mit Kafka und solchen Dingen. Und wollte auch Philosophie studieren. Aber dann hab ich gleichzeitig den Platz für Medizin bekommen und habe dann doch mich für Medizin entschieden. Allerdings gab es diesen versteckten Wunsch, glaube ich, von meinem Vater, dass ich irgendwann natürlich seine Praxis, die er dann später '72 in Duisburg-Walsum eröffnet hat – dass ich vielleicht seine Praxis eröffne, aber das war eine Zeit, wo ich ja wirklich offen gegen meine Eltern rebelliert habe und mich abgegrenzt habe.
Longerich: Wie sah das aus, hatten Sie dann keinen Kontakt mehr oder gabׄ’s viel Streit oder wie rebellieren Sie?
Pogany-Wnendt: Ja, ich war zehn Jahre lang nicht beim Friseur zum Beispiel und ich hab Fußball gespielt und hatte ein Stirnband – alles das sind Dinge, die heute vielleicht… Aber damals war das ja schon, es war immer Gesprächsthema. Und auch was das Berufliche, dass ich sehr früh schon in der Schule… Unser Pädagogiklehrer hat uns die Psychoanalyse beigebracht, und ich hatte von Anfang an einen Draht dazu, sodass ich zwar Medizin studiert habe. Aber für mich war es irgendwie klar, dass ich Psychoanalytiker werde, und das war etwas, was mein Vater überhaupt nicht verstehen konnte.
Longerich: Wieso nicht?
Pogany-Wnendt: Ja, weil er mit Psychokram, sag ich mal, überhaupt nichts anfangen konnte. Er war ja wie gesagt ein Gynäkologe, Geburtshelfer, er war Chirurg, also alles, was so handfest ist. Aber was mit der Psyche, das konnte er überhaupt nicht verstehen. Und das war auch eine Form der Abgrenzung, also eine Kompromisslösung, wenn man so will. Ich habe Medizin gemacht, habe ihm den Gefallen sozusagen getan. Ich habe es auch nicht bereut, aber bin einen ganz anderen Weg gegangen, als was er sich gewünscht hätte.
"Vater hat mir seine Zustimmung zugenickt!
Longerich: Im Studium lernten Sie auch Ihre Frau Ute kennen, die sich zwar sehr für das Judentum interessiert hat, aber selbst keine Jüdin war. 1985 haben Sie dann auch geheiratet, und Ihnen wurde klar – so jedenfalls haben Sie das einmal geschrieben –, dass sie Ihre jüdischen Wurzeln nicht länger verstecken wollte. Warum gerade dann?
Pogany-Wnendt: Na ja, bis dahin ging es nur um mich, aber wir haben geheiratet, und zumindest hab ich in Erwägung gezogen, dass ich auch Familie, Kinder haben will. Für mich war wirklich die Frage, sollen meine Kinder ihr Judentum auch verstecken. Und ich habe lange hin und her gerungen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich das offenlegen werde, nachdem ich heirate. Und das habe ich meinen Eltern auch mitgeteilt. Ich hatte natürlich damit gerechnet, dass, na ja, dass es wieder so Ärger gibt wie damals mit der Schule, aber als ich das meinem Vater erzählt habe, der hatte plötzlich ganz einfach Tränen in den Augen und hat mir seine Zustimmung zugenickt, und damit war die Sache geklärt. Da wusste ich, dass es mit seiner Erlaubnis ist. Und ich glaube, dass ihn das auch in gewisser Hinsicht entlastet hat.
Longerich: Warum entlastet?
Pogany-Wnendt: Na ja, ich glaube, für ihn war das ja immer ein innerseelischer Konflikt, sich verstecken zu müssen, weil ich meine, er hat seine Eltern verloren. Und diese Trauer war immer in ihm, und ein bisschen ist das so, das ist wie ein Verrat an den Toten. Man kann es verstehen, aber innerseelisch ist das so etwas. Ich glaube, dass mein Vater ständig hin und her gekämpft hat, abgesehen davon, dass er sich natürlich auch als Jude gefühlt hat, er ist ja damit groß geworden.
"Der Toten wegen musst ich jüdisch sein"
Longerich: Aber diese Ambivalenz haben Sie ja auch gespürt. Sie nennen das Jüdischsein das Dilemma Ihres Lebens. Wie meinen Sie das?
Pogany-Wnendt: Na ja, ich musste Jude sein, weil wie gesagt, meine Eltern waren gebunden an das Judentum durch ihre Erfahrungen mit dem Holocaust. Ein Großteil der Familie – es war ja eine kleine Familie, aber der Großteil der Familie war durch den Holocaust ausgelöscht worden. Und das lebte in ihnen weiter, das heißt, man kann das nicht einfach abschneiden. Sie fühlten sich irgendwie auch als Juden, auch meine Mutter ist im jüdischen Geist sozusagen, auch wenn nicht religiös, aber im jüdischen Geist aufgewachsen. Das heißt, ich sage das mal so: Der Toten wegen musste ich einerseits jüdisch sein, denn diese Wurzeln kann man nicht einfach abschneiden. Aber auf der anderen Seite durfte ich das nicht sein und sollte ich das nicht sein aus der Angst heraus. Das war immer ein Dilemma, in dem ich stand. Wenn es den Holocaust nicht gegeben hätte – denn das ist für mich die stärkste Bindung an das Judentum, und zwar, ohne dass ich das trennen kann –, wenn es das nicht gegeben hätte, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass ich aus dem Judentum, so wie man aus der katholischen Kirche austritt, genauso ausgetreten wäre. Aber das ist nicht möglich, weil…
Longerich: 1989, da haben Sie sich entschieden, eine Ausbildung zum Psychoanalytiker zu machen und haben aber da schnell gemerkt, weil Sie auch schon relativ schnell dann psychotherapeutisch arbeiteten, dass es gar nicht um diese transgenerationalen Aspekte des Holocaust oder des sogenannten Dritten Reiches ging, also wie traumatische Erlebnisse von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden, wie Sie das ja erlebt haben. Was löste das in Ihnen aus?
Pogany-Wnendt: Ich wusste damals nicht wirklich von diesen ganzen transgenerationellen Prozessen, von denen ich heute besser weiß. Damals wusste man wenig davon, ich auch nicht, ich habe nur gespürt, dass ich irgendwas in mir trage, womit ich sehr alleine bin. Als ich in meiner Lehranalyse zum Beispiel versucht habe, darüber zu sprechen, also über die Vergangenheit meiner Eltern, da war kein Platz dafür. Es wurde mehr als eine Art Abwehr interpretiert, irgendein innerseelischer Konflikt aus meiner Kindheit, was ich damit versuche abzuwehren, indem ich auf meine Eltern sozusagen ausweiche. Es wurde wie so eine Art innerer Widerstand gedeutet. Das heißt, ich hatte keinen Raum, darüber zu sprechen, und ich habe gemerkt, dass auch in Psychotherapien, die ich natürlich auch durchgeführt habe, das kein Thema war.
"Wir wollten eine Art Minilaboratorium haben"
Longerich: Aber damit haben Sie sich ja dann nicht zufrieden gegeben, sondern sind ja auf die Suche gegangen. Und 95 haben Sie dann eine Gruppe gefunden jüdischer und nicht jüdischer Menschen, allesamt Kinder von Holocaust-Überlebenden oder Täterkindern, darunter viele Psychoanalytiker wie Sie selbst. Daraus ist etwas ziemlich Heilsames entstanden, nämlich PAKH, der Arbeitskreis für intergenerationelle Folgen des Holocaust. Was verbirgt sich hinter diesem sperrigen Namen für eine Idee?
Pogany-Wnendt: Damals haben wir gemerkt, dass wir sowohl aufseiten der Nachkommen von Überlebenden wie auch aufseiten der Nachkommen von Tätern irgendein seelisches, ein psychologisches, ein emotionales Erbe in uns tragen, ohne das genau benennen zu können. Wir wollten einfach einen Verein gründen, wo wir diese Prozesse, wie wir die Erfahrungen von Leid, von Verfolgung auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Schuld, wie wird das an die Nachkommen weitergeben: Was für seelische Mechanismen gibt es, und welche Folgen hat das für den Dialog zwischen den Nachkommen von Tätern und den Nachkommen von Überlebenden. Wir wollten so eine Art Minilaboratorium haben, wo wir diese Dinge untersuchen können und versuchen, dann auf die Gesellschaft zu übertragen.
Longerich: Was sind das für Themen, die da durch die Generationen weitergegeben werden? Das muss doch grundverschieden sein, oder ist das doch ähnlich in der Auswirkung?
Pogany-Wnendt: Nein, natürlich sind das ganz unterschiedliche Dinge. Ich meine, auf beiden Seiten wurde geschwiegen, auch auf jüdischer Seite, also aufseiten der Überlebenden, wurde häufig nicht viel darüber gesprochen. Aber aus unterschiedlichen Gründen, und zwar, das eine war ein Verschweigen von Schuld, um sich nicht mit der Schuld auseinandersetzen zu müssen. Das andere war ein Schweigen, denke ich, aus einem Leid heraus, um einen unerträglichen Schmerz nicht immer wieder erleben zu müssen. Ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass jede Erfahrung, die wir im Leben machen, hat auch immer eine emotionale Besetzung, ob das im Alltag ist, ein Besuch im Kino oder wenn man sich mit Freunden trifft oder auch wie bei mir zum Beispiel die Flucht aus Ungarn oder eben auch der Holocaust aufseiten… Wenn man ein Täter des Holocaust war oder ein Überlebender des Holocaust war, das hinterlässt eine emotionale Beziehung zu dieser Erfahrung. Diese emotionale Beziehung konnte weder aufseiten der Täter noch aufseiten der Überlebenden wirklich aufgearbeitet werden. Die Schuld wurde verdrängt, es wurde geleugnet schlicht und einfach, dass die Taten begangen wurden. Es gab keine Schuldigen sozusagen nach dem Krieg. Und aufseiten der Überlebenden wurde der Schmerz, aber sicherlich auch die Ressentiments, die man hatte, auch der Hass, auch die Rachegefühle, alles das wurde zu einem Teil auch verdrängt. Und dieses, was man da verdrängt hat, das ist etwas, was man an die Kinder, diese Gefühlserbschaften, was man an die Kinder schon im Grunde genommen, um das in ein Bild zu packen, mit der Muttermilch den Kindern weitergibt, so wie ich das auch erlebt habe. Die Angst meiner Mutter oder den Schmerz meines Vaters, das ist zu meinem eigenen Schmerz geworden im Grunde genommen, obwohl es war ursprünglich nicht mein Schmerz. Und das wird an die Kinder weitergegeben, sodass auf der einen Seite Schuldgefühle, Schamgefühle entstehen und natürlich auch die Ideologie, die nie aufgegeben wurde, zu einem Teil durch die Erziehung auch weitergegeben wurde. Und das bleibt irgendwo im Unbewussten, wie so eine Krypta. Auf der anderen Seite bleibt der Schmerz und bleiben diese Ressentiments. Wenn sich die Nachkommen dann treffen, diese unterschwelligen Gefühle, wenn die Ressentiments auf der einen Seite und die Schuldgefühle auf der anderen Seite sozusagen aufeinandertreffen unbewusst, dann kann das manchmal auch Konsequenzen haben, wo das plötzlich explodiert und man versteht nicht, warum das so ist.

Longerich: Aber ist denn dann Austausch überhaupt möglich, also mit diesen grundverschiedenen Erfahrungen? Ich stelle mir das unglaublich fordernd vor, wenn man ein Kind ist von Holocaust-Überlebenden, das damit aufgewachsen ist, dass seine Eltern eben über viele Jahre auch nach dem Holocaust kaum mit diesem erlittenen Leid fertig werden, wie soll sich dieses Kind dann hineinversetzen in die Gefühlswelt eines Täterkindes? Das nimmt es doch wahrscheinlich nicht für ernst.
Pogany-Wnendt: Ja, so war es im Grunde genommen am Anfang bei mir. Ich habe mir unbewusst am Anfang erwartet, dass mein Gegenüber, meine deutschen Gegenüber – ich nenne es einfach mal so – sozusagen sich mit mir solidarisch erklären als Kind von Überlebenden. Ich fühlte mich selber fast wie ein Opfer und tat mich sehr schwer, die andere Seite zu sehen. Ich habe irgendwann verstanden, dass einen Vater zu haben zum Beispiel, der sich zum Mörder gemacht hat, weil er in einem Sonderkommando oder in einer Einsatzgruppe eine leitende Position hatte oder einfach nur Mitläufer war, dass das sicherlich auch kein, wie soll ich sagen, kein Erbe ist, mit dem man gut leben kann. Wenn der eigene Vater oder auch heute der Großvater, den man liebt, den man als Kind geliebt hat, und plötzlich entdeckt man, der hat schreckliche Dinge gemacht. Dann ist das nicht leicht zusammenzukriegen in der emotionalen Welt. Ich habe immer gedacht, wenn ich versuche, die zu verstehen, dass ich meine eigenen Eltern verrate, sozusagen das Leid haben nur die Überlebenden gepachtet, das war so meine Vorstellung… Als ich angefangen habe, zu merken, dass die andere Seite auch leidet, die Nachkommen, nicht die Täter. Und dass sie die Eltern oder Großeltern, die sie geliebt haben, die sie liebten, aber gleichzeitig verachten und verurteilen mussten, weil sie schlimme Dinge gemacht haben, dass das kein leichtes Erbe ist. Und da habe ich angefangen, langsam mich zu öffnen, das hat vielleicht zehn Jahre gedauert. Und das hat wiederum geholfen, dass ich mit meiner Geschichte auf eine andere Weise verstanden worden bin.
"Immer noch große Angst, sich mit der ganz konkreten Geschichte der Familie auseinanderzusetzen"
Longerich: Jetzt beschäftigen Sie sich ja schon seit mehr als 25 Jahren mit dem Thema oder noch länger. Und gerade haben Sie aber auch von dem Schweigen gesprochen, also in vielen Familien wird nicht nach dem Verhalten der Großeltern in der NS-Zeit geschaut. Sie haben einmal gesagt, das wäre einer der Gründe, warum in Deutschland wieder über Antisemitismus dringend geredet werden muss.
Pogany-Wnendt: Ich denke, es ist in Deutschland sehr viel getan worden im Zusammenhang mit dem öffentlichen Gedächtnis, aber in den Familien – das ist meine Erfahrung als Therapeut, aber auch in meinem Engagement mit dem PAKH –, in den eigenen Familien, da steht man noch sehr zurück. Da ist immer noch eine große Angst, Hemmung oder vielleicht auch Unwille, sich mit der ganz konkreten Geschichte in der Familie, mit der Täterschaft, Mittäterschaft oder vielleicht auch einfach Mitläufertum da auseinanderzusetzen und genau hinzugucken, was hat der Großvater, was hat der Vater, was haben die Onkel und so weiter gemacht. Dadurch, glaube ich, bleiben diese Gefühlserbschaften immer virulent in gewisser Hinsicht. Und können dann, je nach den gesellschaftlichen Umständen, aktiviert werden oder mobilisiert werden. Damit will ich nicht ganz alles erklären, aber das ist ein Aspekt, warum heute Antisemitismus ja stärker geworden ist.
Longerich: Rechtspopulisten relativieren zunehmend die NS-Zeit und den Holocaust, bezeichnen die Erinnerungskultur als Schuldkult. Es gibt aber auch verschiedene Studien, die belegen, dass sich der Blick auf die eigene Familie zunehmend verklärt, Täter will kaum noch jemand in der Familie gehabt haben, Widerstandskämpfer und Opfer aber eben schon. Fühlen Sie sich da auch manchmal hilflos und erschöpft? Immerhin, Sie kämpfen seit Jahrzehnten gegen das kollektive Vergessen, aber es scheint mehr und mehr um sich zu greifen.
Pogany-Wnendt: Ich glaube, es gibt zwei Richtungen: Da ist die eine, die Sie erwähnt haben – Opa war kein Nazi, das ist so ein Schlagwort dafür. Aber ich erlebe auf der anderen Seite – ich habe gestern noch einen Anruf bekommen von jemand, der mir erzählte, er hat vor kurzer Zeit erfahren, dass sein Großvater in den Sonderkommandos als SS-Mann bei der Euthanasie mitgewirkt hat. Und später bei der Aktion Reinhardt, und er war völlig außer sich. Vor einigen Monaten hatte mich eine andere Frau angerufen, die plötzlich entdeckte, dass ihr Vater, ihr Großvater KZ-Aufseher gewesen sind. Es gibt auch diese Richtung. Und ich sehe bei den jüngeren Leuten, die sich mit den Geschichten ihrer Großeltern auseinandersetzen und versuchen, das zu verstehen und zu einem Teil zumindest auch sehr böse auf ihre Eltern sind, weil die Eltern das nicht gemacht haben. Und die müssen das jetzt machen. Also es gibt auch diese Richtung, es ist beides. Das hat etwas mit der Ambivalenz, glaube ich, zu tun – auf der einen Seite leugnet man das, man wehrt es ab, aber auf der anderen Seite will man die Wahrheit auch, denn die Wahrheit befreit letztlich.
"Kräfte der Menschlichkeit stärken"
Longerich: Wenn Sie könnten und hätten die deutsche Gesellschaft auf Ihrer Couch, wo würden Sie ansetzen, was muss passieren, damit Holocaust und Nationalsozialismus nicht irgendwann doch von der Mehrheit vergessen werden?
Pogany-Wnendt: Ich würde die Leute ermuntern, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, nicht nur mit der allgemeinen Geschichte, sondern wirklich auch in ihre eigenen Familien zu gucken. Das ist am Anfang schwierig, aber es hat dauerhaft, das ist meine Erfahrung, eine befreiende Wirkung, weil man dann genau weiß, was ist. Und man versteht vor allem sich selbst besser. Das ist das eine. Das Zweite ist, ich glaube, wenn wir irgendetwas aus dem Holocaust lernen könnten, dann ist das, wie eine Welt ohne Menschlichkeit, ohne Liebe aussehen kann. Ich bin überzeugt davon, dass das Menschen waren, die vielleicht vor dem Krieg noch relativ normal waren und im Zuge eines Prozesses, in dem sie ihre Menschlichkeit verloren haben, sich selbst entmenschlicht haben oder wie Giordano sagt, ihre humane Orientierung verloren haben, dass sie im Zuge dieses Prozesses so geworden sind, wie sie waren, also diesen schrecklichen Dinge gemacht haben, die die Täter getan haben. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir auch heute alles tun, um vor allem die Kräfte der Menschlichkeit zu stärken.
Longerich: Vielen Dank, das war ein schönes Schlusswort!
Pogany-Wnendt: Ich danke Ihnen!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.