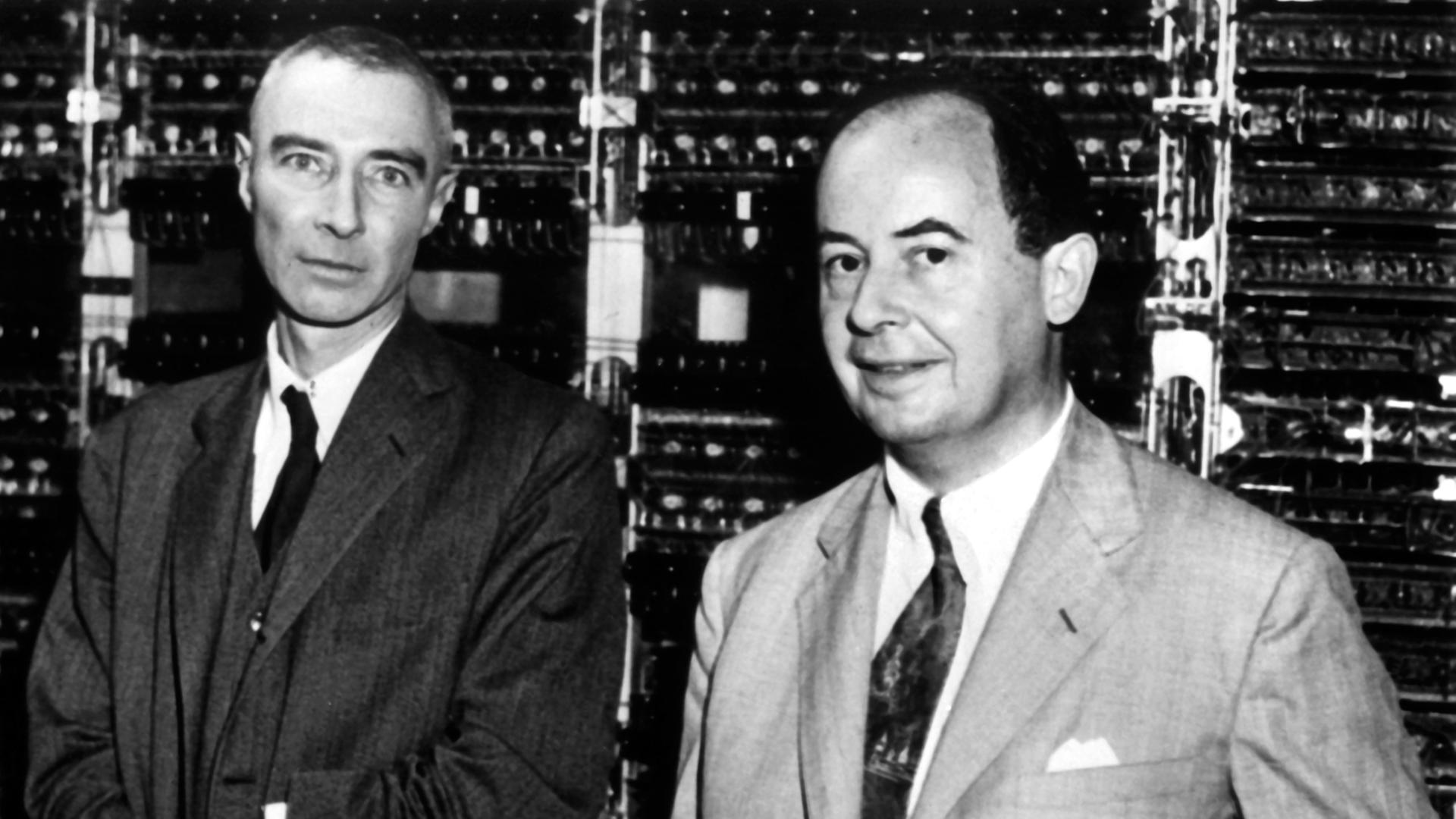13. Februar 1960. In der algerischen Sahara, rund 50 Kilometer von der Kleinstadt Reggane entfernt, zündet die französische Atomenergiebehörde mit Unterstützung der Armee um 7.04 Uhr morgens eine Bombe: Der erste französische Atomversuch. Ein Augenzeuge beschreibt den aufsteigenden Atompilz in den schönsten Farben, dann, mit kurzer Verzögerung, kommt die Wucht der Explosion bei ihm an: sie ist drei- bis viermal so stark wie bei der Atombombe von Hiroshima.
"Hurra für Frankreich! Seit heute früh ist es stärker und stolzer!" telegraphierte Staatschef Charles de Gaulle nach dem geglückten Versuch an die Mannschaft vor Ort. Er hatte sein Ziel erreicht: Frankreich war in den exklusiven Club der Atommächte aufgestiegen – für den alten General entscheidend in dieser Zeit des Kalten Krieges. Denn Frankreich wollte sich weder unter einen russischen noch unter einen amerikanischen Atomschirm stellen. Schon Anfang der 50er-Jahre reifte der Wunsch nach einer eigenen atomaren Schlagkraft, der force de frappe.
Für deren Vorführung und Weiterentwicklung musste ein geeignetes Gelände gefunden werden. Möglichkeiten in der Metropole, wie der europäische Teil Frankreichs bis heute genannt wird, wurden geprüft. Korsika kam ebenso in Betracht wie weit entfernte Inseln in Polynesien. Schließlich wurde man in Algerien fündig, das damals offiziell keine Kolonie, sondern tatsächlich französisches Staatsgebiet war – wenn auch seit 1954 hier ein blutiger Befreiungskrieg tobte. Doch das fiel in der Sahara weniger ins Gewicht, wie der franko-algerische Journalist und Filmemacher Larbi Benchiha erklärt:
"Letztlich war die Sahara in jeder Hinsicht der ideale Ort: nicht zu weit weg von Paris, sehr weiträumig, vor indiskreten Blicken geschützt, obwohl die Amerikaner nicht weit weg, in Libyen stationiert waren. Deswegen haben sie es dort gemacht. "
"Letztlich war die Sahara in jeder Hinsicht der ideale Ort: nicht zu weit weg von Paris, sehr weiträumig, vor indiskreten Blicken geschützt, obwohl die Amerikaner nicht weit weg, in Libyen stationiert waren. Deswegen haben sie es dort gemacht. "
Bevölkerung nur unzureichend informiert
Über mehrere Jahre wurden Vorbereitungen getroffen, eine Militärbasis angelegt, unterirdische Labore eingerichtet, die Bombe schließlich in Einzelteilen dorthin gebracht und vor Ort zusammengebaut. Arbeitskräfte kamen nicht nur aus Frankreich, von Atomenergiebehörde und Militär, sondern auch aus der lokalen Bevölkerung.

Ein Bericht aus dem französischen Verteidigungsministerium belegt, dass Experten über die richtige Entfernung des Explosionsortes zur Kleinstadt Reggane ausführlich diskutierten und ein gewisses Strahlenrisiko schließlich in Kauf nahmen. Geschützt wurde die Bevölkerung der Region – damals vermutlich um die 20.000 Menschen - nur sehr unzureichend, wie ein Bewohner von Reggane in einem Film von Larbi Benchiha schildert:
"Zwei Stunden nach der Explosion bin ich mit einem Militärarzt losgefahren, um die umliegenden Dörfer und Palmengärten zu besuchen. Wir haben gesehen, dass alte Häuser eingestürzt waren. Alte Menschen und Frauen waren vor Angst in Ohnmacht gefallen. Mehr als 25 Frauen hatten eine Fehlgeburt. Sie haben wir per Hubschrauber ins Militärkrankenhaus gebracht. Manche Leute waren völlig verängstigt und hatten an diesem Tag Herzflattern."
Die Bevölkerung hatte nur wenige Sicherheitshinweise erhalten: Zum Zeitpunkt der Explosion in den Häusern bleiben und die Augen schließen. Manche hatten sogenannte Dosimeter bekommen, die am Körper getragen werden sollten. Sie zeichneten auf, welche Strahlendosis der Träger abbekam. Das ließ sich aber erst nach Entwicklung der eingebauten Filme ablesen. Die betroffene Bevölkerung kennt daher die Strahlenwerte bis heute nicht. Doch über die Jahre und Jahrzehnte wurde festgestellt, dass bestimmte Krankheiten vermehrt auftraten.
"Atemprobleme und Asthma. Das hatten wir vorher hier nicht, es kam mit dem Staub der Bombe, vielleicht auch wegen der radioaktiven Strahlung. Leberkrebs, Lungenkrebs, Magenkrebs, Brustkrebs. Das sind die Krebsarten, die nach der Bombe auftraten. Außerdem Augenkrankheiten und Erblindungen. Kinder wurden blind geboren, es gab Frühgeburten, Babys mit Missbildungen, riesige Köpfe auf kleinen Körpern und umgekehrt. Davon gab es viel."
Eine genaue medizinische Studie fehlt
Wie viele Menschen genau gesundheitliche Schäden durch die Strahlung erlitten, weiß allerdings niemand, denn es fehlt eine genaue medizinische Studie. Und bis heute ist die Region in keiner Weise für die Behandlung von Strahlenkrankheiten ausgerüstet, wie Mustapha Sidhoum, Arzt im Krankenhaus von Reggane, dem Filmemacher Larbi Benchiha erklärt. Schon für die Diagnose müssten die Patienten mindestens 1000 Kilometer bis zum nächsten entsprechend ausgerüsteten Krankenhaus reisen.
"Diese Atomversuche haben gesundheitliche, psychologische und wirtschaftliche Folgen. Wir haben Patienten, deren Leiden vermutlich auf radioaktive Strahlung zurückgehen. Psychologisch gesehen haben die Menschen jetzt, wo darüber gesprochen wird, Angst vor Krebs. Sie fürchten um sich und ihre Kinder. Und Investoren kommen nicht in diese Gegend, weil sie Angst vor der Strahlung haben. Das ist die wirtschaftliche Folge."
Aber nicht nur die algerische Bevölkerung, auch französische Soldaten, die während und nach den Versuchen in der Gegend von Reggane eingesetzt waren, hatten keine ausreichenden Informationen. Guy Morvan wurde 1962 als Wehrdienstleistender nach Algerien geschickt und in Reggane als Sanitäter eingesetzt. Der rüstige Rentner hat Fotos aus dieser Zeit behalten.

"Ich habe die Militärbasis von Reggane verlassen und bin in der Wüste gewandert, ohne zu wissen, dass das alles verstrahlt ist. Ich suchte Speerspitzen aus Stein, die aus der Zeit um 10.000 vor Christus stammten, und Straußeneier, aus denen Ketten gemacht worden waren. Hier auf diesem Foto sieht man, wie ich angezogen war: nur eine Boxershort – und das in der verstrahlten Zone."
Auch als Dokumentarfilmer Larbi Benchiha 2007 zusammen mit Experten die Region besuchte, konnte er noch radioaktive Strahlung messen. Der Geigerzähler kam vor allem in der Nähe von Brocken aus glasartig geschmolzenem Sand an seine Messgrenze. Die Radioaktivität lag damit über 100mal so hoch wie normal.
Plutonium-Halbwertszeit von 24400 Jahren
Einer der bis heute strahlenden Stoffe ist vermutlich das für Atombomben verwendete Plutonium, erklärte der damals mitgereiste Atomwaffen-Gegner Bruno Barrillot. Er verwies auf die Krebsgefahr, die die Inhalation schon kleinster Mengen von Plutoniumstaub mit sich bringt und erklärte:
"Man darf nicht vergessen, dass das Plutonium eine Halbwertszeit von 24.400 Jahren hat. Experten sagen, dass es erst nach zehn Perioden, also nach 240.000 Jahren völlig unschädlich ist. Wer weiß, wie die Zukunft der Sahara aussieht. Wenn man hier das Grundwasser nutzen oder die Wüste bewirtschaften will, kann das noch jahrhundertelang gefährlich bleiben."
Der ersten Explosion folgten bis Ende 1961 noch drei weitere in der Region von Reggane. Dann wurden die Anlagen abgebaut und viel Material einfach im Sand vergraben. Die nächsten, jetzt unterirdischen Versuche, fanden im weiter südöstlich gelegenen Hoggar-Gebirge statt. Dort leistete René Favre 1962/63 seinen Wehrdienst. Aufgabe seiner Kompanie war es, vor den dort insgesamt dreizehn Atomversuchen die Tuareg aus der Umgebung zu vertreiben. Am dramatischsten war sein Einsatz, als ein Versuch schiefgegangen und viel Radioaktivität aus Bergspalten entwichen war. Er erzählt:
"Armeehubschrauber waren gekommen, wir Soldaten stiegen ein; sie ließen uns dort abseilen, wo Zelte standen, ohne zu landen. Wir nahmen die Leute mit ihren Kindern in die Hubschrauber, aber ließen die Zelte und alles anderen vor Ort. Wir setzten sie an einem beliebigen Ort wieder ab und zogen los die nächsten zu holen. Am nächsten Tag waren sie wieder zurück. Es gab keine Absperrungen."
Wann immer eine neue Bombe gezündet wurde, mussten die Soldaten Schutzkleidung anlegen. René Favre hat damals allen Verboten zum Trotz Fotos gemacht und zeigt sie gern.
"Wir trugen Stiefel, lange Unterhosen, ein Unterhemd, weiße Handschuhe – das alles mitten in der Wüste. Darüber kamen noch der Schutzanzug und die Gasmaske aus dem Zweiten Weltkrieg. So angezogen fuhren wir vor jeder Explosion dorthin und stellten uns rund um den Berg auf. Man musste die Kapuze aufsetzen, sobald man in die Sicherheitszone kam."

Dass Hitze, Durst und das Bedürfnis nach einer Zigarette häufig dazu führten auch in der Sicherheitszone die Gasmaske abzusetzen, erinnert sich Favre noch.
"Ich hatte einen Kameraden in meiner Kompanie. Er war in bester Gesundheit, als wir gleichzeitig entlassen wurden, und ist dann mit nicht mal 40 Jahren gestorben, an Krebs eben. Aber weiß man, ob das an der Strahlung lag? Angesichts der vielen Leute, die heute Krebs haben, kann man schlecht sagen, ob man das nun von den Abgasen oder von der Strahlung bekommen hat."
Zunehmender Druck von Opfervertretern
Genau das ist auch die Frage, die Alain Christnacht stellt – bei jedem Antrag, der ihm vorliegt. Christnacht ist Präsident des CIVEN, des Komitees zur Entschädigung der Opfer von Atomversuchen.
Erst 2010 wurde in Frankreich, nach zunehmendem Druck von Opfervertretern, ein Gesetz zu den gesundheitlichen Folgen der Atomversuche erlassen. Davor konnten Veteranen, falls sie an Folgen radioaktiver Strahlung litten, nur versuchen, diese als Berufskrankheit anerkennen zu lassen. Nun können sie außerdem eine Entschädigung beim CIVEN beantragen. Und hier haben sie bessere Chancen auf Anerkennung, meint Präsident Christnacht:
"Beim CIVEN ist der Mechanismus der Rechtsvermutung vorteilhafter. Das heißt, das CIVEN muss nachweisen, dass es zwischen der Krankheit und der erlittenen Strahlung keine Verbindung gibt. Manchmal verzichten wir von vornherein darauf, dann wird ein Antrag angenommen. Manchmal waren wir schon der Meinung, dass es keine Verbindung gab und haben versucht, das nachzuweisen. Dann kann die Gerichtsbarkeit, die bei so einer Rechtsvermutung sehr wachsam ist, unsere Entscheidung aufheben."
Zur Beurteilung, ob eine Krebserkrankung auf die radioaktive Strahlung durch Atomversuche zurückzuführen ist, hat das CIVEN eine Software aus den USA übernommen. Hier werden neben Daten wie Alter, Geschlecht, Strahlendosis, Ausbruch der Krankheit, auch Risikofaktoren wie Rauchen bei einer Lungenkrankheit oder Alkoholabhängigkeit bei einer Erkrankung des Verdauungsapparats eingegeben. Daraus errechnet die Software dann eine Wahrscheinlichkeitsrate für die Verbindung zwischen Strahlung und Krankheit. Bis Ende 2019 sind beim CIVEN insgesamt rund 1600 Anträge auf Entschädigung eingegangen. Direkt angenommen, also die krankheitsauslösende Wirkung der Strahlung anerkannt, wurden etwa 300, bei weiteren 200 entschied ein Gericht, dass eine Entschädigung zu zahlen sei. Diese lag je nach Fall zwischen 10.000 und 900.000 Euro, denn sie wird vor allem danach berechnet, auf welche Hilfe die Person aufgrund ihrer Krankheit angewiesen ist.
Nur wenige Anträge aus Algerien
Auffällig ist jedoch: Knapp drei Viertel der Anträge, die beim CIVEN eingehen, betreffen die französischen Atomversuche in Polynesien, die dort von 1966 bis 1996 fortgeführt wurden. Nur 460 Anträge beziehen sich auf Einsätze in Algerien; 120 davon wurde bislang stattgegeben – und darunter befindet sich ein einziger algerischer Zivilist. Alain Christnacht hat dafür eine Erklärung.
"In der Sahara gibt es praktisch keine Bevölkerung. Die Touareg haben kaum Anträge gestellt, und wenn, dann wurden sie abgelehnt, weil es nicht die richtigen Krankheiten waren. Nur einer wurde angenommen. Ich will gar nicht sagen, dass die Versuche perfekt waren, aber es gab in der Versuchszone doch strenge Überwachungsmaßnahmen, auch per Helikopter. Und es gab eigentlich keine Bevölkerung in der Nähe – jedenfalls haben wir keine Anträge erhalten."
Larbi Benchiha: "Er hat vergessen zu sagen, dass Reggane 40 Kilometer vom Ort der Atomversuche entfernt liegt. Und dass die Gegend schon damals sehr bewohnt war. Die Leute haben die Explosion mit eigenen Augen gesehen. Außerdem wurden die Menschen gar nicht informiert, als die Anlagen geschlossen wurden, dass das sehr gefährlich bleibt. Also gingen sie an die Versuchsorte, weil es dort Material wie Eisen gab. Sie haben das Zeug nachhause mitgenommen und zum Bauen oder im Haushalt verwendet. Natürlich können Algerier heute noch einen Antrag auf Entschädigung einreichen. Aber glauben Sie, dass ein Algerier, der in Reggane wohnt und noch nicht einmal nach Algier reisen kann, um eine medizinische Behandlung zu bekommen, von dort aus einen Antrag zusammenstellen kann? Das ist fast unmöglich", sagt Filmemacher Larbi Benchiha, der die Situation in Reggane gut kennt.
Zwar haben sich auch in Algerien Vereine zur Unterstützung der Strahlenopfer gegründet, doch sie haben längst nicht die Mittel und die Durchsetzungsfähigkeit des 2001 in Frankreich gegründeten Vereins der Veteranen der Atomversuche, kurz AVEN. Larbi Benchiha ist allerdings erstaunt, dass die algerischen Behörden ihre Staatsbürger nicht stärker dabei unterstützen, Anträge auf Entschädigung zu stellen. Möglicherweise stecken dahinter politische Überlegungen, denn:
"Bis vor kurzem dachte man, Frankreich hätte seine Versuche ohne Rücksprache mit der algerischen Regierung fortgeführt. Aber es gab während des Unabhängigkeitskriegs Friedensverhandlungen in Evian. Da wurden auch die Atomversuche verhandelt, und Algerien hat zugestimmt, dass Frankreich sein Atomprogramm in der Sahara fortführt, bis ein anderer Ort gefunden ist. Das war dann das Mururoa-Atoll in Polynesien, wohin sie 1966 umgezogen sind. Das heißt, die Franzosen haben die Atomversuche im seit 1962 unabhängigen Algerien noch bis 1966 weitergeführt."
Die Modalitäten wurden in geheimen Zusatzprotokollen zum Abkommen von Evian festgehalten – bis heute ist vieles unbekannt. Manches wurde nach fünfzig Jahren freigegeben, so wie ein geheimer Bericht über die radioaktive Wolke, die nach dem ersten Atomversuch im Februar 1960 über ganz Westafrika zog. Knapp zwei Wochen später erreichte sie mit immer noch messbarer Strahlung die spanische Küste und Sizilien.
Kein Verzicht auf Atomwaffen
Zwar stellte Frankreich nach den vier Versuchen in Reggane um und führte die folgenden Explosionen im Hoggar-Gebirge unterirdisch durch. Doch besonders bei Unfällen entwich auch hier starke Radioaktivität. Und auch in Polynesien, wo Atombomben über- und unterirdisch gezündet wurden, ist bis heute Strahlung nachweisbar, obwohl der letzte der über 190 Tests bald 25 Jahre zurückliegt.
Eingestellt wurden die Versuche 1996 nach lautstarken internationalen Protesten. Frankreich unterzeichnete wenige Monate später den - bis heute nicht in Kraft getretenen - Atomteststoppvertrag. Die Opfervertreter werden bis heute bisweilen als Nestbeschmutzer angesehen, wie Florence Bourel von der Organisation AVEN berichtet.

"Man beschuldigt uns, man geht uns an. Zum Beispiel im Konferenzzentrum von Nantes. Dort wurden wir buchstäblich angegriffen, weil wir und unsere Ausstellung über die Atomversuche angeblich gegen Atomkraft und antimilitaristisch seien. Dabei geht es darum gar nicht. Jeder Veteran hat das recht, über Atomenergie zu denken, was er will. Wir hätten nur gern, dass diese Geschichte in die Schulbücher eingeht, denn es war ein wichtiger Moment für Frankreich. Bisher wird überhaupt nicht darüber gesprochen. Die Jugendlichen haben keine Ahnung von dem Thema."
Atomversuche werden mittlerweile digital simuliert, Atomwaffen gibt es immer noch in Frankreich. Erst vergangene Woche hat Präsident Emmanuel Macron erklärt, dass sein Land daran festhalten und diese auch nicht unter ein europäisches Kommando stellen will. Die rund 300 atomaren Sprengköpfe sind vor allem auf U-Booten in der Bretagne stationiert. Dort lebt Roland Nivet, Sprecher der Friedensbewegung "Mouvement pour la paix". Am Rande einer Demonstration gegen die Rentenreform kritisiert er das Festhalten der Regierung an den Atomwaffen, und zitiert eine Umfrage seiner Organisation, derzufolge eine Mehrheit der Franzosen seine Meinung teilt.
"76 Prozent der Franzosen sind dafür, dass Frankreich ernsthaft die atomare Entwaffnung betreibt. 68 Prozent sind dafür, dass Frankreich sofort den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Aber es gibt einen Widerspruch zwischen der politischen Ebene und der öffentlichen Meinung. Hier ist noch viel zu tun. Das Problem muss viel stärker in die Politik getragen werden. Auf der Ebene der öffentlichen Meinung haben wir einiges erreicht: Mit dem Mouvement pour la paix haben wir 170 Organisationen in Frankreich zu einem Kollektiv zusammengeschlossen, das sich gegen Atomwaffen stellt. Unser Slogan ist: Stoppt Armut, stoppt Gewalt, stoppt Krieg, stoppt Atomwaffen."
Zu der steigenden Ablehnung der Atomwaffen in der Bevölkerung mag auch beigetragen haben, wie der französische Staat mit den Folgen der Atomversuche umgegangen ist. So harmlos und sauber, wie diese lange dargestellt wurden, waren sie jedenfalls nicht.