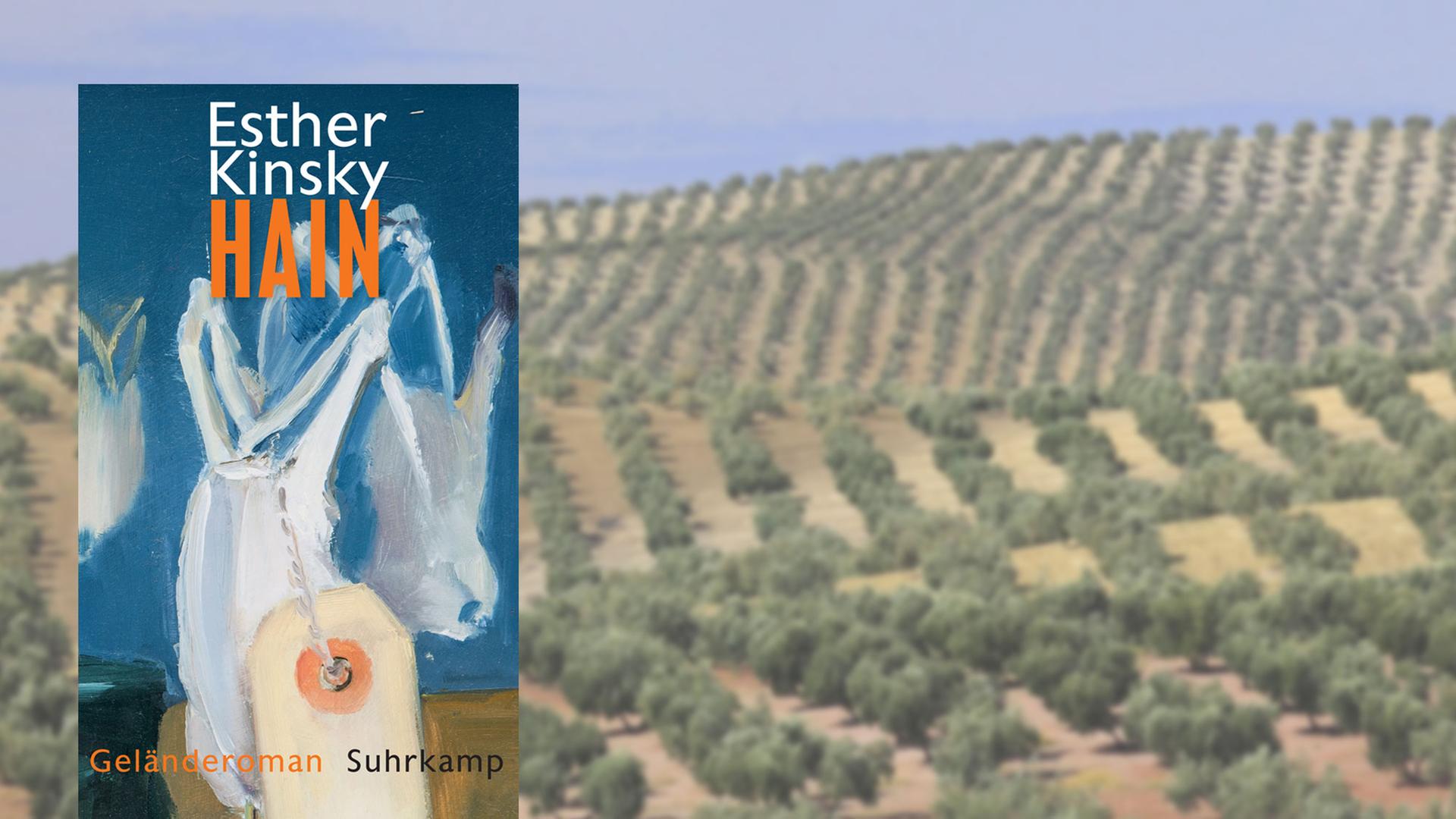"Im winter ist mir ein kleiner Stein
zugefallen zwischen dem schiefer
er sieht aus wie ein edelstein mit einem
stück gelb wie die blumen er gehört mir."
zugefallen zwischen dem schiefer
er sieht aus wie ein edelstein mit einem
stück gelb wie die blumen er gehört mir."
Dem Kind, das hier redet, sind alle Erscheinungen der Welt gleich gültig, und gerade der kleinste Steine ist sein größter Schatz. Kinder schauen auf die Geheimnisse in den Dingen. So auch das Kind im Gedicht, das im Stein eine Blume erkennt. Schon der alte Brehm berichtete, dass unter gewissen Umständen Flora und Fauna sich über die Jahrtausende in Erze verwandeln können.
Esther Kinskys Gedichtbände sind Forschungsexpedition, jeder auf seine Weise und meist in mehrfacher Hinsicht. Expeditionen in die Natur und in die Sprache zugleich
In dem Gedichtband "Naturschutzgebiet" etwa hatte Kinsky 2013 einen ehemaligen Krankenhauspark, der langsam von der Natur überwuchert wird, zum Ausgangspunkt genommen und den abwesenden Patienten abwesende, das heißt aus dem Gebrauch gekommene Naturbezeichnungen beigegeben. Ihr Naturschutzgebiet, das verstand man schnell, war nicht zuletzt ein Sprachschutzgebiet.
Kinskys nächster Gedichtband, "Der Kalte Hang" war eine Expedition ins Reich der Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen. Wieder ging es um das Abwesende im Anwesenden. Gleich im ersten Satz zeigte sich der Zauber des Bandes:
"wir sind der wind, wir sind der wind, wir sind der wind"
hieß es dort und automatisch ergänzt man im Sinn
" ...das himmlische Kind."
hieß es dort und automatisch ergänzt man im Sinn
" ...das himmlische Kind."
Denn Sprache ist Gegenwart, Erinnerung und Wiedervergegenwärtigung. Auch was nicht an die Oberfläche kommt, ist dennoch da und wirkt – auf seine Weise - weiter.
In den Gedichten des Bandes "Schiefern" nun steht eine neuartige Forschung und Expedition im Mittelpunkt, diesmal ist Esther Kinsky zu den Slate Islands gereist, zu den Schieferinseln also, einer kleinen Inselgruppe am Rande der Inneren Hebriden im Atlantik, an der Westküste Schottlands gelegen. Hier, wo heute der Tourismus und die Hummerfischerei die Bewohner ernähren, wurde früher Schiefer gebrochen. Der Abbau dieses Gesteins, beherrschte über Jahrhunderte das Leben auf den Inseln; noch immer prägt der graugrüne Schimmer der Schieferdächer viele Stadtansichten der Umgebung, so auch in Edinburgh oder Glasgow. Schiefer ist einer der ältesten Metamorphite, durch Metamorphosen und Erdplattenverschiebungen entstanden. Über Jahrhunderte erfolgte sein Abbau auf den Slate Islands durch Sprengungen.
Der Stein bricht leicht, zumeist in Platten. Nach dem Ende der intensivindustriellen Ausbeutung im 20. Jahrhundert ist eine bizarre Trümmer- und Seenlandschaft zurückgeblieben, die, wie es scheint, langsam von der Natur überwuchert, ja zurückerobert wird. Längst sind die Schächte geflutet, über die Abbrüche wächst Gras, Blumen haben sich zwischen dem Bruchgestein angesiedelt. Auch viele der einstigen Bewohner sind fort. Doch: Vieles in der Landschaft, so versteht man es auch aus den drei kleinen Schwarzweiß-Fotos, die dem Band beigefügt sind, vieles bezeugt noch das gewaltsame Eingreifen des Menschen.
Die Vergangenheit ist nicht vergangen. Sie wirkt weiter, prägt die Konturen der Landschaft, die Gerüche, Geräusche und Klänge. Neben der Reise in diese Inselwelt ist der Band gleichzeitig eine Expedition in die Struktur von Erinnerung und in die Erinnerungsarbeit der Sprache selbst. Das "gestörte Gelände" und die "versehrter Landschaft", die hier beschrieben werden, meinen das Inselreich und die Sprache zugleich. Über Jahrtausende schließlich hat sich auch das Material der Sprache gewandelt. Auch sie durchlebte Metamorphosen, auch sie wurde und wird aufgesprengt, ausgebeutet, abgetragen. Abgeklopft und geschürft. Ist Sprache ein Bergwerk? Hat sie Stollen? Sicher ist: Esther Kinsky verdichtet und schichtet die Sprache, wie Schiefer.
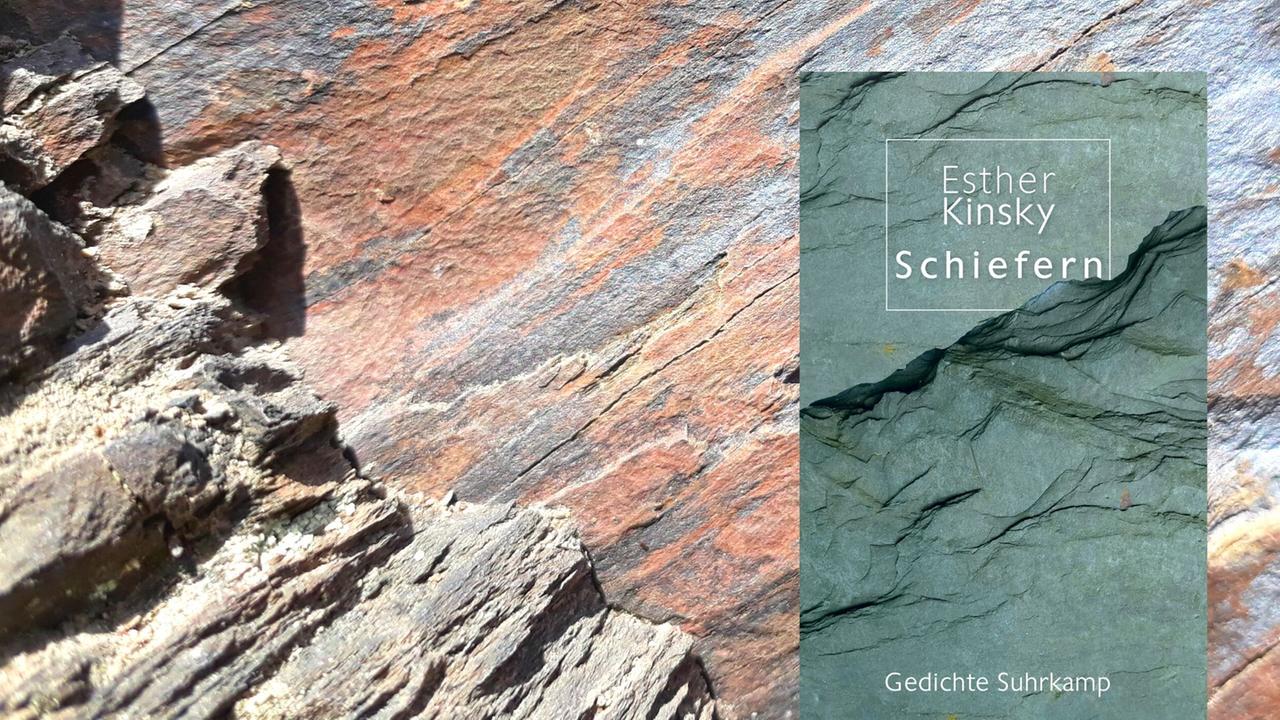
Die Natur in der Dichtung
Immer wieder wird Kinsky zu den Naturdichterinnen gerechnet, denn in ihrem Werk steht Natur im Zentrum, prägt dessen Weltsicht. Doch ihre Expeditionen folgen keinem Natur-Konzept, laden die Natur nicht auf, suchen in der Natur keinen Spiegel irgendeiner Seele. Zwar erfährt man als Leserin viel, doch um Wissensvermittlung oder Ökolyrik geht es hier nirgends.
"A poem is a condensed Landscape", zitiert sie als Motto in "Schiefern" den südafrikanischen Künstler William Kentridge. Ein Gedicht ist kondensierte Landschaft also. Und der Band (um noch einmal das Bild von der Forschungsexpedition zu bemühen) ist eine Expedition in diese Kondensierung hinein. Auch Steine und Blumen bergen und erzählen von Ansichten und Geschichten, wenn man sie nur lässt. Wenn man diese zur Sprache bringt, also in Sprache fasst.
Mehrmals verweist die Autorin im Buch auf die ferne Vorzeit des Kambrium, als zahlreiche Kleinstlebewesen bereits die Meere bewohnten. Es gab sedimentfressende Trilobiten und es gab Tierchen, die Schnecken ähnelten. Zu den wichtigsten Lebewesen damals gehörten polypenähnliche Tiere, die "Kolonien" bildeten. Weil ihre Wohnkammern fossil überliefert sind und an Schriftzeichen erinnern, wurden sie von den Forschern als Graptolithen ("Schrifttierchen") bezeichnet. So gingen sie in die Geschichte ein.
Das Triptichon
Wie schon "Hain", der letzte Roman von Esther Kinsky – ist auch der Gedichtband "Schiefern" als Triptychon angelegt. Auf der Mitteltafel mit dem Titel "37 Stimmen" finden sich 36 Kinderstimmen, ersonnen aus der Betrachtung einer gefundenen Schulfotografie. Als 37. redet am Ende der Fotograf selbst. Die eingangs zitierte Kinderstimme mit dem Stein und der Blume stammt aus diesem Mittelstück, das sich ästhetisch schon durch die strenge Form der Vierzeiler von den anderen Teilen unterscheidet. Die Mitteltafel ist umrahmt von zwei Zyklen, "Schiefern" ist der erste Zyklus, und "Schrifttierchen" ist der dritte Zyklus überschrieben. In beiden wechseln Gedichte mit Prosafragmenten ab.
Der erste Teil, in dem Kinsky Landschaftserkundungen mit Gedanken zum Erinnern, zur Sedimentierung von Zeit, Gestein und Sprache versammeln, ist wie eine Hinführung zu den Kinderstimmen, die vom Leben auf den Inseln erzählen; der 3. Teil führt in Gedanken von den Inseln fort.
Doch bleiben wir beim 1. Teil: Gleich zu Anfang, noch bevor ein spärlich wiederkehrendes "wir" in dieses Inselreich hinübersetzt, heißt es unter dem Titel "Insel":
"Und dann erst küste klüftig.
Im nacken noch die wegrands
ersammelten wörter: bracken lichen
die starre von fichtenföhren brauner farn die hellen flechten gelblich auf granit
lebendiges im schlaf und hier erst dieser wind
der alles zu boden beugt
etwa den hagedorn (...) und drüben inseln dieses land
in stücken das mal fortwill mal zurück
und sich als trümmer gibt und ungewiss
der eigenen vergangenheit
danach setzt regen ein."
Im nacken noch die wegrands
ersammelten wörter: bracken lichen
die starre von fichtenföhren brauner farn die hellen flechten gelblich auf granit
lebendiges im schlaf und hier erst dieser wind
der alles zu boden beugt
etwa den hagedorn (...) und drüben inseln dieses land
in stücken das mal fortwill mal zurück
und sich als trümmer gibt und ungewiss
der eigenen vergangenheit
danach setzt regen ein."
Gedichte sind Sprachereignisse. Die beiden englischen Wörter "bracken" und "lichen" – zu Deutsch: Adlerfarn und Flechte - verweisen unmittelbar auf den dortigen Sprachraum: das Englische. Durch den Anfang mit "und dann... " entsteht unmittelbar der Eindruck einer Erzählung, ein Weg wird gegangen, Bilder und Gedanken werden auf Wanderschaft gebracht. Der Vokal "Ü" ist die Fähre, die von der" küste, klüftig" hinüber zu den "stücken" und "trümmern" eines "drüben" führt. Die Dichtung, hier ist sie Schichtung; ein "bleibendes zeugnis nie abgeschlossener verwandlung (...) stets zur splitterung bereit".
Der ganze dritte Teil des Bandes rückt den Abschied in den Blick – das Ende der industriellen Ausbeutung, den kulturellen Nutzen des abgetragenen Schiefers, die Abreise an der Bushaltestelle und das Übersetzen am Fährhafen.
Eines der Gedichte in diesem Teil heißt "Postindustrial Site". Dort liest man:
Eines der Gedichte in diesem Teil heißt "Postindustrial Site". Dort liest man:
"Weiters erinnert: im rücken halden
Dünner regen nordwind schwach
Why come here sagt die frau am steg
Sie fasst die scherbentasche fester
Das bruchwerk leuchtet die inseln ferngerückt
A broken place man rette seine haut
Vor all den narben die hier möglich sind.
So liegt ein morgen unberufen
In seiner furche zeit."
Dünner regen nordwind schwach
Why come here sagt die frau am steg
Sie fasst die scherbentasche fester
Das bruchwerk leuchtet die inseln ferngerückt
A broken place man rette seine haut
Vor all den narben die hier möglich sind.
So liegt ein morgen unberufen
In seiner furche zeit."
Das Leben
Schon immer steht Kinskys Schreiben im Dialog mit der Fotografie. Sie sammelt diese, exponiert sie in ihren Büchern, scheinbar als Erinnerungsfragmente. Nirgends geht es ihr um schöne Bilder, in deren Anblick wir uns vertiefen sollen. Vielmehr sind die Abbilungen klein und ganz und gar unkünstlerisch. Zufallsaufnahmen. Doch ein Foto fehlt in diesem Band, es ist das Bild der Schulklasse, das Kinsky zu den Gedichten im Mittelteil inspirierte. Wo die Kinder stumm in die Kamera schauen, hat die Autorin ihnen im Buch Stimme verliehen. Den Moment der Aufnahme aus der papiernen Fixierung gelöst, dem Dokument in der Fiktion des Gedichtes Leben zurückgegeben.
Schließlich sahen die Abgebildeten nicht, was wir sehen, erläutert die Autorin. Vereint sind die Personen nur auf dem Bild, also im Blick des Fotografen, der wahrscheinlich damals hinter dem Tuch unsichtbar war. Den Kindern jedoch dürfte sich zuvörderst zweierlei eingeprägt haben: der Zwang zum Stillsitzen, und der Blick auf das große Auge dieses unbekannten Apparates. Ehrfurcht vor der neuen Technik dürfte sich mit kindlicher Ungeduld vermischt haben. Die gedanklichen Abschweifungen, die Kinsky den Kindern erfindet, kreisen um den Stein, genau so wie der mühselige Alltag der einstigen Bewohner der Slate Islands. Eines der Kinder möchte später Sprengmeister werden, ein anderes trauert um eine tote Katze, die vom Stein erschlagen wurde, und wieder ein anderes denkt an Vogeleier, die wie Steine aussahen. Einmal heißt es:
"Nachts stößt der wind ums haus von
allen seiten ich schlafe dann nicht ich höre
die wellen und wie die steine scharren
und auch einen kiebitz im wind."
allen seiten ich schlafe dann nicht ich höre
die wellen und wie die steine scharren
und auch einen kiebitz im wind."
Dass dieser Teil des Gedichtbandes so stark im Gedächtnis bleibt, liegt sicher – auch - daran, dass die Autorin dem Foto, das man nicht sieht, in eine Geschichte eingewoben hat. Der Fotografen muss die Kinder, so erfährt man, vor der Aufnahme aufgefordert haben, still zu sitzen, sonst seien sie später auf dem Foto unscharf und sähen aus wie ein Stein. Eines der Kinder widerspricht.
"Der fotograf hat nicht die wahrheit gesagt
wie ein stein sieht aus wer stillsitzt
und nicht wer sich bewegt ich sitze
still und will auch aussehn wie ein stein."
wie ein stein sieht aus wer stillsitzt
und nicht wer sich bewegt ich sitze
still und will auch aussehn wie ein stein."
Perlentaucher
Literatur und Lyrik will den Dingen, den Aktuellen wie den Gewesenen, schreibend Dauer verleihen und sich ihrer versichern. "Zeit ist eine Schrift, die liest sich im Stein", heißt es einmal. Und ein andermal, wo es um weiße Spuren im Schiefer geht, liest man: "Das waren die Wellen der Vorzeit".
Schreiben ist bei Esther Kinsky beides: gewärtigen und vergegenwärtigen. Wie Samen tragen auch die Wörter ihre Vergangenheit und ihre potentielle Zukunft in sich; sie trumpfen nicht auf, sind keine readymades, finden sich immer neu zusammen um aus sich heraus zu sprechen. Die Gegenwart sei der stete Motor der Vergangenheit, liest man, und nichts bleibe wie es ist, denn jeder Augenblick verwandele sich im Augenblick seines Geschehens bereits in Vergangenheit und verschwistere sich von dort aus über Klang und Rhythmus mit Fremden und Erfundenem.
"immer wieder neue belichtungen überlagern einander, immer wieder neue tonlagen, in denen der aus wachsender ferne gerufene name erklingt."
Ein Eigenleben der Wahrnehmung hebt an, Erinnertes wie verloren Geglaubtes – alles kommt zu seinem Wort. Mit dem Ende des Schiefer-Abbaus verstummten und verschwanden die Schachtkundler, Goldammer und Brachvögel fanden sich ein. "Wörter aus "zweierlei Stein", liest man und denkt einerseits ganz materiell an das Schreiben auf Schiefertafeln, wie es noch in Kinsky Kindheit selbstverständlich war, und andererseits an zusammengesetzte Wörter, welche die Gedichte bevölkern: Mutmaßungsspleiße, Wasserschneider, Erinnerungsader oder Ausbruchsgestein.
Vom Übersetzen
Esther Kinsky ist eine nomadische Autorin. Sie wandert leidenschaftlich, und mehrfach hat sie bereits ihren Lebensmittelpunkt gewechselt. Aufgewachsen im Rheinland, hat sie u.a. in London und Ungarn gelebt, genauer gesagt: nahe der rumänisch-ungarischen Grenze. Zwischenzeitlich war sie in Berlin. Derzeit lebt sie mehrheitlich im Friaul. Gertrude Stein hat einmal gesagt: "Wozu sind Wurzeln gut, wenn man sie nicht mitnehmen kann", Doch Kinsky, so hat man den Eindruck hat ihre Wurzeln nicht nur in die Fremde mitgenommen, sondern dort auch gefestigt. Neben dem Schreiben übersetzt sie, Dichtung und Prosa, heute zumeist aus dem Englischen, früher auch aus dem Polnischen, Russischen, Französischen. In Schiefern findet man immer wieder englische Namen und Bezeichnungen. Was verbindet ihr Schreiben mit dem Übersetzen? In ihrem Buch "Fremdsprechen" sagt sie:
"Die Praxis des Übersetzens ist vielleicht besser als jede andere Übung geeignet, die eigene Stimme zu finden, zu schleifen, zu klären. Übersetzend probiert man ganz verschiedenes Handwerkszeug aus. Man lernt die Mittel der eigenen Sprache an den spezifischen Schönheiten und Schwierigkeiten anderer Sprachen auszuloten. Die Formbarkeit auf eine Weise zu prüfen, die der ausschließliche Umgang mit der eigenen Sprache nicht bieten kann."
Die Übersetzung, so fährt sie fort, sei der Inbegriff des Schaffens, der Lehm, aus dem man die eigene innere Sprache forme. Und tatsächlich: Ihre Übersetzungen "erlösen" das Potential der jeweiligen Originale, im Walter Benjamin’schen Sinne.
Sie setzen die fremde Sprache den Möglichkeiten des Deutschen aus. Ein Beispiel: Als Esther Kinsky einen Roman der polnischen Autorin und Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk übersetzte, fand sie für den Titel eines der Romane, der auf Englisch ganz unscheinbar "Runner" heißt, das deutsche Wort "Unrast". Ein eher ungebräuchliches Wort, zwischen "Unruhe" und "Rastlosigkeit " angesiedelt, dem etwas Altertümliches anhaftet. Im Grimm’schen Wörterbuch liest man, das Wort "Unrast" sei aus dem Schriftdeutschen lange Zeit ausgewandert gewesen und erst über den Umweg des Dialektes zögerlich wieder zurückgekommen. Nach wie vor ist sein Dasein fragil, und gleichzeitig eröffnet sich in dem Wort "Rast" eine weite Metaphorik. In einem Vortrag sagte Kinsky einmal:
"Zu einem Wort gehört nicht nur sein Klang, sondern auch die vielleicht nicht immer bewusste und ‚vorhandene‘, aber dennoch irgendwo angesiedelte und bleibende Erinnerung an die von Sinneswahrnehmungen begleitete erste eigenständige Nutzung dieses Wortes als ‚Namen‘ für etwas. Ein Wort hat für jeden Sprecher, Schreiber, Beschreiber und Übersetzer einen – wertfrei gesprochen – ‚sentimentalen‘ Wert, und wer über mehrere Sprachen verfügt, wird den Bezeichnungen ein und derselben Sache in den einzelnen Sprachen einen unterschiedlichen sentimentalen Wert beimessen."
Worte mit verschiedenstem Sentimentalen Wert geistern auch durch "Schiefern". Man liest vom "duckigem hagedorn", von "narrengold" und von "katzenkirschharz"; eines der Gedichte trägt den Titel "Mannsblut", ein Johanniskraut, das wie man im Wörterbuch nachlesen kann, den Namen ihrem roten Saft verdankt, während man bei dessen englischer Bezeichnung "sweet amber", die auch im Gedicht vorkommt, an das Bernsteingelb der Blüten denkt.
Wörterbücher
Warum eigentlich benutzen wir Wörterbücher, wenn wir Gedichte lesen, fragte einmal der Dichter Thomas Kling und zitierte, wie als Antwort Hölderlins Klage "Ach, wir kennen uns wenig!" Ob Oswald Egger, Thomas Kling oder Esther Kinsky - sie alle bereichern auf je unterschiedliche Weise das eigene Sprechen aus dem Heute durch das Studium anderer Sprachspeicher, Wissensgebiete, Fachsprachen. Wortkombinationen.
Susanne Lange, die sich für ihre Übersetzung des "Don Quijote" mit zeitgenössischer Lyrik ebenso wie mit der Dichtung des Barock beschäftigte, spricht von "gierigen Sprachkünstlern", die alles aufklauben, wenn es nur ihre Ausdrucksmöglichkeiten erweitert. Und so der Welterweiterung dient, möchte man hinzufügen. Doch anders als Kling oder Egger sucht Kinskys Dichtung selten das spielerische Moment, das Freispiel, das sich meist aus Form generiert.
Absichtlose Aufmerksamkeit
Das Faszinierende an Kinskys Kunst, ist dass uns ihre exakte Wahrnehmung direkt anspricht. Auch dort, wo wir uns nicht auskennen. Wir lesen körperlich. Sie verteidigt – und das ist hochaktuell – dass es etwas anderes gibt als Illusion und Ideologie, dass gerade unsere heutige, umbrüchige Zeit eine absichtslose Aufmerksamkeit braucht. Nur so können wir die eigene Verbindung zur Wirklichkeit und unsere Verbundenheit mit ihr stärken.
Iain Galbraith, der Dichter und Kinsky-Übersetzer, schrieb einmal, Kinskys Lyrik lese die Welt mit allen Sinnen und horche in vergessene Schichten hinein. Und tatsächlich wird in ihrer Dichtung die Sprache selbst zum Ereignis; sie bleibt in Bewegung, immer auf der Suche, den Klangschichten auf der Spur. Die Dichtung, hat Kinsky einmal geschrieben, sei ein "hütetier für die unzahme schar von ferne gerufener worte".
Ein poetisches Programm. Schon immer haben sich Dichter diesem verschrieben, meist aus Sprachnot, und immer mit der Hoffnung auf Neubewirtschaftung – auf Neubewirtschaftung der bedrohten Sprachräume, des Denkens und des Sinnens. Vielleicht ist Esther Kinsky doch auf ganz eigene Weise eine Naturlyrikerin, denn: indem sie den poetischen Ursprung der Wörter freilegt, legt sie uns auch die ursprüngliche Rolle der Natur in der Sprache offen. Das ist große Kunst.
Esther Kinsky: "Schiefern – Gedichte"
Suhrkamp Verlag, Berlin. 103 Seiten, 24 Euro.
Suhrkamp Verlag, Berlin. 103 Seiten, 24 Euro.