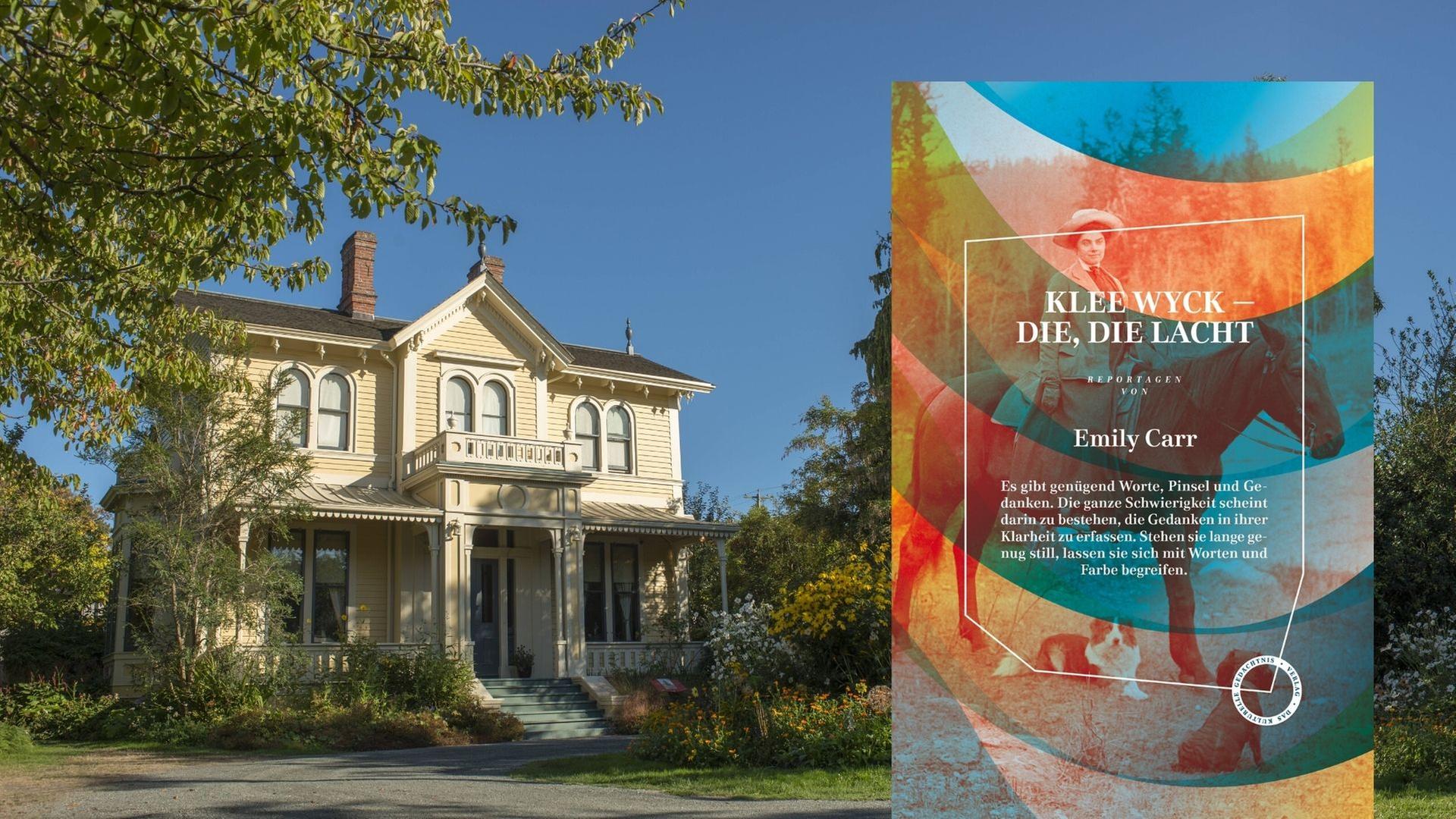"Ich zeige Ihnen, wo die Residential School stand – wir laufen jetzt quasi in das Schulgebäude hinein. Es verlief von dieser Ecke hier bis zur anderen Seite des Gebäudes dort. Und irgendwo hier ist der Friedhof. Wir müssen herausfinden, wo genau."
Dave Schaepe leitet das Forschungszentrum der Stó:lō First Nation im Südwesten Kanadas. Er läuft über eine Wiese im Fraser Valley, in der Ferne ragen Berge in den Himmel, ein Adler kreist.
Der Archäologe arbeitet als einer von wenigen weißen Kanadiern auf dem Gelände des Reservats. Ihm und seinem Team steht eine gewaltige Aufgabe bevor: Sie suchen die unmarkierten und undokumentierten Gräber von indigenen Kindern, die ihre Schulzeit nicht überlebt haben: Am Coqualeetza Industrial Institute und an der benachbarten St. Mary's Indian Residential School.
"Wir wissen von mindestens 21 Kindern, die in St. Mary’s gestorben sind; aus Coqualeetza sind genauso viele Todesfälle gemeldet. Aber die Dunkelziffer kann sehr hoch sein: Am Internat in Kamloops starben offiziell mehr als 50 Kinder; und jetzt wurden dort 215 Gräber gefunden. Auf so ein Szenario müssen wir uns auch einstellen."
"Wo gibt es das schon, dass Schulkinder sterben?"
Erst jüngst – im Mai dieses Jahres - wurden am früheren Indigenen-Internat von Kamloops die Spuren von 215 Kindergräbern gefunden. Mithilfe von Bodenradar-Messungen. Seither suchen Kanadas indigene Völker, die sogenannten "First Nations", die Inuit und Métis im ganzen Land nach Gräbern von Schulkindern. Finanziert wird die Suche mit 110 Millionen kanadischen Dollar, etwa 73 Millionen Euro – Geld, das die Regierung von Premierminister Justin Trudeau bereitgestellt hat.
"Ich habe erst vor kurzem mit der Verwaltung des katholischen Oblaten-Ordens gesprochen, der das St. Mary’s-Internat in Mission betrieben hat. Sie haben kaum Aufzeichnungen und keine Karte des Friedhofs. Ich frage mich natürlich warum nicht. Und warum schafft es ein Orden nicht, sich um die Kinder, die ihm anvertraut wurden, zu kümmern? Wo gibt es das schon, dass Schulkinder sterben? Schule und Tod haben normalerweise nichts miteinander zu tun."

Diese sogenannten "Schulen" haben ihren Ursprung in einem Gesetz, dem "Indian Act", verabschiedet im Jahr 1876. Trotz aller Appelle, das Gesetz zu reformieren oder ganz abzuschaffen, ist es bis heute mit wenigen geringfügigen Änderungen in Kraft. Der "Indian Act" legte die Grundlage für die weitgehende Entrechtung der Indigenen in Kanada und ihre Umsiedlung in Reservate unter weißer Aufsicht. Die damalige Regierung stellte die First Nations als unzivilisiert und unmoralisch dar - um dieses sogenannte "Indianerproblem" zu lösen, wurde eine aggressive Assimilation in der frühen Kindheit empfohlen.
Mehr als ein Jahrhundert lang entrissen nachfolgende Regierungen dann etwa 150.000 Kinder der First Nations, der Inuit und der Métis ihren Familien. Sie verschleppten sie, brachten sie in 139 Internate in ganz Kanada, in so genannte "Residential Schools". Der Staat zahlte den Unterhalt, die Kirchen betrieben die Einrichtungen. Und das bis in die 1990er-Jahre hinein.
Sprechen der Muttersprache wurde streng bestraft
All das hat eine Wahrheits- und Versöhnungskommission von 2008 bis 2015 herausgefunden und dokumentiert, eine Kommission, die die kanadische Regierung infolge einer Sammelklage von Indigenen einrichten musste.
"Ich erinnere mich daran, wie ich mit meinem Vater vor einem Schalter stand, er hielt meine Hand. Weil ich so klein war, konnte ich nicht sehen, wer auf der anderen Seite war. Dann kam dieser große weiße Mann hervor, und mein Vater händigte mich dem Fremden aus. Mein Vater ging weg, ohne etwas zu erklären und ohne sich von mir zu verabschieden. Als wäre ich ein Gefäß, das man einfach so übergeben kann."
Vera Jones war erst fünf Jahre alt, als ihre Eltern gezwungen wurden, sie in ein Internat zu geben. Vom "Department of Indian Affairs", der Abteilung für indianische Angelegenheiten im Innenministerium. 70 Jahre später sitzt sie auf einer Veranda im Reservat der Squamish First Nation und erzählt ihre traumatische Geschichte.
"Wir gingen in dieses Gebäude und niemand sagte ein Wort. Ich weiß noch, wie unheilvoll es sich anfühlte. Mein erster Gedanke war: 'Ich muss das hier überleben.' Ich nahm mir vor, genau zu tun, was mir befohlen wird."
6.000 Indigene, die die "Residential Schools" überlebten, sagten zwischen 2008 und 2015 vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission aus. Auch Vera Jones. Der Abschlussbericht dokumentiert, dass Kinder systematisch sexualisierter, physischer und emotionaler Gewalt ausgesetzt waren. Ein System, in dem sie schwer bestraft wurden, wenn sie beim Sprechen ihrer Muttersprache oder der Pflege der eigenen Kultur erwischt wurden.
"Die Mitarbeiter hatten es auf mich abgesehen: An mir demonstrierten sie, was geschieht, wenn jemand nicht gehorcht. Immer wenn ein neues Kind angekommen war, rief die Aufseherin mich beim Abendessen auf. Sie schlug mir mit einem Lineal, einem Ledergürtel oder der flachen Hand auf die Hand oder auf den nackten Hintern. Ich habe mich sehr dafür geschämt, dass die anderen Kinder mich nackt sahen."

Einmal wurde sie mit anderen Kindern beim Fangenspielen im Dunkeln erwischt.
"Wir hatten so viel Spaß – bis die Tür aufflog und die Aufseherin dastand. Sie rief uns einzeln heraus und – whack – schlug sie mir auf mein Ohr. Ich hörte etwas platzen. Und dann hörte ich gar nichts mehr."
Denn die Aufseherin hatte der damals Achtjährigen auch auf das andere Ohr geschlagen, beide Trommelfelle rissen, sie wurde taub. Erst als die Ohren sichtbar entzündet waren, wurde sie notdürftig behandelt.
"Weil ich nichts mehr hörte, fand ich keine Freunde mehr. Das hat mir den Rest gegeben."
Fünfzehn Jahre später, nach ihrer Entlassung, ließ sich Vera Jones operieren, kann heute mithilfe von Hörgeräten wieder halbwegs hören.
Bislang 4.117 Todesfälle dokumentiert
Die Wahrheits- und Versöhnungskommission hat festgestellt, dass es sich bei der Zwangsassimilation um einen Ethnozid, einen kulturellen Völkermord, handelte. Demnach hatten die Internate nicht die Aufgabe, den Kindern, so wörtlich: "akademische Bildung zu vermitteln, sondern ihre Identität und ihre Kultur zu brechen".
Offen bleibt die Frage, ob es sich auch um einen Genozid handelte, also das bewusste Töten vieler Mitglieder einer Gruppe oder das Zerstören ihrer reproduktiven Fähigkeiten. Für eine solche Aussage fehlte der Kommission das Mandat; sie stellte jedoch fest, dass Tausende Kinder starben – durch Infektionen, Suizide, Unterernährung, Tuberkulose oder Unterkühlung auf der Flucht.
Das Nationale Wahrheits- und Versöhnungszentrum hat mittlerweile 4.117 Todesfälle dokumentiert – eine Zahl, die sich im Zuge der aktuellen Recherchen und neuer Recherchemethoden vervielfachen könnte. Nach Kamloops wurden schon mehr als 1.000 weitere Gräber auf drei Internatsgeländen gefunden – in wie vielen Schulkinder beerdigt wurden, wird noch untersucht.
Neben vielen Fragen, die unbeantwortet sind, bleibt doch eine Frage ganz besonders im Raum stehen:
Wie konnte es geschehen, dass ein solches System länger als ein Jahrhundert lang fortbestand? Kanadas "First Nations" wussten all die Jahre von den Todesfällen – viele Indigene vermissen Geschwister und Klassenkameraden bis heute, einige hatten selbst Gräber ausheben müssen. Doch sie wurden nicht rechtzeitig angehört.
Forderung: Vatikan soll Akten herausgeben
Und auch andere Initiativen blieben folgenlos. 1907 etwa beauftragte Kanadas damalige Regierung ihren Berater Peter Bryce damit, den Gesundheitszustand der Internatskinder zu untersuchen. Der Arzt stellte fest, dass die Unterfinanzierung und die schlechten Lebensbedingungen der Kinder in den Internaten zu extrem hohen Todesraten führten. Das Department of Indian Affairs verhinderte die Veröffentlichung des Berichts. Bryce wurde entlassen.
Kanada nutzt jede Gelegenheit, um sich für Menschenrechte weltweit einzusetzen – den Ethnozid im eigenen Land ignorierte die Öffentlichkeit jedoch über Jahrzehnte.
Erst als Radarmessungen in diesem Sommer die unzähligen Grabfunde dokumentierten, reagierten die Kanadier mit Schock und Scham.
Seit jetzt vier Monaten sind die Fahnen an öffentlichen Gebäuden im Land auf Halbmast; Premier Justin Trudeau will sie erst wieder hochsetzen lassen, wenn indigene Gruppen es für angemessen halten. Museen, Geschäfte und Kirchen haben Gedenkstätten errichtet. In Toronto wurde eine Statue von Egerton Ryerson, einem der Ideengeber für das Internatssystem, vom Sockel geholt. Nach einem offenen Brief von 300 Professorinnen und Professoren wurde beschlossen die dortige Ryerson University umzubenennen.
Auch der 30. September ist inzwischen ein besonderer Tag. In diesem Jahr begeht das Land erstmals den sogenannten "Wahrheits- und Versöhnungstag" – im Gedenken an die 150.000 Kinder, die ihren Eltern genommen wurden. Kanadas Regierung hat sich 2008 offiziell entschuldigt und mehr als drei Milliarden kanadische Dollar an Überlebende ausgezahlt.

Seit Jahren fordern die Indigenen, dass sich auch der Papst in Rom entschuldigt und Dokumente herausgibt, die Klarheit über weitere Grabstätten bringen könnten. Die Appelle von Trudeau und drei kanadischen Erzbischöfen bewegten Papst Franziskus schließlich dazu, Indigenen-Vertreter nach Rom einzuladen - für den kommenden Dezember. Ob dort eine päpstliche Entschuldigung vorbereitet wird – ganz nach dem Vorbild der Entschuldigung gegenüber irischen Heimkindern –, ist ungewiss.
Erst vor wenigen Tagen demonstrierte die kanadische Bischofskonferenz Reue und sprach eine Entschuldigung aus. Eine Geste, die den Indigenen nicht ausreicht. Bislang hat es die katholische Kirche vermieden, über die Internate zu sprechen. Der Deutschlandfunk hatte vor der aktuellen Stellungnahme Interviews zu den "Residential Schools" angefragt - bei der kanadischen Bischofskonferenz und dem Erzbischof von Vancouver. Die Anfragen wurden abgelehnt oder blieben unbeantwortet.
Drei Generationen der Trennung von den Eltern
Die Zwangsinternate sind kein historischer Sonderfall – auch wenn Premier Trudeau sie wiederholt als "dunkles Kapitel" der kanadischen Geschichte bezeichnet hat…
Noch immer trennt der Staat überproportional viele indigene Familien gegen ihren Willen; die Kinder landen nicht mehr in Internaten, sondern werden in Pflegefamilien untergebracht, meist außerhalb ihrer Communities. Ein indigenes Kind in Kanada hat ein 13 Mal höheres Risiko, von seinen Eltern getrennt und in Pflege gegeben zu werden als ein nicht-indigenes Kind. Zahlen, die auch Premier Trudeau "inakzeptabel" nennt.
"Ich bin indigen, doch als Zweijährige wurde mir all das genommen
In einem Haus, das nicht zu mir passte, musste ich unterkommen.
Ich bin indigen, von meiner Familie getrennt im Millenial Scoop
Diesem systematischen Fluch, diesem unendlichen Loop,
Ich bin indigen und die Freiheit in diesem Land,
wird Leuten wie mir nicht anerkannt."
In einem Haus, das nicht zu mir passte, musste ich unterkommen.
Ich bin indigen, von meiner Familie getrennt im Millenial Scoop
Diesem systematischen Fluch, diesem unendlichen Loop,
Ich bin indigen und die Freiheit in diesem Land,
wird Leuten wie mir nicht anerkannt."
Natasha Okemow trägt ihr eigenes Gedicht vor. Das Jugendamt trennte sie von ihrer Mutter und ihrer Community, der Bunibonibee Cree Nation im Norden Manitobas – gegen den Willen der Familie. Da war sie zwei Jahre alt. Bis zu ihrem 21. Lebensjahr lebte sie als Natasha Dominique Reimer in zwölf verschiedenen Pflegefamilien in fünf verschiedenen Städten. Dass sie indigen ist, erfuhr sie erst als Erwachsene.
"Warum ich aus meiner Familie genommen wurde, ist mir immer noch nicht ganz klar. Meine Großmutter war auf einer Residential School. Wie so viele Überlebende musste sie ihre Kinder abgeben. Meine Mutter wuchs also in Pflegefamilien auf, was wiederum dazu führte, dass man auch ihr nicht zutraute, sich um uns zu kümmern. Das Jugendamt hat ihr keine Wahl gelassen."

Erfolgreiche Beschwerde beim Menschengerichtshof
Cindy Blackstock kennt das Problem; sie hat zehn Jahre lang als Sozialarbeiterin in North Vancouver gearbeitet.
"Der Staat gewährt indigenen Kindern nur einen Bruchteil der öffentlichen Dienstleistungen, die anderen - nicht-indigenen - Kindern zustehen. Es gibt "First-Nations"-Familien ohne Strom und sauberes Wasser, die obendrein auch noch weniger Unterstützung bekommen. Doch die Jugendämter fragen nicht, was Kanadas Regierung gegen diese Diskriminierung unternimmt. Sie fragen: Warum beseitigen die Eltern diese Risikofaktoren nicht?"
Cindy Blackstock kündigte, wurde Professorin an der renommierten McGill University in Montreal und legte zusammen mit der Versammlung der "First Nations" und ihrer eigenen NGO, der Caring Society, Beschwerde beim Kanadischen Menschengerichtshof ein. Ihr Vorwurf: Der Staat diskriminiere die 163.000 indigenen Kinder in Reservaten und ihre Familien, weil sie deutlich weniger erzieherische, beratende und medizinische Unterstützung bekämen als nicht-indigene Familien – und das, obwohl sie im Gegenteil mehr Hilfe bräuchten, um das Trauma der Zwangsinternate zu bewältigen.
Die Regierung des konservativen Ex-Premiers Stephen Harper focht die Klage neun Jahre lang an, ließ Professorin Blackstock sogar illegalerweise überwachen – am Ende aber bekam sie Recht. Das Gericht ordnete die Gleichbehandlung von indigenen Familien an. Darüber hinaus Entschädigungen für etwa 50.000 Kinder, die seit 2006 von den Eltern getrennt wurden. Das war 2016.
Ein historischer Richtspruch. Doch bis heute, also fünf Jahre später, hat die Regierung von Premierminister Trudeau nur einen kleinen Teil davon umgesetzt, und auch das nur nach jahrelangen gerichtlichen Aufforderungen.
"In meiner Familie werden die Kinder seit mehreren Generationen von ihren Eltern getrennt. Als junge Frau, die irgendwann selbst Kinder haben möchte, macht mir das Angst."
"Gefühl, dass mich dieses System immer verfolgen wird"
Natasha Okemow ist heute 27 Jahre alt und aus dem System entlassen. Sie studiert und setzt sich mit der NGO "Youth in Care" für Kinder in Pflegefamilien ein. Doch in vier der zehn kanadischen Provinzen werden noch immer sogenannte "birth alerts" praktiziert. Wenn Okemow dort ein Kind bekommen würde, müssten die Krankenhausmitarbeiter das Jugendamt alarmieren – nur, weil Okemow in Pflegefamilien aufgewachsen ist. Ihr neugeborenes Baby könnte ihr dann ohne Weiteres weggenommen werden.
"Es ist beängstigend mit der Frage zu leben, ob die Regierung zurückkommt und mir diesen nächsten Lebensabschnitt versperrt. Ich habe das Gefühl, dass mich dieses System immer verfolgen wird."

Mit dem sogenannten "Indian Act" aus dem Jahr 1876 wollte die kanadische Regierung den Indigenen einst ihre Identität nehmen. Für lange Zeit ist ihr das gelungen. Vera Jones und Natasha Okemow wohnen heute Tausende Kilometer vom Land ihrer Herkunft entfernt, sie sind ohne ihre Sprachen und ohne ihre ursprünglichen Nachnamen aufgewachsen. Vera Jones musste ihre Kinder in Pflege geben, Natasha Okemow hätte ihre Familie beinahe nicht wiederfinden können – das Jugendamt hatte die relevanten Informationen in ihrer Akte gelöscht.
Doch wie viele andere Überlebende des Internats- und des Pflegesystems eignen sich die beiden Frauen heute die eigene, indigene Kultur an, die ihnen vorenthalten wurde: Um ihr Trauma zu bewältigen. Und um Widerstand zu leisten.
"Meine Großmutter will über bestimmte Dinge nicht reden. Die Erinnerung an die Internatszeit schmerzt sie noch immer. Aber ich sehe so viel Widerstandskraft in ihr, und so viel von mir selbst. Sie haben uns die Familien und Gemeinschaften geraubt. Aber etwas haben sie uns nicht nehmen können: unsere Liebe zueinander."
(*) Im Teaser haben wir eine Angabe zum Beginn der Aufarbeitung in Kanada korrigiert.