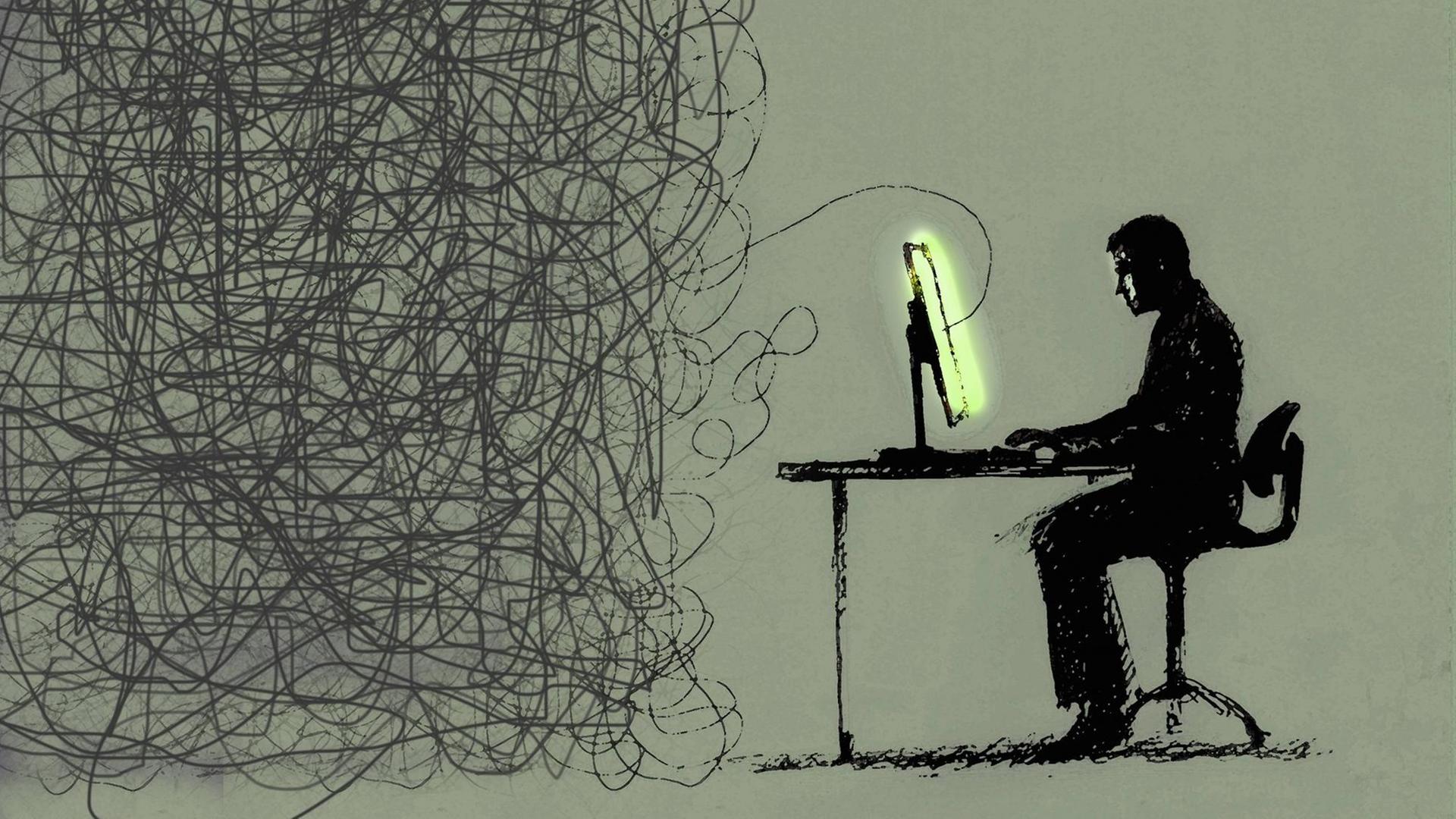Christoph Heinemann: Die Digitalisierung steht als Überschrift über dem EU-Gipfel in Tallin. Die Staats- und Regierungschefs der meisten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union treffen sich dort. Diese Digitalisierung wird unser Leben, unser Nutzungsverhalten auch in Zukunft ändern. Dieser Satz stimmt in jedem Fall. Wie und wie weit das gehen wird, steht noch nicht fest.
Digitalisierung findet etwa statt in der Gerätegemeinschaft zwischen Auto und Smartphone, oder wenn der Kühlschrank im Internet selbständig Nachschub bestellt, vielleicht sogar, weil dieser Kühlschrank weiß, dass abends die Lieblings-Fußballmannschaft des Eigentümers spielt und der an solchen Abenden gern Bier trinkt.
Als digitale Zukunftswerkstatt gilt in der Welt nach wie vor das nach dem chemischen Element Silicium benannte Tal in Kalifornien und dort im Silicon Valley hat Christoph Keese gelebt und gelernt, studierter Volkswirt, als Journalist Chefredakteur der Financial Times Deutschland, der Welt am Sonntag und nun Unternehmer, Executive Vice President Axel Springer. Ich habe Christoph Keese gestern Abend gefragt, welche die wichtigste Lehre war, die er aus dem Silicon Valley mitgebracht hat.
Christoph Keese: Dass Schnelligkeit, Kreativität und Gründlichkeit sich nicht gegenseitig ausschließen. Wenn man im Silicon-Valley-Stil arbeitet, kann man enorm kreativ sein und schnell zur gleichen Zeit. Das hat mich überrascht, das hatte ich in dieser Form vorher noch nicht gesehen.
Produkte schmaler gestalten, schneller auf den Markt bringen
Heinemann: Auch in Deutschland nicht?
Keese: Nein, das hatte ich in Deutschland noch nicht gesehen. Wir neigen in Deutschland ja – und das ist auch gut und richtig – zu einer gewissen Gründlichkeit. Aber man kann auch gründlich sein und trotzdem schnell sein, indem man die Produkte, an denen man arbeitet, einfach schmaler gestaltet. Im Silicon Valley spricht man von den sogenannten "Minimum Viable Products", den sogenannten MVPs. Das sind Produkte, die es bewusst nicht darauf anlegen, ganz viele Qualitäten, ganz viele Eigenschaften zu haben, sondern ganz bewusst schmal geschnitten sind, ganz kleine Ansätze mit einer Funktion, die perfekt gemacht ist, um dann sich in den Markt hinein zu begeben und in einer ständigen Rückkopplungsschleife mit dem Publikum das Produkt von da aus, von dieser kleinen Variante aus weiterzuentwickeln.
Heinemann: Können Sie bitte ein Beispiel nennen?
Keese: Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Als WhatsApp – und viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sicherlich WhatsApp benutzen – auf den Markt kam, hat WhatsApp nichts anderes gemacht, als besseres SMS zu liefern – nur Texte. Es gab keine Audiofunktion, keine Videofunktion, man konnte keine Bilder schicken, nur diese eine Funktion. Diese Funktion war aber erheblich besser als alle SMS-Funktionen, die es bis dato auf Smartphones gab. Also haben die Leute angefangen, WhatsApp zu benutzen. Als damit ein großer Publikumskreis aufgebaut war, hat man von da aus dann begonnen, Bilder schicken zu können. Dann kamen Töne dazu, die man schicken konnte. Dann kam Live-Audio, also Telefonieren dazu. Dann ist Video-Chat dazugekommen, immer Stück für Stück. Der traditionelle europäisch-deutsche Ansatz wäre gewesen, all diese Funktionen von Anfang an einzubauen. Dann hätte die Entwicklungszeit viel länger gedauert und wenn das Produkt dann nicht gelaufen wäre, wenn es keine Resonanz beim Publikum gegeben hätte, hätte niemand gewusst, woran liegt es, liegt es an der einen Funktion, liegt es an der anderen. Wenn man ganz schmal anfängt, schnell ist und trotzdem gut, kann man die Frage viel besser beantworten, was beim Publikum gut ankam und was nicht.
"Der sprichwörtliche Ruck geht durch das Land"
Heinemann: Gibt es in Deutschland Branchen, die in diesem Sinne gut gerüstet sind?
Keese: In Deutschland geht der sprichwörtliche Ruck durch das Land. Das beeindruckt mich doch. Ich war vor zwei Jahren, als ich aus dem Silicon Valley zurückkam, doch eher pessimistisch gestimmt, weil die Digitalisierung aller Orten, Politik und Wirtschaft, aber auch Gesellschaft, erheblich unterschätzt wurde. Daran hat sich vieles geändert. Das heißt nicht, dass wir schon unternehmerisch viel Terrain gutgemacht hätten, in der Politik sicherlich auch nicht, aber es ist ein Erkenntnisvorgang im Laufen, der vielen klar gemacht hat, dass was getan werden muss. In vielen Unternehmen sehen wir jetzt, dass zumindest die Erkenntnis da ist, dass das Bedürfnis da ist, sich nach vorne zu entwickeln, dass Projekte angeschoben werden, dass Mittel umgeschichtet werden, dass Leute fortgebildet werden. Es gibt kaum noch Unternehmerkongresse oder Verbandskongresse, auf denen nicht das Wort Digitalisierung ganz oben auf der Agenda steht. Das ist das aus meiner Beobachtung heißeste Schlagwort zurzeit und das muss es auch sein, weil wir erheblichen Rückstand aufzuholen haben.
Plattform-Kapitalismus bringe Monopolisierung mit sich
Heinemann: Man spricht ja inzwischen vom Plattform-Kapitalismus – bedeutet, dass zum Beispiel eine Buchungsplattform schneller wächst und mehr wert ist als der Anbieter einer Leistung, eventuell die Hotelkette, die Fluggesellschaft oder die Bahn. Kann man sagen, die traditionelle Wackelordnung zwischen Hund und Schwanz kehren sich um?
Keese: Richtig. Der Vermittler der Leistung war in der Vergangenheit im analogen Zeitalter nicht in einer besseren Position zwangsläufig als der Hersteller von Waren und Dienstleistungen. In der Digitalisierung hat sich das umgekehrt. In der Tat kann man von Plattform-Kapitalismus sprechen. Plattformen sind Anbieter, die Angebot und Nachfrage zusammenbringen, ohne selber die Leistung zu erbringen, die sie vermitteln. Das können Taxifahrten sein, das können Flugreisen sein, das können Hotelbuchungen sein, das können auch journalistische Angebote sein, wo gar nicht Redaktionen beschäftigt werden, sondern die Ergebnisse der Arbeit anderer Unternehmen ausgespielt werden und Publikum und Angebot sich auf diesen Plattformen treffen.
Diese Plattformen haben ökonomisch gesehen einen großen Vorteil: Sie müssen eben nicht in die Leistungserbringung als solche investieren, sondern sie bringen "nur", das ist auch eine Leistung, aber nur Angebot und Nachfrage zusammen und bekommen dafür eine Provision. Das kann, wenn es gut funktioniert, ein sehr einträgliches Geschäftsmodell sein. Aber – und das ist ein wichtiges Aber – diese Plattformen bewegen sich fast naturgesetzlich auf ganz starke Monopole oder Duopole zu. Es gibt meistens in diesen Märkten nur ein oder zwei Unternehmen, die Geld verdienen. Alle anderen spielen keine Rolle, laufen unter ferner liefen, und diese Monopolkonzentrationen auf den digitalen Plattformmärkten geben doch Anlass zur Sorge.
Heinemann: Können Sie da auch noch mal bitte ein Beispiel nennen?
Keese: Ich will jetzt keine einzelnen Unternehmen nennen. Aber wenn man sich anschaut: Es gibt eine große Suchmaschine, die den Markt in Deutschland mit über 95 Prozent Marktanteil beherrscht. Es gibt soziale Netzwerke, auf denen alle unterwegs sind, und dahinter gibt es eigentlich so gut wie niemanden mehr. Es gibt Buchungsplattformen für Hotels, die ganz erhebliche Marktanteile mittlerweile erobert haben. In der Digitalökonomie, was Plattformen angeht, beobachten wir Marktkonzentrationen von 90, 95 Prozent für entweder den ersten alleine, oder den ersten und den zweiten gemeinsam. Das hat es in der traditionellen Wirtschaft in dieser Form nicht gegeben.
Wenn man zurückschaut in die Geschichte der Kartellrechtsprechung, sieht man, dass vor 30, 40 Jahren Unternehmen wie IBM oder AT&T aufgespalten worden sind aufgrund deutlich niedriger Marktanteile. Das heißt nicht, dass man jetzt die neuen Plattform-Monopole aufspalten sollte. Das heißt nur, dass wir uns bewusst sein sollten, dass wir es mit monopolistischen Verdichtungstendenzen auf den Plattform-Märkten zu tun haben, die wir in der bisherigen Wirtschaftsgeschichte in dieser Ausprägung noch nicht kannten.
"Zwei Formen der Innovation"
Heinemann: Werden – zurück nach Deutschland vielleicht damit – Ideen ausreichend und schnell genug finanziert in Deutschland?
Keese: Leider nein, wenn es sich um sogenannte disruptive Ideen handelt. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen zwei Formen der Innovation. Das eine ist die erhaltende, man spricht auch von evolutionärer Innovation. Das ist das, wenn es darum geht, das Stammgeschäft, die bisherigen Abläufe und Prozesse erfolgreicher zu machen mit Mitteln der Digitalisierung. Da ist Deutschland gut und stark und wenn man sich die Unternehmen eigentlich aller Branchen anschaut, stellt man einen hohen Grad an Digitalisierung fest, und dieser Grad wird noch weiter steigen. Da sind wir gut.
Wo wir nicht so gut sind, ist bei dem Gegenteil, der sogenannten disruptiven Innovation. Da geht es darum, bestehende Geschäftsmodelle anzugreifen und zu zerstören, also eben nicht sie zu erhalten und zu verbessern, sondern sie ganz bewusst zu zerstören, sozusagen eine Form von unternehmerischem Kannibalismus. Da sind wir nicht so stark. Das sind aber genau diese Geschäftsmodelle, die uns zu Leibe rücken und die den großen Erfolg der kalifornischen Unternehmen in den letzten 10, 15 Jahren begründen.
Das hat auch – und das geht auf Ihre Frage dann zurück – etwas mit Geld zu tun. Diese disruptiven Angreifer sind oft eben nicht erfolgreich, weil nur einer oder zwei das Rennen machen, was dazu führt, dass die Floprate ziemlich hoch ist, jenseits von 90 Prozent oft. Und das bedeutet, dass Banken diesen jungen Unternehmen kein Geld leihen, weil das Risiko so hoch ist. Deswegen sind die fast ausschließlich mit Eigenkapital finanziert. Und weil dieses Eigenkapital so riskant ist, spricht man auch von Wagniskapital. In Deutschland ist die Summe des ausgegebenen Wagniskapitals erschreckend gering gegenüber anderen Ländern wie den USA, wie dem Silicon Valley, aber auch gegenüber Israel.
In Deutschland werde zuwenig Wagniskapital investiert
Heinemann: Können Sie kurz Zahlen nennen?
Keese: In den USA werden pro Jahr etwa 60 Milliarden Dollar Wagniskapital investiert, davon ungefähr die Hälfte im Silicon Valley, knapp über 30 Milliarden. In Israel – das Land ist nur ein Zehntel so groß wie Deutschland – werden knapp vier Milliarden Dollar Wagniskapital pro Jahr investiert. In Deutschland gehen die Rechnungen auseinander. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass es ungefähr eine Milliarde ist. Auch das ist schon eigentlich Indikativ dafür, wie groß unser Problem mit Wagniskapital ist, dass es niemanden gibt, der eine offizielle Statistik führt. Die Zahlen schwanken zwischen 700 Millionen pro Jahr und vielleicht 1,5 Milliarden pro Jahr. Aber egal welche Zahl man sich da zu eigen macht, es ist ein Bruchteil dessen, was es sein könnte, sein müsste. Wenn wir einfach nur mal über den Daumen rechnen: Wenn die USA 60 Milliarden ausgeben und wir etwa ein Drittel so groß sind wie die USA, müssten hierzulande 20 Milliarden ausgegeben werden, um den gleichen Innovationsstand mit disruptiver Innovation zu erreichen, und von diesen 20 Milliarden sind wir weit entfernt, ungefähr um den Faktor 20 weit entfernt.
Heinemann: Wieso ist das so viel kleinere Israel so viel besser als das so viel größere Deutschland?
Keese: Das hat wie auch in Kalifornien einen wirtschaftsgeschichtlichen Hintergrund. Das sind oft Gesetzesänderungen gewesen. In Kalifornien war es eine Gesetzesänderung Ende der 70er-Jahre, die es Versicherungen und Pensionsfonds ermöglicht hat, Geld in Startups zu investieren – zu einem ganz kleinen Prozentsatz. Aber das machte dann doch eine ganze Menge aus, weil halt sehr viel Geld da ist, auch wenn der Prozentsatz nur klein ist.
In Israel ist es so, dass es vor etwa 15, 17 Jahren fast durch Zufall große unternehmerische Erfolge in der Digitalisierung gab, und diejenigen, die diese Erfolge erzielt haben, die haben das Geld wieder reinvestiert, sogenanntes Angeling betrieben, dass Leute, die durch einen Verkauf einer Firma wohlhabend geworden sind, einen Teil des Geldes wieder reinvestieren in neue Gründer, die wiederum erfolgreich werden, und so geht es dann weiter. Das kann im Falle Israels dann zu etwas wie einem perpetuum mobile werden, dann auch wirklich mit überraschenden Erfolgszahlen.
Wenn man beispielsweise das Jahr 2016 und 2015 anschaut, sieht man, dass in den USA mehr israelische Firmen, junge Technologiefirmen an die amerikanische Börse gegangen sind als amerikanische Unternehmen. Auf amerikanischem Boden haben israelische Firmen die amerikanischen Firmen sozusagen rein von der Menge, aber auch vom Wert her überholt in diesen beiden Jahren. Das ist schon ein bemerkenswerter Erfolg.
Aber nichts davon ist für Deutschland ausgeschlossen. Auch wir können diesen Erfolg erreichen. Wir haben alle Voraussetzungen, die wir benötigen. Wir müssen nur entschlossen das Richtige und das auch schnell tun.
Neue Führungskultur sei nötig
Heinemann: Das Richtige schnell – erfordert die Digitalisierung auch eine neue Führungskultur?
Keese: In der Tat. Digitalisierung zeichnet sich dadurch aus, dass unter diesem Oberbegriff zusammengefasst sehr viele technische Entwicklungen gleichzeitig verlaufen. Ich nenne als Schlagworte zum Beispiel nur Internet of Things, Gerätschaften werden miteinander verbunden, künstliche Intelligenz beispielsweise, neue Technologien wie Blockchain-Technologie, die Grundlagentechnologie für die Kryptowährung Bitcoin und viele andere Entwicklungen. Diese technischen Fortschritte verlaufen mit ungeheurer Geschwindigkeit, oft sogar mit exponentieller Geschwindigkeit und vieles passiert gleichzeitig, und das führt dazu, dass eigentlich kein menschliches Gehirn – und sei es noch so genial – in der Lage ist, all diese Entwicklungen auf einmal zu erfassen. Und wenn man es denn einmal erfasst hat, hat es sich morgen auch schon wieder geändert.
Das führt dazu, dass Unternehmensleitungen nicht mehr so wie früher, als die Veränderungsgeschwindigkeiten, die Komplexitäten niedriger waren, sagen können, hier geht es lang, das ist die strategische Richtung, also immer auch die inhaltliche Frage gleich geben. Diese Zeiten sind in der Digitalisierung doch wahrscheinlich vorbei. Es ist gefährlich, wenn man sich in Scheinsicherheiten wiegt und glaubt, es ginge in eine bestimmte Richtung, man aber nie im Vollbesitz aller Informationen sein kann. Deswegen ist es die Aufgabe von Firmenleitungen heute, geradezu gar nicht mehr aus meiner Sicht inhaltliche Antworten zu geben, sondern die Suche nach diesen Antworten zu organisieren, vielleicht sogar die Suche nach der Frage zu organisieren. Das scheint mir die wichtigste Führungsaufgabe heutzutage zu sein.
Heinemann: Das heißt, die traditionelle hierarchische Hackordnung muss kreativ zerstört werden?
Keese: Und sich verwandeln in ein Netzwerk. Nicht durch Zufall sind weite Teile der uns umgebenden Natur als Netzwerk organisiert. Auch unser Gehirn ist ein Netzwerk, zumindest in weiten Teilen. Und es scheint doch so zu sein, dass die traditionelle pyramidiale, rein hierarchisch geführte, straff gelenkte Organisation vielleicht die richtige Antwort war oder sicher die richtige Antwort war für das Industriezeitalter, wo es darum ging, Millionen von gleichartigen Produkten zu möglichst niedrigen Kosten herzustellen, aber nicht mehr die richtige Antwort für das Digitalzeitalter sind, wo die Menschen individuelle Produkte haben wollen, jeder Turnschuh anders aussehen soll als der andere Turnschuh. Am liebsten – das zeichnet sich ab- wollen die Konsumenten, die Menschen heutzutage (und ich glaube, da können wir uns auch alle einschließen) etwas ganz Individuelles für sich selber haben, und das lässt sich nicht mehr organisieren in den klassischen industriellen Strukturen. Da muss die Struktur sich ändern. Wer sich am besten und gründlichsten und schnellsten wandelt, der hat die besten Chancen.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.