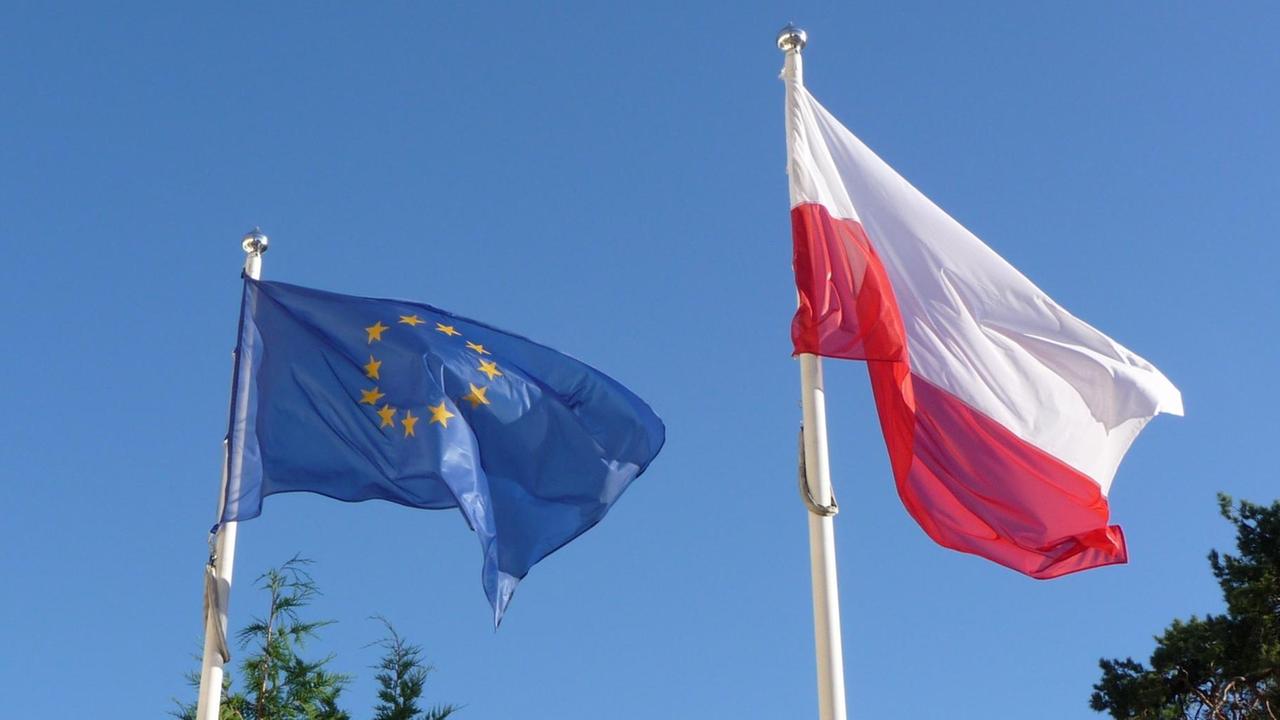Die Informationen über die Stationierung russischer Kurzstreckenraketen im Kaliningrader Gebiet kommen tröpfchenweise. Zunächst beriefen sich Medien auf Quellen im US-Geheimdienst. Dann bestätigte Russland, von Übungen war die Rede. Beim Kremlsprecher Dmitrij Peskow klang es nun, vor wenigen Tagen, schon etwas ernster: Die Iskander-Raketen dienten Russland, um seine Grenzen zu sichern, erklärte er.
Ernst nehmen die neuen Raketen vor allem die Politiker in Warschau. Von Kaliningrad bis zur polnischen Hauptstadt sind es kaum 300 Kilometer. Die Gefahr rückt näher, und das befeuere auch in Polen die Diskussion über eine engere militärische Zusammenarbeit in Europa, sagt Wojciech Luczak, Herausgeber der Zeitschrift für Militär und Rüstung „Raport“: „Ich denke, das Bewusstsein, dass wir unsere Verteidigung koordinieren sollen, wächst. Das gilt auch für Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie und in der Forschung. Das dringt langsam zu unseren Regierenden durch.“
Polen orientiert sich an den USA
Das sehen aber längst nicht alle Experten so. Denn in der Öffentlichkeit äußern sich Vertreter der polnischen Regierung weiterhin skeptisch. Das hat eine lange Tradition. In Verteidigungsfragen hielt sich Polen stets eher an die USA als an seine europäischen Nachbarn. So beteiligte sich das Land 2003 am zweiten Irak-Krieg, im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich. Es gehörte zur von den USA so genannten „Koalition der Willigen“.
Auch die Regierung der rechtsliberalen „Bürgerplattform“, die bis vergangenes Jahr im Amt war, hatte für eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik nicht viel übrig.
Deren Linie setzte der amtierende Außenminister Witold Waszczykowski von der rechtskonservativen Partei PiS vor kurzem fort, als er sagte: „Wir haben schon eine europäische Armee – und die heißt Nato. Über 20 europäische Länder gehören der Nato an. Wenn eine erhebliche Zahl europäischer Staaten nicht die geforderten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung ausgibt, wie es die Nato vorsieht, dann ist es nur schwer vorstellbar, dass wir gleichzeitig noch eine zweite Struktur schaffen.“
Misstrauen gegenüber europäischen Partnern
Polen gibt seit Jahren prozentual mehr für die Landesverteidigung aus als etwa Deutschland. Das sei ein Grund, warum Warschau den europäischen Partnern derzeit wenig zutraue, sagt Marek Madej vom Institut für Institut für internationale Beziehungen an der Universität Warschau:
„Wir haben in Europa viel nachzuholen. Unsere Armeen sind gerade in der konventionellen Kriegsführung nicht besonders gut aufgestellt – also im Zurückschlagen eines Angriffs. Und das ist es, was für uns in Polen entscheidend ist. Die Erfahrungen, die wir bei Auslandseinsätzen im Irak oder in Afghanistan gesammelt haben, lassen sich nicht so leicht auf Europa übertragen. In der traditionellen Kriegsführung ist Russland uns Europäern deutlich überlegen.“
Hinzu kommen weitere Bedenken, auch politischer Art: Viele polnische Entscheidungsträger bezweifeln, dass sich Deutschland und Frankreich ausreichend um polnische Sicherheitsinteressen kümmern. Sie haben nicht vergessen, dass sich Berlin lange dagegen aussprach, Nato-Truppen an der Ostflanke des Verteidigungsbündnisses zu stationieren.
Hält sich Donald Trump an die Verpflichtungen?
Polen bleibe deshalb vorsichtig, meint Marek Madej. Das könne sich allerdings ändern – nämlich, wenn sich der künftige US-Präsident Donald Trump tatsächlich deutlich an Russland annähere. Auf Polen gemünzt lautet die Frage: Wird die USA unter Trump die Verpflichtungen erfüllen, die sie beim Nato-Gipfel in Warschau im Sommer eingegangen ist? Wojciech Luczak: „Der US-Kongress hat schon Mittel bewilligt, um Einheiten an die europäische Ostflanke der Nato zu verlegen, nach Polen und in die Baltischen Staaten. Das ist ein kleinerer Milliarden-Betrag. Aber was wird, wenn dieses Geld aufgebraucht ist, wissen wir nicht. Wir müssen warten, in welche Richtung sich Donald Trump entwickelt.“
Auch deshalb wollen polnische Politiker im Moment lieber leise treten in Sachen europäischer Verteidigungspolitik: Sie möchten in Washington nicht den Eindruck erwecken, dass die USA in Europa bald gar nicht mehr gebraucht würden.