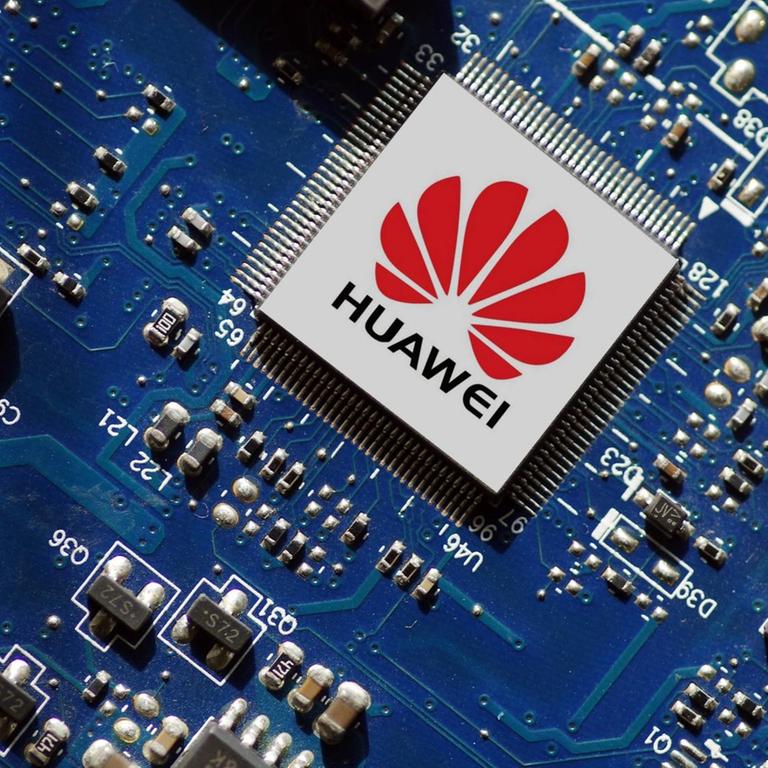Neue Barrieren, wo einst die Schlagbäume abgebaut wurden, Lieferengpässe sowohl bei Medikamenten als auch bei Schutzmasken und schließlich zu wenig Impfstoff, um die Bevölkerung schnell zu immunisieren – die Pandemie hat Europa Grenzen aufgezeigt: die eigentlich überwunden geglaubten Grenzen im Innern, die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit, die Grenzen – so sagen Kritiker – seiner Souveränität. Die Gesundheitspolitik macht es in den Augen von Franziska Brantner, Europaexpertin der Grünen im Bundestag, besonders plakativ: Die EU könne den Pflichten gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern, wenn es darauf ankommt, nicht nachkommen.
"Wenn wir zu Beginn der Pandemie merken, dass zu fast 100 Prozent die Masken, die in Deutschland gebraucht werden, in Europa gebraucht werden, aus einem Land und zwar China kommen, haben wir ja gemerkt, dass es nicht hilfreich ist, vor allem, wenn weltweit die Nachfrage steigt."
Schon vor der Pandemie wurden einige Arzneimittel knapp. Etwa Antibiotika, die kaum noch in Europa produziert werden. Als dann immer mehr Corona-Infizierte ins künstliche Koma versetzt werden mussten, fehlten wichtige Narkosemittel. Franziska Brantner hat eine klare Vorstellung davon, was dagegen helfen würde: In verschiedenen Lieferländern einkaufen, Bestellungen strategischer planen und bei der Produktion in Europa stärker politisch eingreifen.

"Das hätte ich mir in dieser Krise auch gewünscht, dass wir von Anfang an diese Möglichkeit haben, koordiniert für die Produkte, die wir auf jeden Fall brauchen, Produktionskapazitäten hochzufahren. Das haben wir jetzt auch wieder beim Impfen gemerkt, dass wir gut investiert haben, auch gut koordiniert haben - die Erforschung der Impfstoffe, aber dass wir eben nicht gut waren beim Hochfahren der Produktionskapazitäten und wir dort ähnlich wie die USA auch hätten reingehen müssen, koordinieren, regulieren, finanziell unterstützen."
Europa soll nicht nur reagieren, sondern auf Augenhöhe begegnen
Europa unabhängiger machen, nicht nur in wichtigen Versorgungsfragen – das haben sich viele Politiker und Experten vorgenommen. Sie befürchten, dass der Alte Kontinent im schärfer werdenden Wettbewerb um Einfluss und Ressourcen nicht mehr so handeln kann, wie er will, sondern nur noch so, wie es andere große Mächte zulassen: die USA auf der einen Seite, aber auch Russland und immer stärker China. "Europäische Souveränität" lautet die Formel. Europa solle nicht nur reagieren, sondern anderen auf Augenhöhe begegnen und entgegentreten, sagt Jana Puglierin, die das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations leitet.
"Dahinter steckt eigentlich der Gedanke, dass man die Welt als Arena von Großmachtpolitik begreift, wo Elefanten miteinander kämpfen. Und die Idee ist: Auch die EU muss ein solcher Elefant werden, sonst wird sie nämlich zertrampelt. Und wenn man eben so ein Akteur sein will, muss man gucken, wie kann man die Kraft, zum Beispiel den großen Markt, den die Europäische Union ja darstellt, die Wirtschaftskraft und die politische Kraft, wie kann man die so bündeln, dass man damit Hebel ansetzen kann. Und der Gedanke ist, dass die Souveränität von Einzelstaaten dazu nicht mehr ausreicht. Insofern ist europäische Souveränität ein Schritt, um überhaupt wieder handlungsfähig zu werden."
Vor allem der französische Präsident Emmanuel Macron steht für diese Idee. Schon 2017 konstatierte er in seiner Rede zur Zukunft der EU, dass die Neugründung eines souveränen Europas der einzige Weg sei, um es zu retten. Ausgerechnet der frühere amerikanische Präsident Donald Trump trug seinen Teil dazu bei, und überzeugte weitere Europäer davon, dass Europa eigenständiger werden muss. Erst kündigte Trump im Handstreich den Atomdeal mit dem Iran – den die Europäer als einen ihrer größten diplomatischen Erfolge betrachteten. Dann stellte er die Sicherheitsgarantien der NATO infrage. Seither hat die "europäische Souveränität" Karriere gemacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel geht die Formel heute wie selbstverständlich über die Lippen. Im Abschlussbericht der deutschen EU-Ratspräsidentschaft steht, man wolle gemeinsam im "Wettstreit der Großmächte" mitmischen. Und Ursula von der Leyen sieht sich als Präsidentin einer "geopolitischen EU-Kommission". Die "europäische Souveränität" ist in aller Munde. Das einzige Manko: Man scheint sich nicht einig darüber zu sein, was genau mit dem Begriff gemeint ist.
"Er drückt die Sehnsucht nach mehr Eigenständigkeit aus, mehr Gewicht auf der Waage, mehr breite Brust, wenn ich das ganz platt sagen darf. Das steckt, meine ich, dahinter. Und seitdem haben wir eine babylonische Sprachverwirrung darüber, was wir eigentlich meinen. Ich würde mir erhoffen, dass damit Ambition gemeint ist, nämlich die Ambition, geopolitisches Gewicht auf die Waage zu bringen als gemeinsamer Akteur", sagt Thomas Kleine-Brockhoff, Vizepräsident und Berliner Büroleiter des "German Marshall Fund of the United States".
Streit um Begrifflichkeiten
Die Stiftung setzt sich für die transatlantischen Beziehungen ein. Kleine-Brockhoff befürchtet, dass das Streben nach europäischer Souveränität auch eine Emanzipation von Amerika und der NATO umfassen könnte. Er sieht zusätzlich aber ein innereuropäisches Problem:
"Souveränität ist staatliche Souveränität, ist nationale Souveränität. Und wer europäische Souveränität will, muss Souveränität des Nationalstaates abgeben oder teilen. Will das jemand?"
Die Sprachverwirrung, die er anspricht: Für das von Macron angestoßene Projekt werden mehrere Begriffe nebeneinander oder synonym verwendet: "Europäische Souveränität" zum einen, vor allem von französischer Seite auch "strategische Autonomie", manchmal auch die Mischung "strategische Souveränität" und, relativ neu, "offene strategische Autonomie", um nicht den Verdacht zu erregen, man meine es protektionistisch.
"Und das hat dazu geführt, dass wir uns hervorragend verbal bekriegen konnten über die Begrifflichkeiten und uns darüber nicht so sehr um die Umsetzung kümmern mussten, die nämlich eigentlich viel schwieriger ist", sagt Claudia Major, Sicherheitsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, die unter anderem Bundesregierung und Bundestag berät.
Die EU spreche dort, wo sie Politik als Gemeinschaft verfolgt, nach außen schon mit einer Stimme, sagt sie, etwa in der Handelspolitik. In der Sicherheitspolitik gebe es bislang weniger Verständigung. Major glaubt aber nicht, dass die europäische Initiative als Abgrenzung gegenüber den USA und der NATO zu verstehen ist, sondern:
"Dass die Europäer in der Lage sein müssen, eigene Prioritäten zu definieren, über die Fähigkeiten zu verfügen, diese umzusetzen, zusammen mit Partnern oder allein. Es geht dabei nicht um Unabhängigkeit oder es geht auch nicht um Autarkie. Es geht auch nicht darum, Allianzen oder Partner zu verwerfen, vor allem nicht die USA, vor allem nicht im Sicherheitsbereich, weil die Europäer mit Partnern in allen Politikbereichen immer besser aufgestellt sein werden."
Das allerdings überzeugt nicht alle. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, erteilte Macrons Ideen eine brüske Absage und leistete sich im vergangenen Herbst einen recht undiplomatischen Schlagabtausch mit dem französischen Präsidenten. Strategische Autonomie sei eine "Illusion", warnte sie, zumal wenn sie ohne die NATO entwickelt werde. Viele Beobachter vor allem aus Osteuropa teilen diese Skepsis. Und der französische Präsident tat bisher nicht gerade viel, um das Vertrauen zu stärken. Vor allem seine Äußerung, die Nato sei "hirntot", stieß bitter auf. Auf dem EU-Gipfel Ende Februar gestand er immerhin zu, dass das transatlantische Bündnis sich womöglich wiederbeleben lasse. Erschwerend wirkt Macrons Nähe zu Moskau. Die mache den Osteuropäern nicht gerade Lust, sich auf seine Idee von einer strategischen Autonomie einzulassen, sagt Justyna Gotkowska vom Warschauer "Center for Eastern Studies".
"Dieser Begriff meint aus Sicht von Mittel- und Osteuropäern eine Emanzipation von den USA – politisch, wirtschaftlich und militärisch. Für uns als starke Befürworter der transatlantischen Beziehungen mit den USA, ist das inakzeptabel, weil sie unsere Sicherheit an der Ostflanke garantieren. Und viele Initiativen Frankreichs sind hier sehr umstritten, zum Beispiel der ‚strategische Dialog‘ mit Russland. Wir glauben, dass die EU zu schwach ist, um Russland in Sicherheitsfragen gegenüberzutreten. Die USA müssen dabei sein. Deshalb sollten solche Gespräche nur im Rahmen der NATO stattfinden."
Verständnis von Souveränität in der EU grundlegend verschieden
Andererseits betrachten Bürger aus Staaten wie Polen, Lettland oder Rumänien die Idee einer europäischen Souveränität besonders wohlwollend. Das zeigte eine im Februar vorgestellte Umfrage der Friedrich-Ebert- und der französischen Jean-Jaurès-Stiftung. In Ländern wie Italien, Spanien oder Frankreich war die Zustimmung deutlich schwächer. Was Menschen aus verschiedenen Ländern unter dem Begriff Souveränität verstehen, unterscheidet sich grundlegend: Franzosen bringen sie überwiegend mit "Monarchie" und "König" in Verbindung, Deutsche vornehmlich mit "Unabhängigkeit" und "Freiheit". Was sie von Europas Souveränität erwarten, wissen indes viele ziemlich genau: eine prosperierende Wirtschaft, gefolgt von Sicherheit und gemeinsamer Verteidigung sowie einer gesicherten Produktion etwa von Nahrung und Arzneimitteln.
Die Idee von europäischer Souveränität und Autonomie tauchte zunächst im Bereich Sicherheit und Verteidigung auf. Aber mittlerweile erstreckt sich die Debatte auf weite Teile der europäischen Politik: Stärkung der Wirtschaft, Digitalisierung, Gesundheit, Energie und nicht zuletzt die Währungspolitik. Vor allem in Währungsfragen aber erwartet Grünen-Politikerin Franziska Brantner in Deutschland große Widerstände.
"Wenn wir über die internationale Rolle des Euros sprechen und die Möglichkeit, wirtschaftlich und finanziell auch eine eigenständige Politik haben zu können, müssen wir in Deutschland über unseren Schatten springen und bereit sein, dass ein Euro auf Dauer nur stark sein kann, wenn er auch Anleihen ausgeben kann."
Die Idee dahinter: Wenn Europa den Euro international als Reservewährung besser etablieren könnte, würde das den wirtschaftlichen und politischen Einfluss der Staatengemeinschaft stärken. Dafür müsse es der EU aber möglich sein, gemeinsam Schulden aufzunehmen, sagt Brantner, mit sogenannten "Eurobonds". Die brachte jüngst der italienische Premier Mario Draghi wieder ins Spiel. Die Bundesregierung verwahrt sich bislang aber vehement gegen ein gemeinsames Schuldeninstrument. Gegner der Eurobonds befürchten eine sogenannte "Schuldenunion", in der wirtschaftliche starke Mitgliedsstaaten dauerhaft für schwächere aufkommen. Jana Puglierin vom "European Council on Foreign Relations" hält es allerdings für möglich, dass das Ziel der europäischen Souveränität der Idee nun mehr Unterstützung verschaffen könnte.
"Der Euro ist auch etwas, was uns hilft, als internationaler Spieler gestaltungsfähig zu sein. Es reden ja alle davon, wir wollen die internationale Rolle des Euros stärken, wir wollen den Euro, vielleicht ähnlich dem Dollar, international positionieren. Der Gründungsgedanke wäre dann zu sagen: Wir haben ein Interesse an einem sehr starken Euro, um international mitreden zu können. Um das zu erreichen, müssen wir Integrationsschritte im Innern gehen, die wir sonst vielleicht nicht gehen würden."
Fiskalpolitik ist nicht die einzige Hürde
Ein erster Schritt in die Richtung ist im Grunde schon getan: Der Corona-Wideraufbaufonds in Höhe von 750 Mrd. Euro, der im vergangenen Jahr vereinbart wurde, sieht gemeinsame Schulden vor. Das soll nach dem Willen der Bundesregierung aber die große Ausnahme in dieser beispiellosen Krise bleiben. Die Ratifizierung steht in mehreren Staaten aus, darunter in Deutschland. Doch der Bann ist gebrochen: Viele Länder sind über ihren Schatten gesprungen und haben gemeinsamer Verschuldung zugestimmt.
Die Fiskalpolitik ist nicht die einzige Hürde, die Franziska Brantner sieht. Ihrer Ansicht nach bringen beste Absichten nichts, wenn es Deutschland aus Angst ums Exportgeschäft vermeide, vor allem den wichtigen Handelspartner China zu erzürnen. Eine Möglichkeit für eine klar europäische Haltung ist, so Brantner, der Aufbau der digitalen 5G-Infrastruktur. Ein Deal mit dem chinesischen Anbieter Huawei berge die Gefahr, dass europäische Daten an die chinesische Führung gehen. Dennoch ziere die Bundesregierung sich, den Konzern auszuschließen.
"Da halte ich es im Sinne von ‚Wir müssen resilient sein und unsere eigene Bevölkerung schützen können‘ für absurd, dass wir in Deutschland nicht bereit sind, auf europäische Akteure zu setzen, wo wir selbst die Macht der Kontrolle haben."
Was auffällt: Viele deutsche Wirtschaftsvertreter stellen sich klar hinter die Forderung von europäischer Souveränität. Von den Exporten nach China profitierten vor allem einige Großkonzerne, heißt es beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Vielen Mittelständlern seien eine sichere digitale Infrastruktur und Schritte gegen Handelsverzerrungen wichtiger als ihr relativ überschaubares China-Geschäft. Beim Umbau der Wirtschaft hin zu neuen Technologien fordert die Wirtschaft der Bundesregierung und von Brüssel so etwas wie ein geopolitisches Rahmenprogramm.
"Da halte ich es im Sinne von ‚Wir müssen resilient sein und unsere eigene Bevölkerung schützen können‘ für absurd, dass wir in Deutschland nicht bereit sind, auf europäische Akteure zu setzen, wo wir selbst die Macht der Kontrolle haben."
Was auffällt: Viele deutsche Wirtschaftsvertreter stellen sich klar hinter die Forderung von europäischer Souveränität. Von den Exporten nach China profitierten vor allem einige Großkonzerne, heißt es beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Vielen Mittelständlern seien eine sichere digitale Infrastruktur und Schritte gegen Handelsverzerrungen wichtiger als ihr relativ überschaubares China-Geschäft. Beim Umbau der Wirtschaft hin zu neuen Technologien fordert die Wirtschaft der Bundesregierung und von Brüssel so etwas wie ein geopolitisches Rahmenprogramm.
"Das bedeutet, dass wir nicht abhängig sind bei Quantentechnologie, dass wir nicht abhängig sind bei digitalen Gesundheitstechnologien, dass wir eine Energieversorgung haben, die unabhängig ist von Dritten und dass wir bei der Digitalisierung auf etwas wie Gaia X, also eine europäische Cloud zurückgreifen können, bei der die Unternehmen in Europa keine Angst haben müssen, dass mit ihren Daten irgendwas gemacht wird, was sie nicht wollen", sagt Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des BDI.
Die hohen Standards in Europa müssten auch von allen eingehalten werden, die hier Geschäfte machen wollen. Wo die Wirtschaft einst so viel Freizügigkeit wie möglich und so viel politische Einflussnahme wie gerade nötig forderte, klingt heute der Wunsch nach Nestschutz durch. Hans Kundnani, Experte für Deutschland und Europa bei der britischen Denkfabrik Chatham House, findet diese Entwicklung bemerkenswert.
"Was vorher als Protektionismus kritisiert worden ist – oft von Pro-Europäern – wird jetzt gerechtfertigt, indem man sagt: Man braucht gewisse Grenzen, was Handelspolitik angeht oder auch Kapitalverkehr."
Und die Bundesregierung tut das ihre: Aus Angst um Schlüsseltechnologien nimmt sie immer häufiger aus dem Ausland geplante Übernahmen ins Visier. Das Gesetz, das hier greift, soll vor allem gegen strategisch relevante Übernahmen durch chinesische Unternehmen schützen. Noch häufiger aber werden US-Unternehmen geprüft. Mehrmals wurde das Außenwirtschaftsgesetz, das diese Investitionskontrollen regelt, im vergangenen Jahr verändert.
Schutz nach innen, Machtpolitik oder Abgrenzung nach außen
Für Hans Kundnani ist das Konzept der europäischen Souveränität kein Zeichen eines besonders engagierten Einsatzes für die europäische Idee. Im Gegenteil, es widerspreche eigentlich dem, was besonders überzeugte Europäer lange propagiert hätten.
"Mein Eindruck ist, dass in der Vergangenheit Unterstützer der EU eher skeptisch waren, was den Begriff Souveränität angeht. Sie haben immer behauptet, das ist etwas altmodisch und womöglich gefährlich. In einer Welt von Interdependenz ist es Vergangenheit, ist es nicht mehr möglich, souverän zu sein. Und sie haben sogar oft geglaubt, die EU sei eine Art Avantgarde, die weltweit die Idee der Souveränität überwinden würde."
Nun hingegen werde vieles, was zuvor als Teil von nationaler Souveränität kritisiert worden sei — Schutz nach innen, Machtpolitik oder Abgrenzung nach außen — selbstverständlich als Teil europäischer Souveränität befürwortet. Dass das ein schiefes Bild vermittelt, hat man offensichtlich auch in Brüssel bemerkt. Es zeigt sich daran, mit welchen Begriffen hantiert wird. Strategische Autonomie war lange ein geflügeltes Wort in den EU-Institutionen. Nun aber spreche man lieber von "offener strategischer Autonomie", sagt Jana Puglierin vom European Council on Foreign Relations.
"Weil sie auch gemerkt haben, dass die ganze Diskussion, sowohl strategische Autonomie aber auch europäische Souveränität dazu führen können, dass man den Eindruck erweckt, man ist eine Festung Europa oder es ist so eine Art Buy-European-Act dahinter und dass man eben diese sehr offene Rolle der Europäischen Union, die sich für eine offene Welt, für Freihandel, für multilaterale Kooperation einsetzt, dass man da ein gewisses Spannungsverhältnis erzeugt hat, jedenfalls in der Wahrnehmung, und dass man das korrigieren will."
Strategische Autonomie nur mit offener Wirtschaft möglich
Jüngst meldeten sich die niederländische und die spanische Regierung mit einem Positionspapier zu Wort, in dem auch sie mehr Handlungsfähigkeit einfordern. Die beiden Regierungen betonten aber, dass strategische Autonomie nur mit einer offenen Wirtschaft zu haben sei.
Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marschall Fund sieht darin noch etwas anderes, als bloß die Suche nach der richtigen Wortwahl. Im Hin und Her um europäische Souveränität, europäische Strategie und europäische Autonomie entledige sich die EU einer Illusion, der sie lange nachgehangen habe.
"Die EU ist ja eine Art postmodernes Modell, jenseits von Nationalstaaten auf Kooperation angelegt, auf die Produktion öffentlicher Güter aus eigener Motivation heraus basierend. Das ist das kooperative Modell. Und man glaubte, dass diese Art von postmodernem Machtverständnis, dass das die Zukunft und in andere Weltregionen exportierbar sei."
Stattdessen sei man auf revisionistische Kräfte gestoßen, die mit dieser Vorstellung nicht viel anfangen konnten. Gegen sie müsse die EU sich nun behaupten.