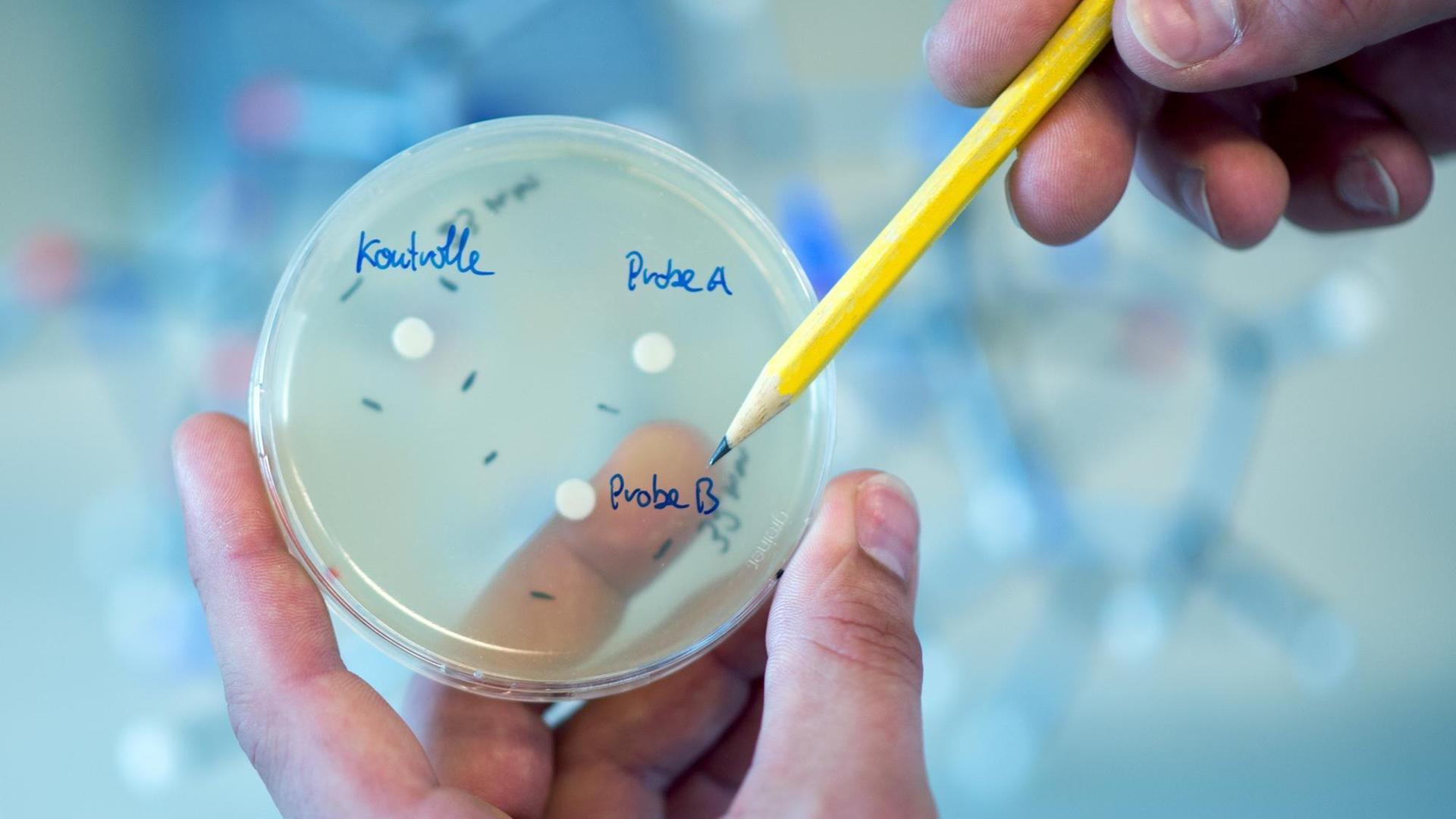"Warum um alles in der Welt ist der Geburtskanal so eng, dass Babys und Mütter manchmal sterben? Das ist ein schlechtes Design."
Die Evolution hatte nun wirklich lange genug Zeit, uns Menschen zu optimieren. Trotzdem sterben Babys, weil der Geburtskanal zu eng ist. Und wer überlebt, hat gute Chancen, dick und zuckerkrank zu werden.
"Die Frage ist, warum hat die natürliche Auslese da keinen besseren Job gemacht?" Vielleicht sind wir einfach nicht für das moderne Leben gemacht.
"Viele Erkrankungen haben irgendwo einen starken evolutionären Ursprung. Wir werden deswegen diese Erkrankungen nur besser verstehen, wenn wir die evolutionären Prozesse, die zugrunde liegen, halt auch einbeziehen."
Also zurück in die Steinzeit. Die Heilung an der Wurzel des Stammbaums suchen.
Herz-Check bei der Schimpansin Pandora
"Eines Tages bekam ich einen Anruf von unserem örtlichen Zoo, dem Zoo von Los Angeles: Einer ihrer tierischen Patienten, ein Menschenaffe, hatte ein neurologisches Problem."
Barbara Natterson-Horowitz ist eine energische Frau mit dunkler Kurzhaarfrisur und dickrandiger Brille. Sie hat den Laptop hochgefahren. Mit beinahe liebevollem Gesichtsausdruck zeigt sie auf das Bild einer Schimpansin.
"Und sie wollten, dass ich mir ihr Herz anschaue, um sicher zu gehen, dass es nicht die Ursache des Problems war."
Eine solche Ultraschalluntersuchung ist Standard. Tausende davon hat die Professorin der University of California in Los Angeles in ihrem Leben schon durchgeführt – an Menschen.
"Ich habe natürlich ja gesagt. Ich meine, das war so interessant. Ich bin also in Los Angeles auf den Freeway, erreichte den Zoo und ging ins medizinische Zentrum. Und der erste Patient, den ich dort behandelte, war dieser Schimpanse. Ihr Name war Pandora. Und ich lernte Pandora im Lauf der Jahre sehr gut kennen."
Tierische und menschliche Patienten haben gleiche Probleme
Ich treffe Barbara Natterson-Horowitz am Rande einer großen Tagung zum Thema Evolutionsmedizin an der Universität Zürich. Solche Konferenzen gibt es erst seit Kurzem – die Evolutionsmedizin ist ein relativ junges Forschungsgebiet. Dass die kalifornische Kardiologin überhaupt darauf gestoßen ist, liegt zum großen Teil an Pandora – und anderen Tieren im Zoo von Los Angeles.

"Sie riefen mich vielleicht ein paar Wochen später wieder an. Im Zoo haben sie auch Gorillas und sie wollten sichergehen, dass deren Aorta gesund ist – die größte Arterie des Körpers. Denn eine häufige Todesursache bei bestimmten Gorillas in Gefangenschaft ist, dass die Aorta reißt. Es ist dasselbe Problem wie beim Menschen. Albert Einstein ist einer von vielen, die an einer gerissenen Aorta gestorben sind."
Barbara Natterson-Horowitz behandelt auch einen Kondor und die Löwin Cookie. Immer faszinierter ist sie davon, wie ähnlich sich die Körper ihrer tierischen und menschlichen Patienten sind:
"Man muss nicht einmal Evolutionstheorie lehren. Man zeigt nur Echokardiogramme. Man geht unter die Haut und das Fell und betrachtet die Anatomie. Dann zeigt es sich von ganz allein."

Unmittelbare Ursachen, uralte Anfälligkeiten
Auch die Beschwerden ähneln sich: Ungewöhnliche Herzgeräusche, Atherosklerose oder Arterienverkalkung, Perikardergüsse, bei denen sich Flüssigkeit im Herzbeutel ansammelt. Als Ärztin hat Natterson-Horowitz solche Probleme den Betroffenen bis dahin auf der physiologischen Ebene erklärt:
"Ihr Mann hatte Atherosklerose in der Arterie. Der Plaque ist eingerissen und hat ein Blutgerinnsel verursacht. Und dann konnte kein Blut mehr fließen, und so weiter und so fort. Das ist eine Variante zu antworten. Und sie ist richtig."
Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Einer, der die unmittelbaren Ursachen im Körper benennt. Der andere Teil: Bei welchen Vorfahren von Mensch, Schimpanse, Löwe und Kondor hat sich die Anfälligkeit für die Krankheit entwickelt – und warum?
Kernfrage der Evolutionsmedizin
"Eine der Grundlagen der Evolutionsmedizin wurde von Niko Tinbergen gelegt, dem berühmten Nobelpreisträger für Verhaltensforschung. Er hat diese wunderbare Unterscheidung gemacht zwischen Erklärungen, bei denen es darum geht, wie Dinge funktionieren. Die machen etwa 95 Prozent des medizinischen Wissens aus. Und auf der anderen Seite Erklärungen, die darauf abzielen, warum etwas so ist, wie es ist."
Es ist die Kernfrage der Evolutionsmedizin: Warum leiden wir unter bestimmten Krankheiten? Im Hinblick auf Charles Darwin, den Begründer der Evolutionstheorie, heißt die Disziplin mitunter auch Darwinsche Medizin. Randolph Nesse, Gründungsdirektor des Zentrums für Evolution und Medizin an der Arizona State University ist ein moderner Vordenker des Fachs:
"Jeder weiß, dass die natürliche Selektion den Körper großartig formt. Unsere Gelenke funktionieren prima, unser Herz und überhaupt alles. Aber wir haben beschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu fragen, warum funktionieren manche Dinge nicht so gut?"

Erklärungsmodell "Fehlanpassung"
Wieso machen uns zum Beispiel nach Millionen von Jahren Evolution und natürlicher Selektion Herzprobleme, Allergien, faule Zähne, schmerzhafte Geburten und Infektionskrankheiten immer noch zu schaffen? Randolph Nesse nennt zwei zentrale Erklärungsmodelle der Evolutionsmedizin.
"Ein großer Begriff ist die Fehlanpassung. Wir leben heute in einer Umgebung, die sich stark von derjenigen unterscheidet, in der wir uns entwickelt haben. Wir sagen alle: Oh, ich werde aufhören, Zucker und Fett zu essen – und dann machen wir es trotzdem. Und dafür gibt es eine sehr einfache Erklärung: Vor einer Million Jahren in der afrikanischen Savanne hatten wir zu wenig Fett und Zucker. Und durch die natürliche Selektion sind wir darauf getrimmt, uns diese Substanzen zu beschaffen und zu essen, wann immer es sich anbietet. Und verglichen mit diesem evolutionären Hang ist unsere Willenskraft ziemlich schwach."
Erklärungsmodell "Evolutionärer Konflikt"
Auch häufig zu finden: evolutionäre Konflikte wie beim sogenannten Geburtsdilemma.
"Wie breit sollte der Geburtskanal sein? So breit wie nötig, um den Kopf eines Babys durchzulassen. Aber nicht breiter, weil dann kannst Du nicht mehr so schnell laufen."
Um solche Zusammenhänge geht es, um aus einem tieferen Verständnis am Ende Therapieansätze zu entwickeln. Klingt einleuchtend, und dass der bärtige US-Amerikaner große Hoffnungen in die Evolutionsmedizin setzt, ist keine Überraschung. Er gilt als einer der Begründer des Forschungsgebiets.
"Es gibt einen Artikel, den George Williams und ich 1991 geschrieben haben, mit dem eindrucksvollen Titel ‚Die Morgendämmerung der Darwinschen Medizin‘. Damals habe ich zu meinem Co-Autor George gesagt: Das ist etwas dick aufgetragen. Aber er sagte: Nein, den nehmen wir. Und es stellte sich heraus, dass wir damit ziemlich richtig lagen. Im Jahr darauf schrieben wir ein Buch mit dem Titel ‚Warum wir krank werden‘. Das brachte eine Menge Dinge in Bewegung. Und seitdem wächst das Feld. Erst langsam. Aber in den letzten 15 Jahren exponentiell."
Verwirrende Vielfalt der Ansätze
Warum die Evolutionsbiologie lange kaum Beachtung in der Medizin gefunden hat? Darauf bekomme ich auf der Tagung in Zürich unterschiedliche Antworten. Vielleicht liegt es daran, dass sie historisch gesehen Grundlagenforschung ist, die nicht auf praktische Anwendungen ausgerichtet war. Vielleicht spielt auch die beinahe verwirrende Vielfalt der Ansätze eine Rolle, mit denen Wissenschaftler dem Einfluss der Evolution auf unsere Gesundheit nachspüren. Barbara Natterson-Horowitz vergleicht Mensch und Tier. Andere Forscher analysieren, wie Bakterien über die Zeit Resistenzen entwickeln. Denn nicht nur der Mensch unterliegt der Selektion, sondern auch die Erreger, die uns befallen. Und wieder andere befassen sich mit Mumien, Knochen und Sammlungen.
Diagnosen für Statuen, Skelette und Mumien
Ich treffe einen Paläopathologen – Frank Rühli vom Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich.
"Die Paläopathologie bedient sich diverser Quellen. Zum einen natürlich Schriften. Dann auch artistische Hinweise. Also wenn wir beispielsweise Statuen haben, die gewisse Hinweise geben, Bilder, die gewisse Hinweise geben."
Vor kurzem vermutete zum Beispiel ein Londoner Mediziner, dass Leonardo da Vinci nach außen schielte. Seine Diagnose beruhte dabei auf Skulpturen und Zeichnungen, die den italienischen Universalgelehrten darstellen.
"Aber das Hauptobjekt eigentlich von uns sind Skelette und Mumien, wo wir eben diese Krankheiten sehen."
Ötzi und Tutanchamun als Patienten
Rühlis Patienten sind in der Regel seit mehreren tausend Jahren tot.
"Ich habe mit verschiedenen berühmten Mumien gearbeitet. Aber als Mediziner sind für mich zumindest theoretisch natürlich alle Mumien gleich. Es ist wie bei einem Patienten: Man sollte nicht zwischen berühmt und nicht berühmt unterscheiden."

Die Gletschermumie Ötzi zählt dazu. Bei ihr hat Frank Rühli unter anderem den Zustand der Zähne untersucht. Schon vor Jahren hat er sich auch die Mumie Tutanchamuns vorgenommen – ein Mann, der vor mehr als 3.300 Jahren in Ägypten regierte.
"Wir sehen sehr oft, wenn wir röntgen und insbesondere auch computertomographische Untersuchungen machen an ägyptischen, aber auch an anderen Mumien, dass beispielsweise Gefäße verkalkt sind. Das ist schon spannend zu sehen. In welchem Umfang ist das der Fall? Welcher Sozialstatus? Können wir vielleicht Hinweise auf Ernährung haben? Können wir Hinweise auf Verhalten haben? Also dass wir da sehen, dass gerade beispielsweise kardiovaskuläre Krankheiten nicht unbedingt eine rein moderne zivilisatorische Geschichte sind, sondern eben eine Geschichte haben, die weiter zurückreicht."
Gefäßerkrankungen schon vor Jahrtausenden
Auch ägyptische Forscher haben verstärkte Fettablagerungen – fachsprachlich Atherosklerose – in den Blutgefäßen von Mumien beschrieben, darunter eine Prinzessin, die mehr als 1.500 Jahre vor Christus lebte. Als Mitglied der Oberschicht hatte sie vermutlich reichlich zu essen. Mit fortschreitendem Wohlstand in den Industrieländern hat ein großer Teil der Weltbevölkerung Zugang zu fettigem und energiereichem Essen. Die Gefäßerkrankung zählt inzwischen zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Der Blick auf die Mumien zeigt aber: Menschen waren schon vor Jahrtausenden dafür anfällig. Frank Rühli:
"Grundsätzlich lernen wir etwas über die Dynamik von Krankheiten. Und eben wann sie aufgetreten sind, wie Sie auftreten, was beispielsweise Umweltfaktoren sind, die eine Rolle spielen. Das sind verschiedene Dinge. Und wo wir dann auch sagen können: Das hat sich verändert, im Positiven oder vielleicht auch im negativen Sinne. Wenn Sie Medizin nur mit dem heutigen Datum und mit dem heutigen Blickwinkel anschauen, dann sind Sie auf einem Auge blind."
Praktische Anwendungen hat die Paläopathologie in dieser Hinsicht aber noch nicht hervorgebracht.
Wieso haben Menschen, Vögel und Fische Atherosklerose?
"Atherosklerose führt zu Herzinfarkten und Schlaganfällen – die häufigste Todesursache bei Menschen."
Nach ihrem Erweckungserlebnis im Zoo von Los Angeles beginnt die kalifornische Ärztin Barbara Natterson-Horowitz damit, sich durch Studien zu wühlen und systematisch nach vergleichbaren Herz-Kreislauf-Problemen bei Tieren zu suchen.
"Ich habe in der wissenschaftlichen Literatur Fälle von spontan auftretender Atherosklerose bei ganz unterschiedlichen Tieren gefunden, darunter viele Vogelarten, Säugetiere und sogar einige Fische. Das hat meinen Blick auf dieses Problem stark verändert. Für mich war Atherosklerose eine Zivilisationskrankheit. Und es steht außer Frage, dass wir mit unserem modernen Lebensstil unser Risiko dafür erhöhen. Aber trotzdem waren die tierischen Fälle interessant."

Anfälligkeit im Schlepptau einer sinnvollen Anpassung?
Denn die zeigen: Atherosklerose ist nicht nur eine moderne Zivilisationskrankheit. Und sie trat auch nicht erst bei wohlgenährten ägyptischen Herrschern vor ein paar tausend Jahren auf. Barbara Natterson-Horowitz glaubt: Diese Anfälligkeit könnte im Schlepptau einer im Grunde sinnvollen Anpassung hunderte von Millionen Jahren überdauert haben. Das Endothel, die innere Wand der Blutgefäße, könnte in jungen Jahren helfen, Infektionen abzuwehren, später im Leben dagegen die krankhafte Einlagerung von Fetten erlauben. Weil der Schaden erst im Alter entsteht, wird die Erbanlage immer weitergegeben. Natürliche Selektion optimiert die Fortpflanzung, nicht die Gesundheit.
Säugetiere und ihr Problem mit der linken Herzkammer
Barbara Natterson-Horowitz nimmt sich noch eine weitere verbreitete Herzerkrankung vor: Die sogenannte linksventrikuläre Hypertrophie. Dabei ist die linke Herzkammer verdickt, weil der Muskel chronisch überlastet ist, zum Beispiel durch Bluthochdruck.
"Das Problem mit dem menschlichen Herz – und generell dem Säugetierherz – ist: Wenn es sich verdickt, bleibt zwar der Druck normal. Das heißt, die systolische Funktion bleibt normal. Aber die Entspannungsphase, die diastolische Funktion, wird beeinträchtigt. Denn die linke Herzkammer versteift sich. Und was passiert dann? Der Druck in der Kammer, der in der Entspannungsphase nach unten gehen sollte, wird immer höher, und das überträgt sich in den linken Vorhof und die Lunge. Die Betroffenen sind regelrecht atemlos. Sie stehen vom Bett auf, um zur Toilette zu gehen und sie hecheln. Es ist wirklich ein sehr ernstes Problem."
Giraffen haben evolutionären Ausweg gefunden
Dieses Mal stellt sie die Frage: "Welches Tier könnte im Lauf der Evolution einen Ausweg aus diesem Problem gefunden haben? Es müsste ein Tier sein, dessen linke Herzkammer sich zwar verdickt – das aber trotzdem schnell laufen kann, um Fressfeinden zu entkommen."
Die Medizinerin landet bei: der Giraffe.

"Wir haben alle diese Bilder gesehen. Das hier ist die verdickte Herzkammer einer Giraffe. Und die sieht dem verdickten Herzen eines Menschen sehr ähnlich. Aber die menschlichen Patienten sind wirklich krank, die Therapie ist nicht sehr gut. Auf der anderen Seite haben wir alle schon so etwas gesehen, richtig? Sie schauen einen Tierfilm mit David Attenborough und Sie sehen das:"
Die Wissenschaftlerin startet ein kurzes Video auf dem Computer: Galoppierende Giraffen, denen die verdickte Herzkammer offensichtlich nichts ausmacht.
"Im Grunde haben wir hier das natürliche Tiermodell eines Herzens, das sich verdickt, ohne zu versteifen."
Fünf Gene machen offenbar den Unterschied
Untersuchungen zeigen, dass fünf Gene die Schlüsselrolle für diese Anpassung bei Giraffen spielen könnten. Wie genau sich diese Erkenntnis nutzen lässt – darauf hat Barbara Natterson-Horowitz allerdings auch noch keine Antwort.
"Es geht darum, bedeutende medizinische Probleme für den Menschen zu identifizieren. Vielleicht Probleme, bei denen wir mit unserem derzeitigen Ansatz nicht mehr weiterkommen. Und uns dann der natürlichen Welt zuzuwenden, Tiere zu finden, die im Lauf der Evolution Gegenmaßnahmen entwickelt haben. Die müssen wir dann verstehen und auf uns übertragen. Der Weg ist also nicht vom Labor ans Krankenbett, sondern aus dem Busch ans Krankenbett."
Untersuchungen bei Menschen mit "ursprünglichem" Lebensstil
Im bolivianischen Regenwald – noch recht unberührt von der übrigen Welt – leben die Tsimane. Etwa 16.000 Menschen gehören der indigenen Volksgruppe an. Eine Familie hat im Durchschnitt neun Kinder. Sie siedeln in Dörfern an Flussufern, jagen Wild und Fische, sammeln Früchte, bauen Kochbananen und Reis an. Und manchmal bekommen sie Besuch von Aaron Blackwell, einem Anthropologen der Washington State University:
"Grundsätzlich haben wir ein Team von Ärzten und Biochemikern, das körperliche Untersuchungen, Labortests und solche Dinge durchführt. Im Grunde genommen einmal im Jahr für jeden in der Bevölkerung. Und dieses Team befragt die Menschen auch zu ihrem Lebensstil und so weiter. Wir haben also diese große Längsschnittdatenbank, die den Gesundheits- und Infektionsstatus der Menschen im Laufe der Zeit dokumentiert und außerdem Informationen zum Zeitpunkt der Geburten und Schwangerschaften. Dadurch können wir untersuchen, wie diese Dinge zusammenhängen."
Halten Parasiten das Immunsystem in der Balance?
Ein Phänomen beschäftigt ihn besonders: Viele unserer modernen Krankheiten wurzeln offenbar in einer Störung des Immunsystems. Die These steht im Raum, dass mangelnder Kontakt mit Parasiten die tiefere Ursache ist. Die Parasiten wären demnach so etwas wie "alte Freunde", ohne die das Immunsystem aus der Balance gerät.
"Ich habe zum Beispiel die Auswirkungen von Parasitenbefall auf die Fruchtbarkeit von Frauen und ihre Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, untersucht. Und in dieser Studie fanden wir heraus, dass bestimmte Arten von Würmern die Fruchtbarkeit von Frauen tatsächlich erhöhen können. Die Parasiten unterdrücken möglicherweise einige der Immunreaktionen, die zur Ablehnung einer Schwangerschaft durch den Körper führen."

Wurmbefall sorgt offenbar für mehr Geburten
Den Effekt konnten die Wissenschaftler um Aaron Blackwell bei Infektionen mit Spulwürmern feststellen. 15 bis 20 Prozent der Tsimane sind mit den weißen Würmern infiziert, die im Darm eine Länge von bis zu 40 Zentimetern erreichen. Die Studie zeigte, dass eine Infektion bei Frauen die Dauer zwischen den Schwangerschaften verkürzte. Im Durchschnitt gebaren sie sogar zwei Kinder mehr in ihrem Leben als Frauen ohne die Parasiten. Die Würmer werden vom Immunsystem als Eindringlinge betrachtet – ebenso wie ein Fötus. Indem die Parasiten aus Eigennutz die Attacken der Körperabwehr unterdrücken, erleichtern sie offenbar auch die Empfängnis und Einnistung eines Embryos.
"Als ich diese Studie zu Wurminfektionen und Fruchtbarkeit durchgeführt habe, hat das großes Interesse bei Ärzten hervorgerufen, die das Immunsystem für einen wichtigen Faktor bei Fruchtbarkeitsproblemen moderner Stadtbewohner halten. Sie wollen Patienten nicht unbedingt mit Würmern infizieren – das mögen die Menschen eher nicht so. Aber vielleicht ließe sich auf Grundlage dieser Würmer eine Art von Behandlung entwickeln."
Therapieansatz bislang im Sande verlaufen
Einzelne Berichte über Fälle, in denen Würmer offenbar gegen allergische Erkrankungen geholfen haben, gibt es schon seit Jahrzehnten.
Richard Lucius, emeritierter Parasitologe von der Berliner Humboldt Universität, kennt sogar einen Fall aus seinem direkten Umfeld:
"Da gibt es Leute, die machen alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin gehabt, die war selber Immunologin und die hatte eine Lebensmittelallergie. Und die sagte, dass sie eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hatte, weil sie nichts mehr essen konnte, ständig diese Probleme hatte. Und die hat diese Wurmtherapie gemacht und die war danach zwei Jahre erst einmal symptomfrei und ist also vollkommen überzeugt davon."
Tatsächlich weckten vor etwa 15 Jahren in den USA auch systematische Untersuchungen zum Einsatz von Eiern des Schweinepeitschenwurms gegen entzündliche Darmerkrankungen Hoffnung. Doch darauffolgende klinische Studien konnten keine messbaren Vorteile einer Wurmtherapie bei Nussallergie, Schuppenflechte oder Morbus Crohn nachweisen. 2013 begann an der Berliner Charité eine Studie bei Multipler Sklerose. Sie musste allerdings vorzeitig abgebrochen werden, weil sich nicht genug Probanden fanden. Zuletzt zeigte 2018 auch eine Meta-Analyse chinesischer Forscher bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen keine messbaren Vorteile für Patienten. Der so vielversprechende Ansatz, mit Wurmeiern Autoimmunerkrankungen zu behandeln, ist vorläufig im Sande verlaufen.
Mit Erkenntnissen der Evolution Bakterien bekämpfen
Im klinischen Alltag scheint die Darwinsche Medizin noch nicht angekommen zu sein. Vielleicht hat Hinrich Schulenburg da mehr Glück. Er will verhindern, dass Bakterien unempfindlich gegenüber Antibiotika werden.
"Grundsätzlich ist es so, dass die Entstehung und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen ein evolutionäres Problem ist. Ohne Evolution würden keine neuen Antibiotikaresistenzen entstehen. Das heißt damit auch: Wenn wir eine Lösung finden wollen für das Problem der Antibiotikaresistenzen, müssen wir Evolution verstehen. Und das war für mich sehr erstaunlich – ich bin Evolutionsbiologe – als ich selbst gesehen habe, dass evolutionäre Prinzipien bei der Lösung des Antibiotika-Resistenzen-Problems so gut wie gar nicht berücksichtigt werden."

Schnell wechselnde Bedingungen erschweren Anpassung
An der Universität Kiel und am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie nahm man sich zwei Krankheitserreger vor: das Darmbakterium Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa. Beide haben bereits etliche Resistenzen entwickelt, trotzdem griff Schulenburg zu den alten, vermeintlich stumpfen Antibiotika. Neu war seine Taktik:
"Ein Beispiel ist, dass wir aus der Evolutionstheorie schon lange wissen, dass sich Organismen sehr gut an konstante Umweltbedingungen anpassen können, selbst wenn sie extrem sind. Es gibt Bakterien, Krankheitskeime, die sich sehr gut an hohe Temperaturen, extreme Kälte oder auch Radioaktivität anpassen können. Und Antibiotika sind für Krankheitskeime ein Klacks. Überhaupt gar kein Problem. Wir wissen dann aber auch aus der Evolutionstheorie, dass sich Organismen nur sehr schwer an fluktuierende Umweltbedingungen anpassen können. Also Bedingungen, wo wir zeitliche Wechsel haben. Vor allen Dingen, wenn die zeitlichen Wechsel unvorhersagbar sind."
Angriff mit verschiedenen Antibiotika in schneller Abfolge
Oft wird ein einziges Antibiotikum über Tage oder sogar Wochen eingenommen – genug Zeit für die Bakterien, sich darauf einzustellen. Das Team um Hinrich Schulenburg tauschte dagegen ein Antibiotikum nach wenigen Stunden gegen ein anderes aus.
"Wir haben klinisch relevante Antibiotika oder Antibiotikagruppen verwendet. Und wir konnten in einem Experiment zum Beispiel zeigen, dass ein Wechsel alle zwölf Stunden oder alle 24 Stunden dazu führt, dass sich die Krankheitskeime sehr schlecht anpassen können. Vor allen Dingen dann, wenn wir zwischen Antibiotika wechseln mit unterschiedlichen Wirkmechanismen."
Die Studien zeigten auch: Bestimmte Antibiotika schwächen die Bakterien in einer Art und Weise, dass ein anderes, darauf folgendes Antibiotikum ihnen besonders zusetzt.
"Aspekt Evolution sehr lange ignoriert"
"Unsere Ergebnisse basieren auf Laborexperimenten, und wir wissen, dass wir das nicht eins zu eins auf den Patienten übertragen können. Aber es gibt eine sehr spannende alte Studie, die wiederum ziemlich ignoriert wurde, wo aus irgendeinem kuriosen Grund Kollegen eine infizierte Patientin genauso behandelt haben, wie wir es jetzt vorschlagen würden. Es hat fantastisch funktioniert. Damals wusste man gar nicht, wieso es funktioniert. Wir haben eigentlich die Erklärung, und wir denken, dass darauf aufbauend tatsächlich auch ein Übertrag auf den Patienten machbar sein sollte."
Hinrich Schulenburg arbeitet derzeit gemeinsam mit Medizinern in Kiel an der praktischen Umsetzung der Idee, die übrigens auch in der Krebsmedizin getestet wird. Dort versucht man, Chemotherapeutika in schneller Folge zu wechseln, um die Anpassung von Krebszellen zu verhindern.
"Wir wissen, dass die WHO lange das Thema Evolution ignoriert hat. Aber es beginnt, sich etwas zu verändern, und entsprechend ist das in den nationalen Behörden auch so. Auch da hat man eigentlich den Aspekt Evolution sehr lange ignoriert und bei den neu entwickelten Förderlinien und -Programmen nicht mit einbezogen. Aber es gibt Veränderungen. Ich denke, grundsätzlich wird realisiert, dass wir das Antibiotikaresistenz-Problem nur in den Griff bekommen, wenn wir tatsächlich auch verstehen, wie Krankheitskeime evolvieren und sich verändern."
Schlechte Stimmung als sinnvolle Strategie?
"Fieber, Husten, Übelkeit und Erbrechen: Das sind nützliche, im Lauf der Evolution entstandene Reaktionen, die in bestimmten Situationen einsetzen, um uns zu schützen. Aber was, wenn Sie zum Arzt gehen und sagen: Ich habe die ganze Zeit schreckliche Angst. Oder ich fühle mich niedergeschlagen und lustlos? Der Arzt wird sehr oft annehmen, dass diese Symptome nicht normal sind. Manchmal sind sie das auch nicht. Aber manchmal sind sie eben doch wie Husten, Fieber oder Schmerzen: Normale Reaktionen, die in bestimmten Lebenssituationen sogar nützlich sein können."
Randolph Nesse, der der Evolutionsmedizin seit Jahrzehnten Leben einhaucht, war bis zur Emeritierung Professor für Psychiatrie und Psychologie an der University of Michigan. Er ist überzeugt, dass selbst die Psychologie profitieren kann. Denn es gebe gute Gründe für schlechte Gefühle:
"Ich meine, es gibt gute und schlechte Zeiten für die Nahrungssuche. Organismen, die ständig enthusiastisch auf der Suche nach Nahrung sind, sogar mitten im Winter? Das ist eine dumme Strategie. Es ist viel besser, unter diesen Umständen pessimistisch zu sein und nicht viel Motivation zu haben, hinauszugehen und Dinge zu tun. Natürlich geht es bei uns Menschen nicht mehr so sehr um Nahrungssuche. Was wir suchen, sind soziale Beziehungen, Bewunderung unserer Mitmenschen und Orte, an denen wir nützlich sein können."
Evolutionäre Optimierung bis zum Klippenrand
Selbst bei Störungen mit genetischer Grundlage wie Schizophrenie und Autismus nimmt Randolph Nesse den evolutionären Blickwinkel ein. Er sagt: Die dafür verantwortlichen Gene überdauern, weil sie eine wichtige Rolle für unser Gehirn spielen. Je besser unser Gehirn funktioniert, desto mehr Nachkommen haben wir – die Gene werden also weitervererbt. Die fortlaufende Optimierung birgt nur eine Gefahr: Hinter dem Gipfel folgt der Abgrund.
"Die Metapher basiert auf Pferderennen. Züchtet man Pferde auf Geschwindigkeit, werden die Tiere immer schneller. Aber die Knochen ihrer Beine werden dabei länger, dünner und leichter – und anfälliger für Brüche. Die natürliche Selektion treibt dieses System also bis an den Rand. Ein weiterer Schritt, und das Ganze bricht zusammen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Menschen bei vielen körperlichen, aber vor allem geistigen Eigenschaften in den letzten hunderttausend Jahren bis zu einem Punkt vorangeschoben wurden, an dem einige Individuen anfällig für den Sturz von der Klippe sind."
Evolutionsmedizinischer Blick nicht unumstritten
Soweit die Theorie. Doch kann der evolutionsmedizinische Blick tatsächlich einen Mehrwert für die therapeutische Praxis liefern? Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin, ist skeptisch. Dass Angst sinnvoll sein kann, indem sie uns vor Gefahren bewahrt, sei nichts Neues, sondern zähle längst zum Allgemeinwissen. Heinz begrüßt die Entstigmatisierung, die in dieser Sichtweise steckt – dafür brauche man aber keine evolutionären Spekulationen. Denn wie unsere Vorfahren in der Savanne tatsächlich gelebt hätten, wisse niemand. Und noch etwas stört Andreas Heinz: Die evolutionär ausgerichtete Psychologie hat in der Vergangenheit – etwa in der Kolonialzeit oder im Nationalsozialismus – durchaus schreckliche Auswüchse gezeigt. Was als erfolgreich und psychisch gesund gelte, sei immer auch eine Frage der jeweils vorherrschenden Ideologie.
Inwieweit die Evolutionsmedizin praktische Lösungen bieten kann, wissen die Forschenden meist selbst noch nicht so genau. Doch eines ist klar: Der evolutionäre Blick bietet tief reichende Erklärungen. Erklärungen, die Millionen von Jahren zurückreichen. Und ganz gleich, ob wir auf die Entwicklung unserer körperlichen oder psychischen Eigenschaften blicken: Evolution ist nicht nur etwas, das in der Vergangenheit geschehen ist. Evolution und Selektion mitzudenken, könnte auch der Medizin von morgen helfen. Frank Rühli von der Universität Zürich:
"Was wir nicht dürfen in der Medizin, glaube ich, ist: Einfach nur, weil es per se etabliert ist, davon ausgehen, dass es immer richtig war und vor allem auch in Zukunft immer richtig sein wird. Weil – wenn die Medizin sich nicht verändert – alles andere rundherum verändert sich garantiert. Die Pathogene verändern sich, die Umwelt verändert sich, die Gesellschaft verändert sich. Und wenn dann die Medizin statisch bleibt, dann verliert sie."