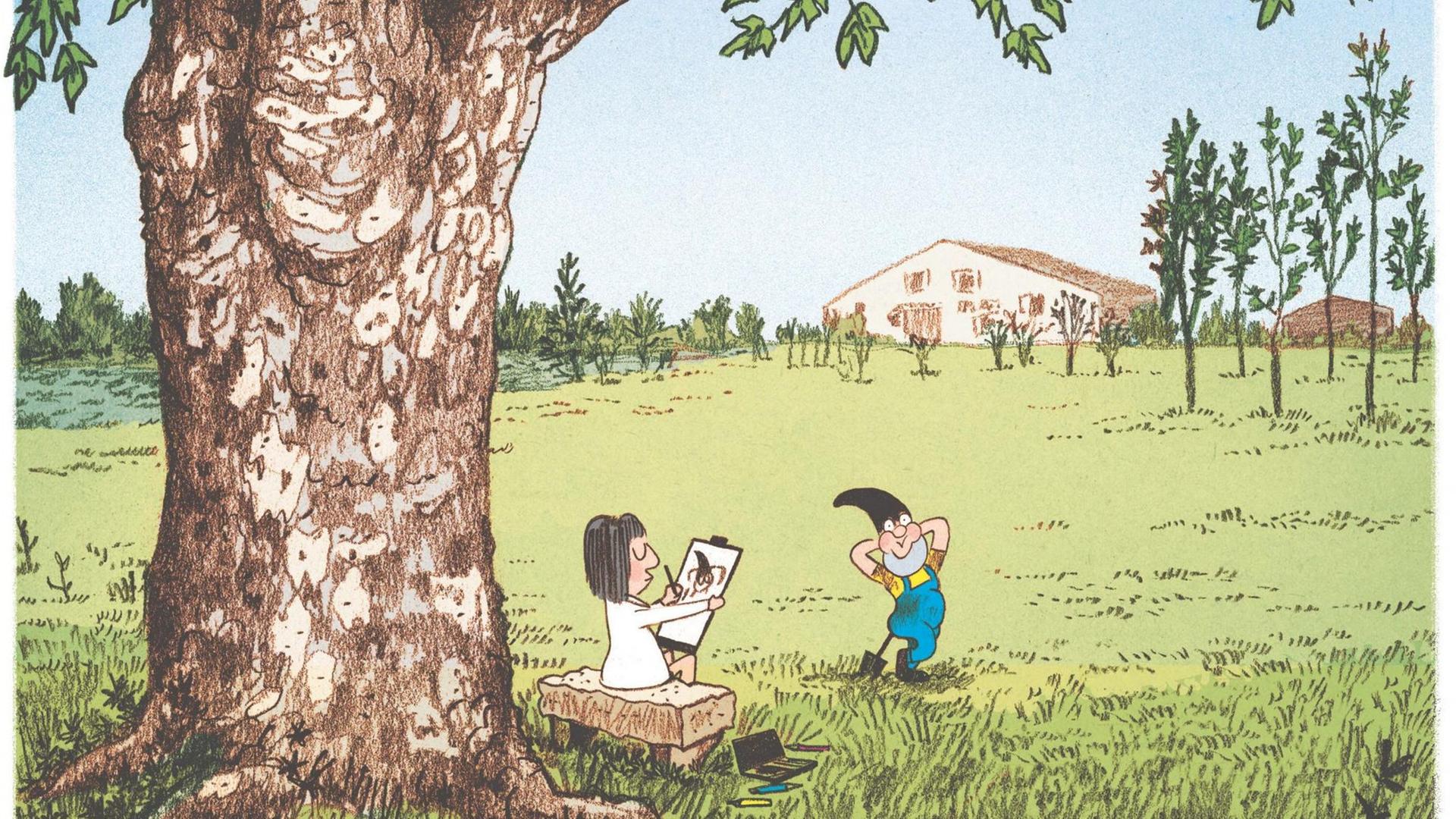Am Abend des 6. Januar 2015 geht Philippe Lançon in Paris mit Freunden ins Theater. Er verbringt einen „fröhlichen, sorglosen Abend“, an dem er euphorisch von einer Einladung an die Universität Princeton erzählt: Lançon soll dort ein Semester lang Literatur unterrichten. Er ist so begeistert von der Aufführung, Shakespeares „Was ihr wollt“, dass er spontan beschließt, am nächsten Tag eine Rezension für die Tageszeitung „Libération“ zu schreiben – er arbeitet dort als Kulturkritiker. Viel mehr erzählt Lançon zunächst nicht von dem, was er bald sein „früheres Leben“ nennen wird – das ist auch nicht nötig, denn man versteht sofort, dass dieser Abend symbolisch steht für 51 zurückliegende Jahre: Sie wurden am folgenden Morgen innerhalb weniger Minuten ausgelöscht.
Ein folgenschwerer Entschluss
Als Philippe Lançon am 7. Januar 2015 aus dem Haus geht, überlegt er noch, ob er an der wöchentlichen Redaktionskonferenz von „Charlie Hebdo“ teilnehmen soll – für die satirische Wochenzeitung arbeitet er als Kolumnist – oder ob er direkt zu „Libération“ fahren soll, um seine Theaterkritik zu schreiben. Lançon fällt einen folgenschweren Entschluss: Er entscheidet sich für die Konferenz bei „Charlie Hebdo“ – denn es ist die erste des Jahres, er freut sich auf das Treffen mit den Kollegen:
„Wir waren eine Gruppe mehr oder weniger enger Freunde in einer mittlerweile völlig ruinierten Zeitung, die praktisch am Ende war. Wir wussten es, aber wir waren frei. Wir waren da, um Spaß zu haben, uns anzuschnauzen und eine trostlose Welt nicht ernst zu nehmen.“
Eine trostlose Welt, die am 7. Januar 2015 jedoch mit der Redaktion ernst macht. Auf Seite 71 beginnt das erschütternde Kapitel, das Philippe Lançon ganz lapidar mit „Das Attentat“ überschrieben hat. Sein Buch ist hier auch eine staunende Auseinandersetzung mit der Kontingenz, denn so wie Lançon nur aufgrund einer kurzfristigen Entscheidung überhaupt zur Stelle war, so hat ihm wahrscheinlich ein Jazzbuch das Leben gerettet, das er dem Zeichner Cabu noch schnell zeigen wollte, bevor er aufbrach. Sonst wäre er den Mördern wohl direkt in die Arme gelaufen. Als die Schüsse beginnen, kauert Lançon sich an der Wand zusammen und stellt sich tot. Ihm ist zunächst nicht bewusst, dass er selbst schwer verletzt ist. Im folgenden Kapitel „Zwischen den Toten“ beschreibt er die Momente unmittelbar nach dem Attentat:
„Die Stimme dessen, der ich noch war, sagte zu mir: ,Ach, unsere Hand ist getroffen. Dabei spüren wir gar nichts.‘ Wir waren zu zweit, er und ich: Genauer gesagt, er unter mir, während ich darüber schwebte und er mich von unten mit ,wir‘ anredete. Das Auge lugte über die Hand und sah, in einem Meter Entfernung, den Körper eines bäuchlings ausgestreckten Mannes, dessen karierte Jacke ich erkannte und der sich nicht rührte. Es glitt bis zu seinem Schädel hoch und sah zwischen den Haaren das Gehirn dieses Mannes, Kollegen und Freundes, das leicht aus dem Schädel quoll. Bernard ist tot, sagte mir derjenige, der ich war, und ich antwortete, ja, er ist tot, und genau hier wurden wir eins, an diesem Punkt, an dem dieses Gehirn hervorquoll, das ich am liebsten wieder in den Schädel zurückgestopft hätte und von dem ich mich nicht mehr losreißen konnte, denn seinetwegen habe ich in diesem Moment endlich gespürt und begriffen, dass etwas nicht rückgängig zu Machendes geschehen war.“
Wichtiges Zeitdokument
Bernard – das ist der Mitinhaber von „Charlie Hebdo“, Bernard Maris.
Die ersten gut 100 Seiten von Philippe Lançons Buch sind das wichtige Zeitdokument eines grauenhaften Attentats. Die folgenden 400 Seiten sind ein eindrücklicher, nachträglich verfasster Bericht, in dem Lançon die Konsequenzen des Attentats für ihn selbst zu greifen versucht. Allein die physischen sind gravierend: Ihm fehlt das untere Drittel des Gesichts, unterhalb der Oberlippe klafft ein Loch. Eine Serie von Operationen beginnt, bei denen Lançon unter anderem ein Wadenbein als Kinn und ein „Fetzen“ Haut vom Oberschenkel transplantiert werden – daher der Romantitel. Nicht alle OPs glücken, 17 mal wird er operiert, zumindest bis zur Niederschrift des Buches im Sommer 2017. Lançon berichtet vom Alltag zwischen nässenden Wunden, unauffindbaren Venen und Magensonden, ständig bewacht von Personenschützern. Sein Buch ist indes kein bloßes Dokument des körperlichen Leids, sondern eine Recherche in eigener Sache. Lançon versucht, den zu finden, der er durch das Attentat geworden ist.
„Schuld“ ist dabei eines seiner Leitmotive. Lançon empfindet jedoch nicht die Überlebensschuld des Davongekommenen, der seine Kollegen hat sterben sehen. Die Spur zur Literatur von Holocaust-Überlebenden wie Paul Celan, Primo Levi oder Imre Kertész, die die deutsche Leserin beim Begriff „Schuld“ unwillkürlich auslegt, führt in die Irre. Lançon empfindet Schuld gegenüber seinen Ärzten und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pflegern, denen er so wenig Mühe wie möglich bereiten will. Er empfindet Schuld gegenüber seinen Freunden und Verwandten, denen er seine Tragödie zumutet – Lançon ist umgeben von vielen Freunden, die sofort an sein Krankenbett eilen. Doch die Verständigung ist schwierig, denn die Welt, aus der sie zu ihm kommen, erreicht ihn nicht mehr. Er verfolgt die politischen Ereignisse nicht, ist ganz vom Krankenhausalltag, seinen Schmerzen und medizinischen Verrichtungen absorbiert.
„Die Wörter auf der einen, unsere Begegnungen auf der anderen Seite versuchen, die zerstörte Brücke zwischen uns wiederaufzubauen. Doch in der Mitte klafft ein Loch. Schmal genug, damit wir uns auf beiden Seiten sehen, sprechen und beinahe berühren können. Breit genug, damit keiner von beiden in dieser Zone der Gewohnheiten, Improvisationen, Freundschaft, vor allem aber der Kontinuität, den anderen erreicht.“
Erreichen können ihn nur diejenigen Menschen, die selbst eine traumatische Erfahrung gemacht haben und dieses „Reich außerhalb der Zeit“ kennen, in dem Lançon fortan lebt.
Trost aus der Literatur
Sein „früheres Leben“ dringt immer wieder unvermittelt in die Krankenhaus-Gegenwart ein, und so erzählt Philippe Lançon zum Teil in wilden Zeitsprüngen. Das Buch ist sehr weitschweifig, zum Beispiel voll von literarischen Exkursen, die zunächst irritieren. Lançon will damit, so versteht man allmählich, nicht seine Belesenheit beweisen, sondern zeigen, dass ihm der wahre Trost nicht aus menschlichen Begegnungen, sondern aus Literatur und Kunst erwächst: aus der Musik Bachs, aus Kafkas Briefen, aus Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“, aus Thomas Manns „Zauberberg“ oder aus Velázquez‘ Bildern. Sein eigenes Schreiben bekommt für Lançon zentrale Bedeutung:
„Über meinen eigenen Fall zu schreiben war das beste Mittel, um ihn zu verstehen und mir zu eigen zu machen, aber auch, um mich abzulenken – denn für Minuten, für eine Stunde, war der Schreibende nicht mehr der Patient, über den er schrieb: Er war Reporter und Chronist einer Rekonstruktion. Noch nie war ich so dankbar für meinen Beruf gewesen, der auch eine Art zu sein und letztlich zu leben war. Durch seine lange Ausübung konnte ich in dem Moment, als ich es am nötigsten hatte, meine eigenen Qualen auf Distanz halten und wie ein Alchimist in Gegenstände der Neugier verwandeln.“
Erstaunlich luzider Blick
Lançons Tonfall ist manchmal bescheiden, manchmal hochtrabend, mal aufbrausend, mal resigniert oder selbstkritisch, oft voller Selbstironie – die Gefühlslagen eines Patienten, der Qualen leidet, sind schwankend. Konstant bleibt der – erstaunlich – luzide Blick des Überlebenden, der die Erlebnisse nachträglich zu beschreiben und zu ordnen versucht. Die zupackende und umsichtige Übersetzerin Nicola Denis ist ein Glücksfall für diesen verschiedenste Sprachebenen vereinenden Text.
Der Frage, wann er sein Buch beenden solle, wurde Lançon enthoben: Am 13. November 2015 töteten Islamisten bei Anschlägen im Musikclub Bataclan sowie in und um Paris 130 Menschen. Mit diesem „Schluckauf der Geschichte und meines eigenen Lebens“ beschließt Philippe Lançon seine erschütternde Suche nach der stehengebliebenen Zeit.
Philippe Lançon: „Der Fetzen“.
Aus dem Französischen von Nicola Denis,
Tropen-Verlag, Stuttgart. 552 Seiten, 25 Euro.
Aus dem Französischen von Nicola Denis,
Tropen-Verlag, Stuttgart. 552 Seiten, 25 Euro.