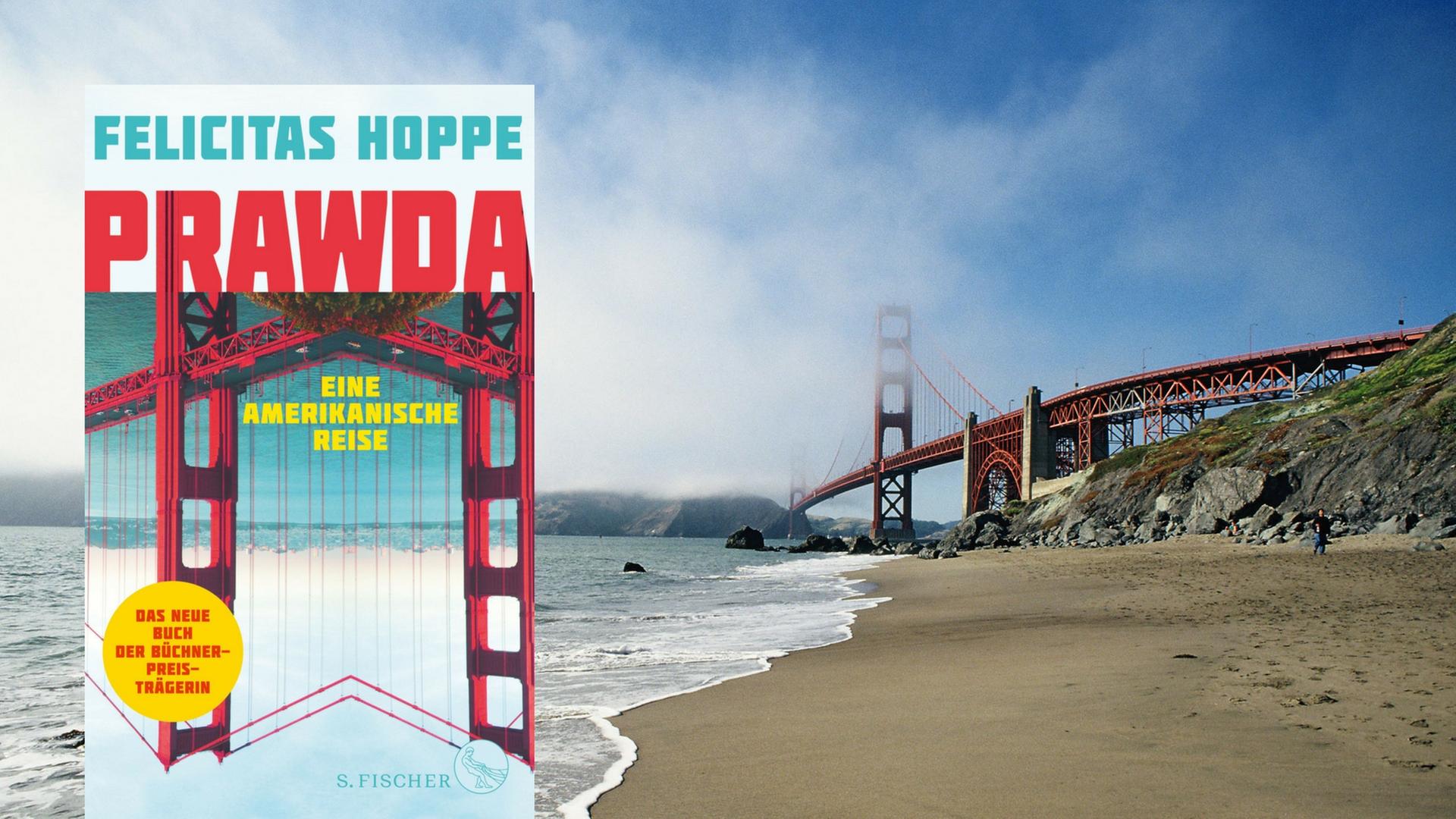
In einer Kleinstadt im Mittleren Westen sitzt eine Frau mitten in der Nacht auf dem Dach eines Hauses. Sie ist aufgewacht von den leisen Schwingungen, die ihr Bett erfasst haben. Halb im Traum, halb in der Ahnung einer Katastrophe, hört sie die Stimme des Hausherrn im Flur, der immer wieder den einen Satz nach oben schreit: "It’s a twister." Ein Wirbelsturm, eine gewaltige Windhose kommt auf das Haus zu. Und die Frau, die Erzählerin in Felicitas Hoppes Buch, geht nicht in den Keller, wie es vernünftig wäre, sondern ans Fenster und blickt gen Himmel.
Sie sieht das Ungeheuer nahen, sieht, wie es Autos, Tiere, Gebäude mit sich nimmt. Die Frau klettert durch die Luke des Schlafzimmers nach oben, auf das Dach. Als der Twister das Haus erreicht hat, springt sie ab, hängt sich an die Windhose – und verschwindet vorerst aus dem bis dahin ohnehin nicht sonderlich geordneten Erzählrahmen. Mit Eleganz und Leichtigkeit:
"Denn legt man erst einmal die Ketten ab, fliegt man ganz wie von selbst einfach weiter, was im Traum so leicht ist, wie durch Meere zu schwimmen. Und von oben herab, im Auge des Sturms, sieht die Landschaft der Welt wie ein Spielzeugland aus, alles federleicht, winzig und höchst beweglich, den Launen eines Spielmeisters anvertraut, der wie ein Schöpfer im Halbschlaf die Karten neu mischt, weil ihm die alte Ordnung plötzlich missfällt. Was bis eben noch feststand, reißt sich los und wird kurzfristig frei, um nach besseren Plätzen Ausschau zu halten."
Eine vertrackte, Haken schlagende Poetologie
Diese Passage, die in etwa in der Mitte von "Prawda" zu finden ist, ist in mehrfacher Hinsicht eine Schlüsselstelle. Auch wenn es darum geht, der vertrackten, Haken schlagenden Poetologie Felicitas Hoppes näherzukommen. Zum einen, weil eine realistische oder vermeintlich realistische Erzählsituation in einer Sekundenentscheidung umschlagen und quasi innerhalb eines Satzes die Gattung wechseln kann, hin zum Märchen, zur Legende. Zum anderen, weil in der Beschreibung des Flugs selbst und dessen, was die Erzählerin aus der Luft erblickt, das Kunstverständnis der Autorin gespiegelt wird.
Felicitas Hoppe ist eine Spielerin, die das Spiel ernst nimmt, im Zweifelsfall sogar tödlich ernst. Sie gibt wenig auf die Gesetze des konventionellen Erzählens; sie schert sich schon gar nicht um Naturgesetze. Sie nimmt sich die Freiheit, ihren Texten die Logik des Traums, der Illusion zugrunde zu liegen. In dem, was Menschen sich wünschen, erkennt sie den Raum dessen, was sich überhaupt zu erzählen lohnt. Hier konkret: Die Sehnsucht nach Entgrenzung. Die Idee, buchstäblich in Windeseile an einen anderen Ort zu kommen. Wohin? Dazu später mehr.
Vor allem aber zitiert die gesamte Szene Victor Flemings Musicalfilm "The Wizard of Oz", in dem Judy Garland mitsamt dem Haus ihres Onkels von einem Twister in das Zauberland Oz getragen wird. Noch beim Abendessen hatte in Hoppes Buch der Hausherr festgestellt, dass jeder amerikanische Präsident nur eine Karikatur des Wizard von Oz sei. So greift bei Hoppe ein Rädchen ins andere. Kunst reagiert auf Kunst und stellt so eine neue Wirklichkeit her.
Doch wie beginnt eigentlich alles in "Prawda"? Im Frühstücksraum eines Hotels in Boston begegnen sie sich, die Ich-Erzählerin, die sich selbst den vielsagenden Namen "Frau Eckermann" gegeben hat; ein Künstler aus Kiew, der, aus welchen Gründen auch immer, den Decknamen "Foma" trägt. Und die Fotografin Jerry aus Halle, die gerade ein USA-Stipendium hat. Die drei eint der Wunsch, von Osten nach Westen reisen zu wollen, auf den Spuren von Ilf und Petrow. Was sie nicht haben, ist ein Auto. Auftritt MsAnnAdams:
"Gebürtig aus Wien, seit vierzig Jahren am Dartmouth College, Hannover, New Hampshire, letzter Gast meines gestrigen Vortrags bei Radio Goethe, die an diesem strahlenden Morgen einfach sitzen geblieben ist, Sprichwörter aus dem Stegreif entziffert und jetzt, so nebenbei wie entschlossen, ihren Steckbrief in die Waage wirft: Deutsch als Fremdsprache, erweiterte Weltkartenkunde, Verkehrsgeschichte, Literatur der Romantik und einen gültigen Führerschein."
"Gebürtig aus Wien, seit vierzig Jahren am Dartmouth College, Hannover, New Hampshire, letzter Gast meines gestrigen Vortrags bei Radio Goethe, die an diesem strahlenden Morgen einfach sitzen geblieben ist, Sprichwörter aus dem Stegreif entziffert und jetzt, so nebenbei wie entschlossen, ihren Steckbrief in die Waage wirft: Deutsch als Fremdsprache, erweiterte Weltkartenkunde, Verkehrsgeschichte, Literatur der Romantik und einen gültigen Führerschein."
Die ideale Reisebegleiterin. Raucht viel, braucht wenig Schlaf. Und hat im Hof einen funkelnagelneuen Ford Explorer stehen. Nicht in mausgrau, sondern in rubinrot. So fügen die Dinge sich. Vor allem, weil Hoppe es so will. Und los geht die Fahrt. Schnell werden im Auto unter den Mitfahrern territoriale Ansprüche erhoben. Nur der Platz hinter der Fahrerin oder dem Fahrer ist reserviert. Dort sitzt Frau Eckermann in ihrem Tocqueville-Erker, wie sie es ausdrückt.
Die Rollen sind verteilt: AnnAdams fährt und doziert, Jerry fotografiert und flirtet mit Foma, Frau Eckermann dokumentiert. Es geht in Richtung Pazifik, knapp 200 Jahre nach Alexis de Tocqueville, 80 Jahre nach Ilf und Petrow. Die Herzen offen, im imaginären Gepäck die Weltliteratur. Zumindest auf die Erzählerin trifft das zu. Dazu noch eine Menge popkulturellen Ballast. Auch den wird sie noch brauchen. Im Auto lesen sie sich gegenseitig aus "Das eingeschossige Amerika" vor.
Keine maßstabsgetreue Spurensuche
"Prawda" ist, wie konnte man es von Felicitas Hoppe anders erwarten, keine maßstabsgetreue Spurensuche, auch keine Hommage. Es ist die Überschreibung eines Werks in seiner Überschreitung. Die Route der beiden Russen dient als geografische Orientierungsroute, an deren Haltepunkten Hoppe die Zügel loslässt. Ein Beispiel: Zu Beginn ihrer Reise kommen Ilf und Petrow auf Vermittlung von Ernest Hemingways Schwiegervater in die Todeszelle von Sing-Sing. Ihr Reiseleiter Mr. Adams setzt sich auf den elektrischen Stuhl.
Eine kurze, relativ nüchtern beschrieben Szene, in die Hoppe hineinschlüpft, um sie auszumalen:
"Wie er beflissen die Arme, erst links, dann rechts, auf die abgewetzten Stuhllehnen legt. Wie man ihn feierlich fesselt und bindet. Erst an den Armen, dann an den Beinen. Mit Gurten aus Leder. Wie sich Schweißperlen auf seiner Stirn versammeln, als man die Gurte fester zieht. Wie seine Frau erblasst, als er nach dem elektrischen Helm verlangt. Wie eine zweite, größere Stille eintritt, bevor man ihm, kurz vor dem Schafott, schließlich den Helm verweigert, weil der Helm kein Spielzeug, sondern tödlicher Ernst ist."
Ein anderes Beispiel: Zu den besten Kapiteln bei Ilf und Petrow gehört die Schilderung des Besuchs der Ford-Autowerke in Detroit. Henry Ford, der Erfinder der Fließbandarbeit, ist eine der zentralen Figuren in der Vorstellungswelt der beiden Russen. Wenn etwas die beiden ideologisch Welten voneinander entfernten Großmächte im Jahr 1935 verbindet, dann ist es ihre hemmungslose Begeisterung für Technik.
Ilf und Petrow allerdings beschreiben die Arbeit am Fließband als bedrückend; die Arbeiter als seelisch verkrüppelte Knechte, denen sogar die Kraft zum Aufschauen fehlt. In Hoppes "Prawda"-Spiegelkabinett tragen die Arbeiter bunte Shirts, lächeln den Besuchern freundlich zu, so dass Foma zu der Überzeugung kommt, dass es sich hier um ein groß angelegtes Täuschungsmanöver handelt:
"Denn wer, wenn nicht Henry, das allamerikanische Monster, wäre jemals auf die Idee gekommen, Arbeiter aus Detroit durch arbeitslose Schauspieler zu ersetzen, die vor Touristen aus aller Welt den einfachen Mann am Fließband mimen, jenen kleinen Mann vor der Mittagspause, der von anderen, größeren Rollen träumt, bis endlich die Pausenglocke ertönt und er in der Kantine verschwinden darf."
So spielt Hoppe immer wieder mit der Vorlage, die "Das eingeschossige Amerika" ihr gegeben hat, um sie zu konterkarieren, weiterzuspinnen oder auch, wenn nötig, implodieren zu lassen und sich von ihr abzulösen. Man muss sich Hoppe als eine übermütige Artistin vorstellen, die mit einem Bein auf Ilfs und mit dem anderen Bein auf Petrows Schulter steht und währenddessen mit einem halben Dutzend Bällen jongliert.
Die Freiheit, überall auftauchen zu können
Henry Ford übrigens erscheint als eine ungeheuer gegenwärtige Figur: Ein fast 80-jähriger Patriarch, der kein eigenes Büro besitzt, sondern sich die Freiheit nimmt, jederzeit überall auftauchen zu können. Es gibt mehrere reale Figuren in "Prawda", die Felicitas Hoppe genauso gut erfunden haben könnte. Doch was für ein Bild des Landes zeichnet Hoppe? Wer den in Kürze anlaufenden Film von Oliver Held und Thomas Henke gesehen hat, der den schlichten Titel "Felicitas Hoppe sagt" trägt, der weiß, dass Begriffe wie Gegenwart oder auch Politik für die Schriftstellerin keine ästhetisch relevanten Kategorien sind.
Dennoch: Im September läuft 2015 bereits der Wahlkampf. Trump ist zwar noch weit weg, aber andererseits präsent genug, um die renitente Wiener Literaturwissenschaftlerin zu einer literarischen Ohrfeige ausholen zu lassen:
"Denn vor der Tür stand die Wahl. Weshalb sich AnnAdams zusammen mit Tocqueville einmal mehr auf die Dummheit der Massen berief und beschwingt rezitierte: 'Es ist wirklich schwer einzusehen, wie Menschen, die der Gewohnheit, sich selbst zu regieren, vollständig entsagt haben, imstande sein könnten, diejenigen auszuwählen, die sie regieren sollen'."
"Prawda" ist eine gigantische Echokammer. Ein Buch, das in seiner flirrenden Assoziationslogik nicht immer leicht zu lesen ist, das aber in seiner Geschmeidigkeit, seiner Rasanz und seiner Klugheit ungeheure Freude macht. Aus Kunst gemachte Kunst, die aber gleichzeitig ungemein anschaulich und auch sehr komisch ist. Sie habe, so hat Felicitas Hoppe es formuliert, stets versucht, Kunst auf die leichte Schulter zu nehmen.
Man darf einen solchen Satz ernst nehmen, wenn man nicht vergisst, dass hinter und in ihrer Kunst stets ein fragiles, von Wünschen und Sehnsüchten angetriebenes Ich aufblitzt. Ein Ich, das in "Prawda" in den schlaflosen Nächten via Laptop Botschaften mit einem geheimnisvollen Doktor Link austauscht. Hoppe spielt nicht, um zu spielen. Andererseits sucht sie auch nicht nach Wahrheiten, sondern nach ästhetischer Wahrhaftigkeit im Sinne einer sprachlich konsistent verfassten Welt. Man muss sie nur finden oder erfinden. Dann ist auch jeder Exkurs schlüssig.
Wir reisen mit der Gesellschaft im rubinroten Ford nach Neverland, der Märchenvilla von Michael Jackson. Wir werden Zeuge, wie Quentin Tarantino mit AnnAdams seine erste Zigarette seit Jahren raucht. Der berühmte Zaun, den Tom Sawyer zu streichen hat, dehnt sich ins Unendliche und wird zur Umrandung eines metaphysisch aufgeladenen Terrains namens Paradies. Währenddessen träumt Frau Eckermann von einer Schulstunde mit Tom Sawyers strenger Tante Polly, in der die Erzählerin ihre Unfähigkeit zur Mathematik mit spontan gereimten Gedichten vergeblich zu vertuschen versucht.
Und dann ist da noch Springfield. Welches Springfield? So wie die Erzählerin vorgibt, auf der Suche nach dem wahren Amerika zu sein, so ist sie auch auf der Suche nach dem wahren Springfield. Den Ort gibt es in den USA 64 Mal in 35 Staaten. In einem davon, in Illinois, lebte Abraham Lincoln, bis er in die Politik ging.
In einem anderen Springfield lebt die Zeichentrick-Durchschnittsfamilie Simpson. Und selbstverständlich sind es die Simpsons, denen die Erzählerin, die auch ein Faible für Tom & Jerry hat, einen Besuch abstattet. In der hochbegabten Tochter Lisa trifft sie eine adäquate Gesprächspartnerin:
Im Nebenzimmer verstummte das Baritonsaxophon, und beflügelt betrat Lisa Simpson das Zimmer. Im Gegensatz zu Bart zeigte sie sich über meinen Besuch nicht im Geringsten überrascht und verwickelte mich sofort in ein Gespräch über Gott und die Welt, über Familien und Artenschutz, über Musik, Vegetarismus, Philosophie und Buddhismus, über die genealogische Doppelmoderne und über akute Weltzeitgeschichte.
Ein Ort abseits der Route von Ilf und Petrow
Wohin aber hat nun der Twister die auf dem Dach hockende Frau Eckermann getragen? An einen Ort abseits der Route von Ilf und Petrow. Am Ende in die Wüste. Dort verbringt die Erzählerin eine merkwürdige Zeit der Absenz und Sammlung. Fast scheint sich hier ein religiöses Motiv zu eröffnen. Doch nicht der Teufel ist es, der die Erzählerin in seinen Bann schlägt, sondern die Kunst. Zunächst aber nach Hannibal, jener Kleinstadt, in der Mark Twain seine Kindheit verbracht hat. Erneut der Gartenzaun, erneut Tom und sein Freund Huck. Dann in die geheimnisvollen Höhlen, in denen sich einst auch Tom und seine Freundin Becky verirrt hatten.
Und schließlich nach Death Valley Junction. Hier hat die Reisende sich endgültig vom Korsett des Reiseplans befreit. Hier waren Ilf und Petrow garantiert nicht. Stattdessen hat sich Marta Becket mitten im Nirgendwo ein Opernhaus gebaut. Die New Yorker Sängerin war 1964 mit einer Reifenpanne liegen geblieben, entdeckte die verfallene Corhill Hall und baute das Theater nach ihren Vorstellungen zum Amargosa Opera House um. Noch so eine Figur, die Hoppe hätte erfinden müssen, wenn es sie nicht gegeben hätte. Ihre letzte Vorstellung gab Marta Becket im Februar 2012. Sie starb im Januar 2017.
In Death Valley Junction ist die Erzählerin nach Reiseplan am falschen, in Wahrheit aber genau am richtigen Ort. Mit staunend kindlichem Blick besichtigt sie das Amargosa Opera House:
"Die Bühne war leer. Doch die Wände und Logen, die die Bühne umgaben, waren bis auf den letzten Platz vollständig besetzt und bis unter die Decke bebildert. Keine Vision, sondern reine Kunst. Wir waren nicht mehr allein, nicht mehr zu dritt, sondern umzingelt von einem Publikum, das Marta Becket malend erfunden hatte und das ihr Theater nie mehr verlassen würde."
Marta Becket, die auch als Malerin arbeitete, hatte den Saal an allen Wänden aufwendig mit Logen, Sitzen und einem imaginären Publikum bemalt. Und auch hinter einer derartigen scheinbaren Kuriosität und Skurrilität scheint, wie so oft bei Felicitas Hoppe, ein geradezu existentieller Ernst auf: Es ist die Angst vor dem Verschwinden. Es ist die Furcht davor, dass das, was den Menschen ausmacht und antreibt – die Schönheit, die Schaffenskraft, die Intellektualität, kurz: die Kunst – früher oder später überflüssig werden könnte. Dass noch nicht einmal mehr ein imaginäres Publikum den Zugang finden könnte zu dem, was ein Künstler weit über das Gegenwartsrauschen hinweg darstellbar machen kann.
Die Erzählerin begreift sich selbst in Death Valley Junction an einem Scheideweg zwischen Draußen und Drinnen, wie es heißt, aber auch zwischen Gehen und Bleiben. Sie wäre gerne geblieben, aber sie geht. Sie jagt durch die Wüste, um wieder zu ihren Reisegefährten stoßen zu können, Als sie sie erreicht hat, fragt man sie nach Beweisen für ihre Höhlen- und Wüstenabenteuer. Dann ruft die Gegenwart, und es ist erstaunlich, wie schnell Felicitas Hoppe im Tonfall umschalten kann. Sicher, am liebsten erfindet sie ihr eigenes Amerika. Sie ist keine Reporterin. Und doch ist es verblüffend, wie sie im Silicon Valley mit wenigen Federstrichen das Porträt des leistungsbereiten, durch und durch gesunden (und wie alle auf das Ende zulaufenden) Kaliforniers zeichnet:
"Untätigkeit ist ihm ein Gräuel, Faulheit und Trägheit sind ihm verhasst, er trinkt nicht, er raucht nicht, er ist sportlich und schön, durchtrainiert, aufrecht und ernst, tüchtig und streng, grundsätzlich hellwach, unbestechlich und unerbittlich genau, allem voran mit sich selbst. Er fährt stur geradeaus, auf Zuruf und Knopfdruck in einem Gefährt, das, gefüttert mit dem Algorithmus des Todes, unsere Wege und Straßen weit besser kennt, als MsAnnAdams sie jemals kennen wird."
"Untätigkeit ist ihm ein Gräuel, Faulheit und Trägheit sind ihm verhasst, er trinkt nicht, er raucht nicht, er ist sportlich und schön, durchtrainiert, aufrecht und ernst, tüchtig und streng, grundsätzlich hellwach, unbestechlich und unerbittlich genau, allem voran mit sich selbst. Er fährt stur geradeaus, auf Zuruf und Knopfdruck in einem Gefährt, das, gefüttert mit dem Algorithmus des Todes, unsere Wege und Straßen weit besser kennt, als MsAnnAdams sie jemals kennen wird."
Andere Potentiale als die Politik
Auf einer wunderbaren Homepage hat Felicitas Hoppe unmittelbar nach dem Ende der Reise eine Art Tagebuch veröffentlicht. Dort finden sich neben konkreten Erinnerungen an bestimmte Aufenthalte auch Zitate aus eigenen Büchern, oder aber auch Liedtexte von Reinhard Mey, Auszüge aus Kafka-Erzählungen und Links zu Zeitungsartikeln, die den politischen Alltag des Jahres 2015 spiegeln. Hier gestattet Hoppe der Gegenwart jenen Raum und jene Geltung, die sie ihr im Buch verweigert. Die Literatur weckt andere Potentiale als die Politik. Und in einem letzten, kühnen Schritt zweifelt die Erzählerin am Ende gleich alles an, was im Grunde ihre Reise überhaupt ausgelöst hat:
"Je länger ich las, umso mehr machte sich Misstrauen in mir breit, die leise Ahnung von einem Betrug, der mich bereits seit achttausend Meilen begleitet. Ist es nicht möglich, dass Ilf und Petrow niemals in Amerika waren, dass sie die ganze Reise bloß dazu erfunden haben, mir weiszumachen, was mein Vater längst weiß: dass man kein Land braucht, wenn man den Kosmos hat?"
Der Kosmos der Schriftstellerin Felicitas Hoppe jedenfalls scheint in seinen auf wundersame Weise miteinander verbundenen Möglichkeitsräumen unendlich zu sein. "Prawda" beweist erneut, dass in Hoppes Werk nicht die Literatur mächtiger ist als das Leben. Es stellt sich diese Machtfrage erst gar nicht. Denn: Die Literatur ist das Leben.
Felicitas Hoppe: "Prawda. Eine amerikanische Reise" S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2018.
318 Seiten, 20 Euro
318 Seiten, 20 Euro


