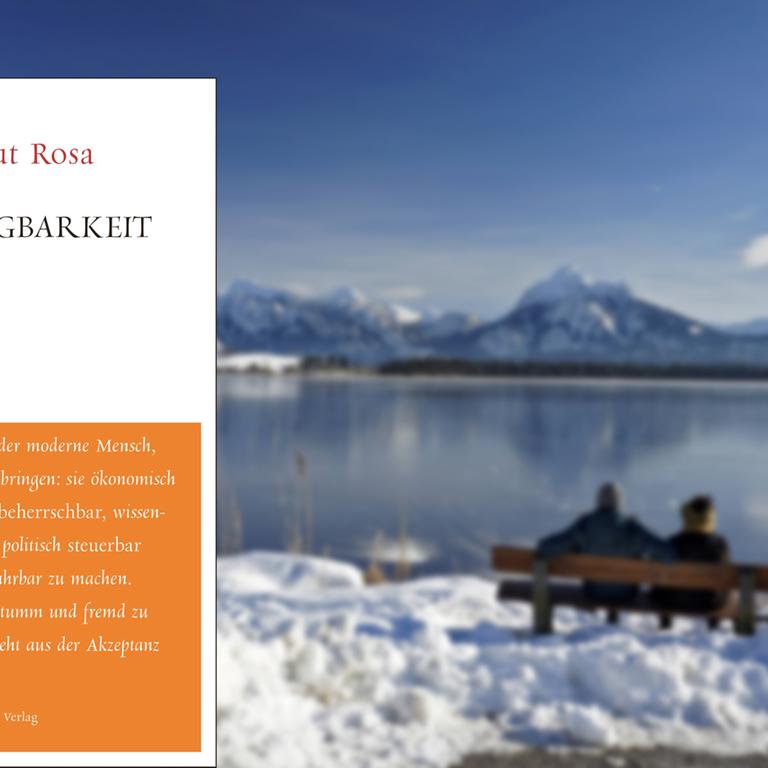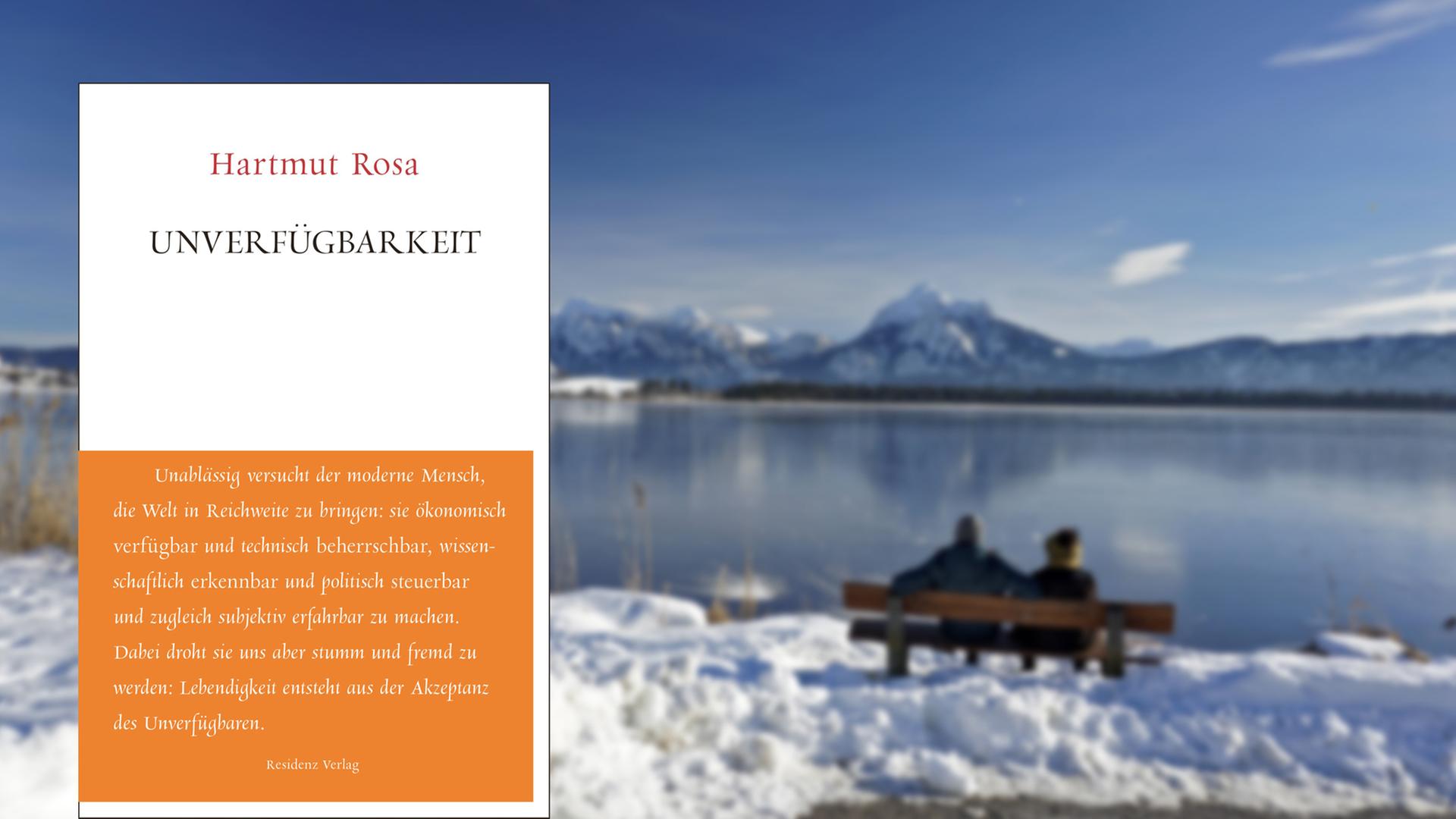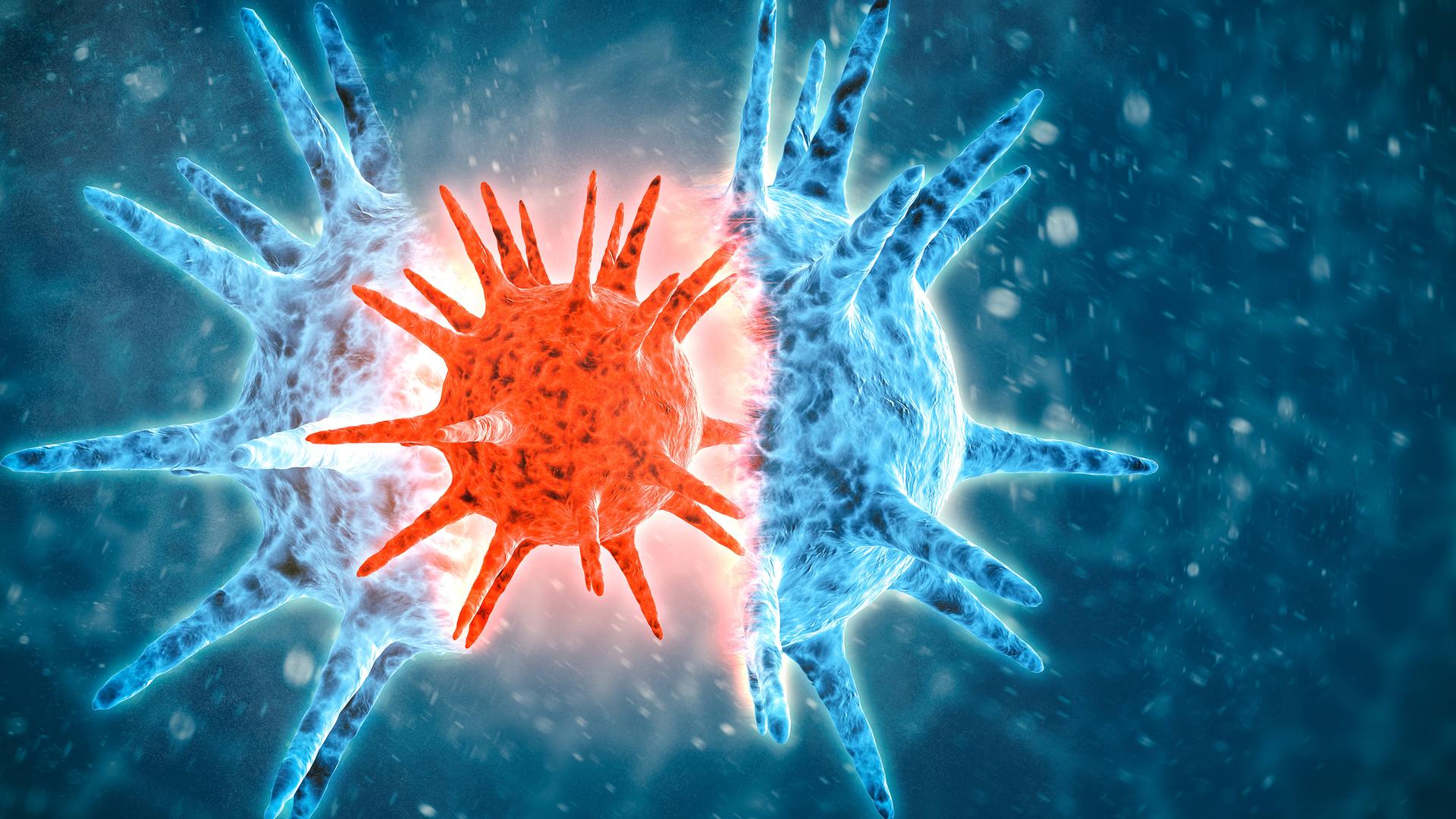Seit vielen Wochen leben die Menschen weltweit mit der Corona-Pandemie, eine in den modernen Nachkriegsgesellschaften neue Situation ist entstanden. Plötzlich haben wir die Dinge nicht mehr unter Kontrolle. Wir müssen akzeptieren, dass die Politik auf Sicht handelt, wie es immer wieder heißt. Dabei sind wir es eigentlich gewohnt, die Dinge zu steuern und zu beherrschen. Welche Folgen hat das für uns? Welche Chancen liegen darin?
Hartmut Rosa lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, ist Direktor des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt und einer der führenden deutschen Soziologen. In seinen Büchern "Unverfügbarkeit" und "Resonanz" beschäftigt sich Rosa mit den Problemen der permanenten Verfügbarkeit in unserer Gesellschaft und such Antworten auf die Steigerungslogik des Kapitalismus.
Susanne Fritz: Welche Erfahrung machen wir gerade durch die Corona-Pandemie?
Hartmut Rosa: Das ist eine eigenartige und in mancher Hinsicht vielleicht auch einzigartige Erfahrung, im Gegensatz zu unserem normalen Alltagsbestreben - Dinge immer besser unter Kontrolle zu kriegen. Und das in allen möglichen Hinsichten: also wissenschaftlich erforschen, ökonomisch erschließen, politisch regulieren oder auch rechtlich sichern. Wir haben wir es plötzlich mit einer Situation zu tun, die in all diesen Hinsichten neues Terrain betritt. In unserer Lebenswelt sind uns Dinge massiv unverfügbar geworden. Wir können nicht mehr an unseren Urlaubsort reisen, müssen vielleicht die Hochzeit oder eine Familienfeier absagen. Die Geschäftsreise fällt aus, das Fußballspiel. Das heißt, die Welt wird unverfügbar, unerreichbar und in vielem auch unberechenbar.
"Es ist wie ein Brennglas"
Fritz: Ist uns durch die Pandemie stärker bewusst geworden, dass wir eben doch nicht alles kontrollieren und beherrschen können, ganz gleich, wie sehr wir das auch glauben?
Rosa: Ich denke, das ist in der Tat so. Denn im Prinzip hat uns das das Gefühl schon lange beschlichen, sozusagen hinterrücks, dass wir die Welt nicht so unter Kontrolle haben, wie wir das er gerne hätten oder auch wie das von uns erwartet wird. Ich glaube, es ist wie ein Brennglas: Ängste, die wir sowieso hatten - das gilt im Großen wie im Kleinen, also im Großen, denke ich an so etwas wie Naturbeherrschung.
Wir haben es ja tatsächlich geschafft, Naturkräfte, Naturressourcen, auch Naturgewalten immer besser zu beherrschen, aber haben hinterrücks die Angst, dass zum Beispiel in der Klimakrise uns das alles nicht nur komplett über den Kopf wächst, sondern unbeherrschbare und unberechenbare Gefahren drohen. Und Ähnliches kann man über die Politik sagen - mit solchen Dingen wie Brexit zum Beispiel oder entfesselten Finanzmärkten oder auch mit dem amerikanischen Präsidenten Trump - wird Politik plötzlich ganz unberechenbar und ganz unvorhersehbar.
Und im Kleinen geht es uns oft auch so. Wenn zum Beispiel Leute Abitur machen, das ist ja gerade sehr aktuell, dann stellen sie irgendwie fest, dass sie danach zwar den besten Studiengang auswählen sollen, dass das aber bei 19.000 Studiengängen ganz schön schwierig ist. Die Unverfügbarkeit, das Unberechenbar-Werden von Erleben ist ein spät-modernes Alltagsphänomen, das sich jetzt in Corona tatsächlich mal bündelt.
Kontrollierbar, erreichbar, verfügbar
Fritz: Moderne Menschen wollen alles unter Kontrolle bringen, beherrschen, das haben sie jetzt gerade erläutert. Warum ist uns das eigentlich so wichtig?
Rosa: Wir haben das fast zum Inbegriff eines gelingenden Lebens gemacht. Dass wir Sachen verfügbar haben. Ich nenne das eine Form der Weltbeziehung. Menschen sind immer in einer anderen Welt gegenübergestellt, die in vielerlei Hinsicht verlockend und attraktiv ist. Die birgt viele interessante Dinge, aber eben auch viele gefährliche und unberechenbare Dinge.
Es hat sich seit einigen Jahrhunderten, seit dem, was wir Beginn der Neuzeit nennen, eine Vorstellung des guten Lebens entwickelt. Die sagt, dass dein Leben besser wird, wenn du deine Weltreichweite vergrößerst - und zwar systematisch und kontrolliert vergrößerst. Also, dass wir immer mehr Ausschnitte der Welt, egal in welche Richtung wir schauen, zugänglich machen, also ökonomisch erschließen, dass wir es uns leisten können und technisch eben beherrschen.
So buchen dann Leute zum Beispiel eine Polarreise, bei der sie so etwas wie eine Polarlicht-Garantie kriegen. Das heißt, sie können dann einklagen, ein Recht zu haben, dass da auch tatsächlich ein Polarlicht auftritt, sonst können sie den Reiseveranstalter verklagen. Das ist eine bestimmte Form, mit der Welt in Kontakt zu treten, die eben auf Kontrollierbarkeit und Erreichbarkeit setzt. Ich nenne das "das Paradigma der des Verfügbarmachens".
Feindlich gegenüber der Welt
Fritz: Hat das auch etwas damit zu tun, dass wir die Welt als feindlich wahrnehmen, als aggressiv?
Rosa: Ja, ich glaube aber, dass es vielleicht eher umgekehrt ist. Wir wollen Welt systematisch erschließen, also wissenschaftlich, sozusagen durchdringend, mit Teleskopen immer tiefer ins Weltall hinaus und mit Mikroskopen immer tiefer in die Materie hinein. Und alle Arten von Technik verheißen uns eigentlich ein angenehmeres, ein besseres oder ein schöneres Leben. Wir haben das natürlich auch zu einem wirtschaftlichen Programmen gemacht. Da sind wir gezwungen, uns permanent zu steigern, also jedes Jahr mehr zu zieren, mehr herzustellen, mehr zu verteilen, auch mehr zu konsumieren und dieser dauernde Zwang der Steigerung, der institutionalisierte Zwang der Steigerung, zwingt uns jetzt in ein aggressives Weltverhältnis.
Aber auch das kann man auf allen Ebenen sehen: Wir stehen der Natur aggressiv gegenüber. Das hängt schon mit dem Programm der Verfügbarmachung zusammen, indem wir sie auf der einen Seite besser kontrollieren und dabei auch ausbeuten und indem wir sie vergiften, auf der anderen Seite. Dann droht eben dieser Umschlag, dass sie uns dabei bedrohlich wird.
Wir sehen dieses Aggressionsverhältnis eigentlich auch im Blick auf Politik. Denn wir nehmen auch im politischen Leben, im Zusammenleben mit den anderen, im sozialen Leben wahr, dass wir Welt nicht einfach verfügbar machen können, weil die anderen sich immer widersetzen. Da sehen wir tatsächlich in den letzten Jahren - das kann man mit den Mitteln der empirischen Sozialforschung gut beobachten - eine wachsende Feindseligkeit gegenüber den politisch Andersdenkenden.
Es gibt eine Studie aus England von der London School of Economics, die zeigen kann, dass geradezu der Hass und der Ekel gegenüber dem politisch Andersdenkenden in fast allen sogenannten etablierten Demokratien zunehmen. Übrigens auch darüber, zum Beispiel in Indien oder Brasilien oder anderswo, weil sich Politik eben nicht so leicht verfügbar machen lässt. Ich glaube, wir haben sogar einen Aggressionsverhältnis uns selbst gegenüber, was man zum Beispiel einen wachsenden Burn-out-Raten ablesen kann.
Das Glück und das Monster
Fritz: Heißt das denn letztlich, dass es uns unglücklich macht, wenn wir versuchen, die Welt immer uns immer weiter verfügbar zu machen?
Rosa: Ich denke, dass das so eine paradoxe Nebenfolge ist, weil das, was ich komplett verfügbar gemacht habe, mir stumm gegenübertritt, entfremdet. Deshalb habe ich ein kleines Buch darüber geschrieben, das den Titel "Unverfügbarkeit" trägt. Dort habe ich versucht zu zeigen, dass wir eigentlich Glückserfahrungen immer da machen, wo wir einer Sache, die an und für sich unverfügbar ist, gegenüberstehen. Oder zumindest, dass sich das Leben, auch das des gelingende Leben, immer an der Grenze zwischen dem Verfügbaren und Unverfügbaren vollzieht.
Man kann es sich an sozialen Beziehungen oder Intimbeziehungen gut klarmachen. Also, wir können eigentlich nur Menschen lieben - oder - wir lieben Personen dann, wenn wir sie eben nicht völlig beherrschen, wenn sie uns nicht völlig verfügbar sind. Das, was da zwischen Menschen entstehen kann, hat Lebendigkeit, weil der andere sich immer auch entzieht, immer auch anders antwortet oder anders handelt. Das gilt für fast alles.
Ein Buch fasziniert uns so lange, wie da noch etwas drin ist, was wir nicht völlig beherrschen, kennen, erschlossen haben. Deshalb glaube ich, man kann einerseits sagen: Eine vollständig verfügbar gemachte Welt wäre eine tote und stumme Welt. Und noch schlimmer: Dieses Programm der völligen Verfügbarmachung schlägt hinter unserem Rücken um und erzeugt eigentlich eine chaotisch-unverfügbare Welt. Ich nenne das die Rückkehr der Unverfügbarkeit als Monster. Das heißt, dass wir dann plötzlich mit einer Unverfügbarkeit, so wie dem Coronavirus, konfrontiert sind, mit der wir auch nicht mehr in Resonanz zu treten vermögen, sondern die wir nur noch als bedrohlich erfahren.
Resonanz: berührt werden, lebendig sein und sich verwandeln
Fritz: Jetzt haben sie gerade den Begriff Resonanz benutzt, ein zentraler Begriff in ihren Vorstellungen. Können Sie mal erläutern, was Sie damit eigentlich meinen?
Rosa: Normalerweise erleben wir eigentlich ein Programm, auch ein institutionalisiertes Programm, das auf Verfügbarmachung abzielt. Das können wir ein bisschen an unseren To-do-Listen ablesen. Die allermeisten Menschen von uns – es gibt es gibt immer auch Ausnahmen und Gegentendenzen -, aber für die überwältigende Mehrheit gilt, dass sie eigentlich schon, wenn sie morgens aus dem Bett steigen, von der Alarm-Clock geweckt werden, in den Alarm-Modus gesetzt werden.
Wir sind alarmiert, weil wir irgendetwas erledigen müssen, abhaken müssen. Also, ich muss meinen Job natürlich erledigen und im Job tausend Aufgaben. Ich muss das einkaufen, ich muss jenes loswerden. Ich muss hier noch eine Erklärung abgeben. Ich muss jenem noch antworten und so weiter. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in einem dauernden Modus des Verfügbarmachens, und ich nenne es manchmal auch Alltagsbewältigungs- Verzweiflungs-Modus. Auf jeden Fall ist es eine Art von Aggressionshaltung zur Welt, in der uns ganz wenig wirklich berührt und lebendig fühlen lässt oder verwandelt.

Wir kennen alle, aber auch einen anderen Modus und sehnen uns danach. Und das nenne ich den Resonanz-Modus, bei der uns eine Sache plötzlich wirklich berührt. Das kann ein Anblick sein, vielleicht von einer Landschaft, aber vielleicht auch ein Mensch, dem wir begegnen, oder eine Melodie, die wir hören, oder eine Idee, der wir über den Weg laufen, die uns plötzlich sozusagen inwendig er greift oder bewegt.
Resonanz vs. Verfügbarkeitslogik
Das ist ein Moment von Resonanz, aber nicht das einzige. Denn zu einer Resonanzbeziehung kommt dann, dass wir darauf antworten, dass wir dem mit der Sache oder dem Menschen, die uns da berühren, in Interaktion treten und darauf antworten. Genau dadurch verwandeln wir uns.
Wir haben eigentlich, wenn wir in Urlaub fahren und sehr viele Menschen träumen von Urlaub oder fahren im Urlaub, immer diese Resonanzhoffnung, dass wir da einer Sache begegnen, vielleicht einer Kirche, wenn wir uns für Kulturgebäude interessieren, oder einem Strand, wenn wir uns für Natur interessieren, die uns wirklich sozusagen aufgehoben fühlen lassen, aber auch berühren und dass wir dann da aufgehen mit dieser Landschaft oder dieser Kirche oder dieser Melodie oder den Menschen in Interaktion treten können und dadurch lebendig und verwandelt werden. Das sind Resonanzmomente.
Aber das Entscheidende, der entscheidende Punkt ist, dass sie immer ein Moment der Unverfügbarkeit haben. Wir können das nicht einfach kaufen. Wir versuchen es, indem wir eine Reise kaufen oder ein Konzertticket. Aber ob es da wirklich zu einer Resonanzerfahrung kommt, ist ungewiss. Und wenn es zur Resonanzerfahrung kommt, kann man meistens nicht sagen, was dabei herauskommt. Deshalb ist diese Resonanzlogik immer in Spannung oder sogar im Widerspruch zu einer Steigerungslogik oder einer Verfügbarkeitslogik.
Corona: Misstrauen statt Resonanz
Fritz: Das alles, was Sie gesagt haben, kann, negativ ausgedrückt, auch auf die Corona-Pandemie zutreffen. Das ist ja auch etwas, was uns sehr stark berührt, worauf wir reagieren, die uns verändert. Würden Sie sagen, dass es so eine Art negative Resonanzerfahrung?
Rosa: Das ist eine Sache, die wir immer wieder diskutieren in den Sozialwissenschaften. Wie sollen wir das begrifflich erfassen? Ich würde das nicht als Resonanz beschreiben, also nicht per se, und zwar deshalb nicht, weil wir in der Regel versuchen, uns zu verschließen gegenüber dem Virus. Social Distancing ist ein guter Indikator dafür.
Wir wollen davon nicht berührt werden und versuchen, es mit allen Mitteln zu vermeiden. Und wenn wir berührt werden, wollen wir es so schnell wie möglich wieder loswerden. Das nenne ich eher eine Repulsionsbeziehung, also eine Abstoßungsbeziehung. Das ist eigentlich eine Form von Entfremdung. Es schafft Misstrauen zur Welt, führt dazu, dass wir uns verschließen, dass uns der andere, der uns begegnet, als gefährlich erscheint. Und das uns sogar die Welt wieder gefährlich erscheint, weil du nie weißt, was da in der Luft liegt sozusagen, und ob vielleicht sogar der Türgriff oder der Ball, der auf mich zugeflogen kommt, infiziert ist. Und diese Art von Misstrauensbeziehung, die zu einer Schließung und zu einer Abwehr führt, ist nicht diese Form von Resonanz, die mich zur Öffnung und Verwandlung bringt.
Corona und Religion
Fritz: Jetzt könnte man ja sagen: In einer solchen Zeit, in der eine große Unsicherheit entsteht, in der, wie Sie sagen, die Menschen sich verschließen und keine Resonanzerfahrung entsteht, da könnten ja Instanzen des Unkontrollierbaren, des Unverfügbaren eine Rolle spielen. Ich denke an die Religionen. Welche Rolle könnten die Religionen in dieser Corona-Zeit eigentlich spielen? Was könnten die jetzt leisten?
Rosa: Eine wichtige Funktion von Religionen kann auf der einen Seite sein, dass sie uns sozusagen Unverfügbarkeit oder Kontingenzen mit einem Sinn erfüllen. Menschen stehen immer vor dem Problem, dass sie Kontingenzen bewältigen müssen, das heißt einfach Zufälle, unerklärliche Dinge. Religionen können ein Weg sein, das, wenn die Krankheit oder das Virus kommt, als Geschick zu erfahren.
Man versucht, dem einen Sinn zu geben und erfährt eine Art von Anruf darin. Das ist vielleicht nicht der ideale Weg, mit so einer Bedrohung wie dem Virus umzugehen, weil wir das inzwischen auch gut biologisch erklären können. Aber es ist natürlich schon so, dass diese Stillstellung, die wir zum Teil erfahren, oder diese Durchkreuzung von Lebensplänen und natürlich auch die damit entstehende Ungewissheit, Menschen auf die existenzielle Dimension verweist.
Was ist eigentlich systemrelevant?
Das sieht man sogar in der gesellschaftlichen Ebene, wo wir plötzlich fragen: Was ist eigentlich systemrelevant? Und damit eigentlich nicht das ökonomische System meinen, sondern das Leben. Was ist eigentlich das, was wirklich wichtig ist in unserem kollektiven Leben? Dann ist es schon so, dass Religion so etwas wie eine existenzielle Resonanzachse bilden kann. Sie hat sozusagen ideelle Momente, aber eben auch praktische Erfahrungen, uns mit dem Leben oder der Natur oder der Welt als Ganzes in einem Antwort-Zusammenhang erfahren zu lassen.
Das heißt, Religion kann so etwas stiften wie die Erfahrung existenzieller Resonanz, dass ich mit meinem Leben in einem Antwort-Verhältnis stehe zu einem anderen. Dieses Andere, mit dem ich in einer Antwort-Beziehung stehen kann, wird in der Religion natürlich häufig als Gott bezeichnet. Dafür steht uns Gott als Inbegriff: Das, was uns hört und sieht und uns in einer Form antwortet, die gerade unverfügbar ist.
Also Religionen haben tatsächlich Weisen, mit Unverfügbarkeit umzugehen, immer auch schon gehabt. Also, dass man gerade nicht den Anspruch haben muss, sein Leben komplett unter Kontrolle zu haben, weil man glaubt, da besteht vielleicht so etwas wie ein Antwort-Verhältnis, jenseits dessen, was ich verfügbar machen kann. Insofern kann Religion eine wichtige kulturelle Ressource sein, eine ideelle Ressource, aber auch eine Ressource, die eine entsprechendes Praxis im Arsenal hat, im Gebet zum Beispiel oder natürlich auch über Kirchenlieder oder über religiöse Lieder, aber auch über andere Praktiken. Achtsamkeitspraktiken zum Beispiel können auch religiös aufgeladen sein. Sie stellen Versuche dar, so etwas wie existenzielle, vertikale Resonanz zu erfahren.
"Eine Weltverschwörung zu vermuten, das ist bestimmt keine gute religiöse Intervention"
Fritz: Warum hört man Ihrer Meinung nach so wenig von den Religionsgemeinschaften in dieser Krisenzeit? Das wäre doch eigentlich die Stunde der Religionen?
Rosa: Ich glaube, weil es gefährlich wäre, wenn man etwas, das man ziemlich offensichtlich biologisch und medizinisch und virologisch erklären kann, wenn man das plötzlich mit religiösen oder theologischen Begriffen, wie sie überliefert sind, zu interpretieren versuchte, also zum Beispiel das Virus als geschicktes oder so.
Ich glaube, das würde den Religionen auch nicht gerecht werden. Das ist nicht mehr unser Verständnis. Wir haben es mit einem Phänomen zu tun, was allenfalls auf einer sehr vermittelten Ebene eine religiöse Bedeutung gewinnen kann. Aber der Diskurs, den wir führen in der Gesellschaft, ist eigentlich einer, vielleicht sogar einer Panikreaktion auf Unverfügbares, weil uns das Virus Unverfügbarkeit massiv vor Augen geführt hat. Und wir reagieren gesellschaftlich mit dem Versuch, das wieder verfügbar zu machen, also einen Impfstoff zu finden oder ein Heilmittel oder wenigstens politische Regelungen, also Social Distancing oder so, dass uns das Virus unter Kontrolle bringen lässt.
Ich glaube, Religion kann und sollte da jetzt nicht so etwas wie Gegenstrategien oder Gegenideen entwerfen. Aber sie kann schon eine Stimme sein, die uns das Verhältnis von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit noch einmal vor Augen führt.
Es ist in der Tat ein bisschen bedauerlich, dass relativ wenig von Kirchen oder von religiösen Vertretern kommt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das ist meine Wahrnehmung, da ich in letzter Zeit häufig in den kirchlichen oder auch theologischen Kreisen eingeladen war und auch in die Diskussion trat. Und ich habe mich oft gewundert, wo eigentlich diese Mutlosigkeit herkommt, dass da so ein bisschen das Gefühl entsteht: Die Gesellschaft will uns nicht hören.
Ich glaube schon, dass es jetzt auch eine Zeit wäre, in der Gesellschaft eine religiöse Stimme zu hören, man darf sie nur nicht kurzschließen, wie es einige aus sehr konservativen katholischen Kreisen versucht haben, dahinter eine Weltverschwörung zu vermuten, das ist bestimmt keine gute religiöse Intervention.
Soziale Kontrolle und Verschwörungstheorie
Fritz:Was passiert eigentlich, wenn Menschen nicht akzeptieren wollen, dass das Leben zu einem erheblichen Teil unbeherrschbar bleibt? Wie durch diese Pandemie? Ist das möglicherweise der Grund dafür, warum plötzlich so viele Verschwörungstheorien zum Coronavirus in der Welt sind?
Rosa: Ich glaube, das kann eigentlich ein Grund dafür sein. Man sieht sehr unterschiedliche Stile, mit diesem plötzlichen Auftreten von Unverfügbarkeit umzugehen. Ich glaube, dass führt auf der einen Seite vielleicht zu diesen Vorstellungen von sozialen Kontrollen. Also wenn man da Ideen hört, dass wir eben mit allen Mitteln die Isolierung soweit vorantreiben müssen, dass die Weiterverbreitung des Virus auf null gesetzt wird.
Dann ging das mit einem so hohen Preis für Sozialität und für das Leben insgesamt einher, dass man sagen muss: Da wird die Verfügbarkeitsidee komplett überzogen, also im medizinisch-technischen Sinne. Und das Gleiche ist tatsächlich die Vorstellung: Da muss doch jemand dahinter stecken. Das muss doch jemand gewesen waren. Das muss man doch irgendwie eindeutig zuordnen können.
Das ist eine Art von kognitiv-politischem Verfügbarmachen. Das ist ein Versuch, tatsächlich im Sinne einer Erklärung, das vielleicht Unerklärbare und auch Unfassbare, Unkontrollierbare erstmal erklärbar zu machen. Und natürlich verbindet sich dann häufig damit auch die Idee: Wenn ich weiß, wer es ist - also Bill Gates oder ich weiß nicht, wer den Brunnen vergiftet hat sozusagen -, dann geht damit häufig die Idee einher, dass man es auch bekämpfen und ausschalten kann. Diese Art von Verfügbarmachen haben wir historisch oft gesehen und es führt zu katastrophalen und totalitären Exzessen.
Gutes Leben - langes Leben?
Fritz: Hat sich eigentlich unser Verhältnis zum Sterben und Tod durch die Pandemie verändert?
Rosa: Ich denke, dass es uns auf jeden Fall dazu bringt, darüber noch einmal nachzudenken. Also, ich stimme mit allen überein, die sagen, man darf nicht ein menschliches Leben gegen zum Beispiel wirtschaftliche Profite rechnen und dann sagen: Ab einem gewissen Level ist das Leben das dann nicht mehr wert. Das hielte ich für ganz falsch. Aber ich glaube, was wir schon brauchen, was vielleicht menschliches Leben immer braucht, ist eine Reflexion über das, was Leben für uns heißen soll, und auch, was ein Leben zu einem guten Leben macht.
Da glaube ich tatsächlich, weil wir wissen, wie heikel diese Frage ist und weil wir letzten Endes die Frage des guten Lebens privatisiert haben, im Sinne von: "Das muss jeder für sich selbst wissen" ist das, worauf es beim Leben ankommt, fast nur noch das lange Leben geworden. Leben muss möglichst lang sein. Und da ist möglicherweise ein Kurzschluss vorhanden.
Wir müssen das gute und das lange Leben noch einmal neu durchdenken, denn es gibt gute Gründe dafür zu sagen: Eine Kultur, die eigentlich alle Energie darauf verwendet, ein möglichst langes Leben herzustellen, ist eigentlich eine Kultur, die sich auf diese letzte der Grenzen, diese unverfügbare Grenze, nämlich den Tod, konzentriert. Und ist sie deshalb, obwohl es uns immer ums Leben geht, keine Kultur des Lebens mehr, sondern eigentlich eine Kultur des Todes, weil wir fixiert sind auf diese letzte Grenze, die wir leugnen, verdrängen und möglichst weit hinausschieben wollen?
Deshalb glaube ich: Corona kann dazu führen, vielleicht sollte es sogar dazu führen, dass wir darüber nachdenken, ob wir ein neues Verhältnis von gutem Leben und langem Leben brauchen. Dann wiegt man nicht das Leben, das menschliche Leben, gegen irgendetwas anderes ab, das, glaube ich, darf man wirklich nicht. Aber man kommt auf eine neue Definition dessen, was Leben ist, indem man Leben gegen Leben, also langes Leben gegen gutes Leben vielleicht abgegrenzt oder abwägt.
Sensible Punkte in der Diskussion
Fritz: Der Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, hat mit seiner Überzeugung zum Lebensschutz in der Corona-Krise für viele Diskussionen gesorgt. Er sagte, dass seiner Meinung nach der Lebensschutz im Grundgesetz im Unterschied zur Menschenwürde kein absoluter Wert sei, sondern durch andere Grundrechte einschränkbar. Das hat auch etwas mit unserem Verhältnis zu Sterben und Tod und zum Leben zu tun. Das hat viele schockiert. Warum?
Rosa: Weil ich glaube, da gibt es eine hohe Sensibilität und mit guten Gründen auch eine historisch gewachsene Sensibilität dafür, dass man eben tatsächlich das individuelle Leben für unverhandelbar erklärt. Denn wir wollen nicht - das würde ich nicht wollen, das würde vermutlich auch Herr Schäuble nicht wollen – dass es dann irgendwann sozusagen einen politischen Diskurs darüber gibt, welches Leben es jetzt vielleicht nicht mehr wert ist, erhalten oder gerettet zu werden. Da besteht, glaube ich, ganz zu Recht, eine große Sensibilität.
Aber es besteht natürlich zugleich die Wahrnehmung, dass wir da vielleicht noch mal drüber nachdenken wollen. Es kommt jetzt, glaube ich, wirklich sehr darauf an, was man im Sinn hat und auch, wie man es formuliert. Ich würde nicht sagen, dass man den Schutz des Lebens anderen Erwägungen opfern sollte, also insbesondere nicht ökonomischen Erwägungen.
Aber die Frage ist: Wie man Leben schützt und was Leben schützen heißt. Dann kommen tatsächlich dann solche Momente, wie Freiheit zum Beispiel, mit ins Spiel. Und überhaupt eben diese Frage, was gelingendes Leben ist. Aber man sieht es an Äußerungen wie der von Schäuble oder auch von einem Tübinger Oberbürgermeister, dass wir da sensible Punkte berühren, wo man sensibel diskutieren muss. Aber man darf nicht um die Diskussion herum.
Was können wir aus der Pandemie lernen?
Fritz: Was können wir aus der Corona-Pandemie lernen? Viele sind zu Hause geblieben, haben sich an die Beschränkungen gehalten und hatten Zeit, über das Leben und die Werte in ihrem Leben nachzudenken. Können wir überhaupt etwas lernen? Wird sich etwas ändern?
Rosa: Ja, das ist das ist die große Frage. Ich glaube, das hängt jetzt wirklich von uns allen ab, ob wir daraus eine Erkenntnis ziehen wollen, ob wir etwas ändern wollen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, Menschen haben tatsächlich jetzt individuelle Erfahrungen mit sich selbst gemacht. Vielleicht sind auch viele Illusionen geplatzt, weil wir eigentlich gerade das, was wir Resonanz-Hoffnungen nennen können, in aller Regel in die Zukunft verlagern.
Die allermeisten Menschen leben dann ein bisschen von der Hoffnung, vielleicht kann man auch sagen, von der Illusion, dass sie, wenn sie nur mal Zeit hätten, dass sie dann Klavierspielen würden zum Beispiel oder den Schrebergarten anfangen würden. Oder so etwas. Und jetzt hatten viele unverhofft und an plötzlich Zeit, sich ans Klavier zu setzen oder in den Garten zu machen, und haben festgestellt: Das ist gar nicht so toll, wie ich immer dachte.
Da stellt man fest: Wir können nicht einfach auf Knopfdruck unseren Weltbeziehungs-Modus, die Art, wie wir mit der, in der Welt, in die Welt gestellt sind, ändern. Und vielleicht laufen unsere Resonanz-Sensibilitäten inzwischen auch woanders als dort, wo wir es immer gedacht haben. Also da können wir individuell vielleicht etwas lernen, auch dass man systematisch solche Dinge einüben muss und das nicht einfach dann im Ruhestand auf Knopfdruck hinkriegt.
Aber ich glaube, wir können auch kollektiv etwas lernen, was vielleicht auch wirklich positiv ist. Wir haben nämlich in den letzten Jahrzehnten die Erfahrungen gemacht, politisch mehr oder minder ohnmächtig zu sein. Das beste Beispiel ist die Klimakrise, wo es eigentlich einen breiten Konsens gibt, dass da etwas geschehen muss. Schon sehr viele Menschen sagen, das ist eigentlich das wichtigste und vordringlichste Problem. Und wir haben uns immerzu als machtlos erlebt, weil man irgendwie dachte: Naja, gegen den zunehmenden Verkehr und die immer weiter steigenden Flugreisen und Kreuzfahrten - da kann man sowieso nichts machen. Und gegen die entfesselten Finanzmärkte kann man erst recht nichts machen.
"Wir sind politisch handlungsfähig, wenn die Entschlossenheit groß genug ist"
Und jetzt haben wir gesehen, dass man sehr wohl politisch handeln kann und eigentlich innerhalb weniger Wochen und auch ohne Katastrophe. Denn es ist ja nicht das Virus, das die Flugzeuge vom Himmel geholt hat. Wir sind politisch handlungsfähig, wenn die Entschlossenheit groß genug ist, wenn der politische Wille auch groß genug ist.
Und deshalb hoffe ich, dass wir auch politisch zweierlei lernen; nämlich erstens: Wir wären auch gegenüber anderen Krisen handlungsfähig, zum Beispiel der Klimakrise, aber auch der wachsenden sozialen Ungleichheit im globalen Maßstab, die ja eigentlich ungeheuerliche Ausmaße erreicht.
Und zweitens: wir brauchen eben doch einen starken, handelnden Staat, der letzten Endes auch über ökonomischen Eigengesetzlichkeiten steht. Ich glaube, was wir lernen können, ist, die Frage der Systemrelevanz noch mal neu zu stellen. Systemrelevant sollte eben nicht heißen: Was ist relevant für das Aufrechterhalten der Finanzmärkte, sondern was ist relevant und wichtig für das Aufrechterhalten unseres Lebens, für ein gelingendes Leben. Und da sollten wir auch im globalen Maßstab noch mal in neue Diskussionen treten.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Hartmut Rosa: "Unverfügbarkeit"
Residenz Verlag, Wien und Salzburg 2018, 130 Seiten, 19 Euro.
Residenz Verlag, Wien und Salzburg 2018, 130 Seiten, 19 Euro.