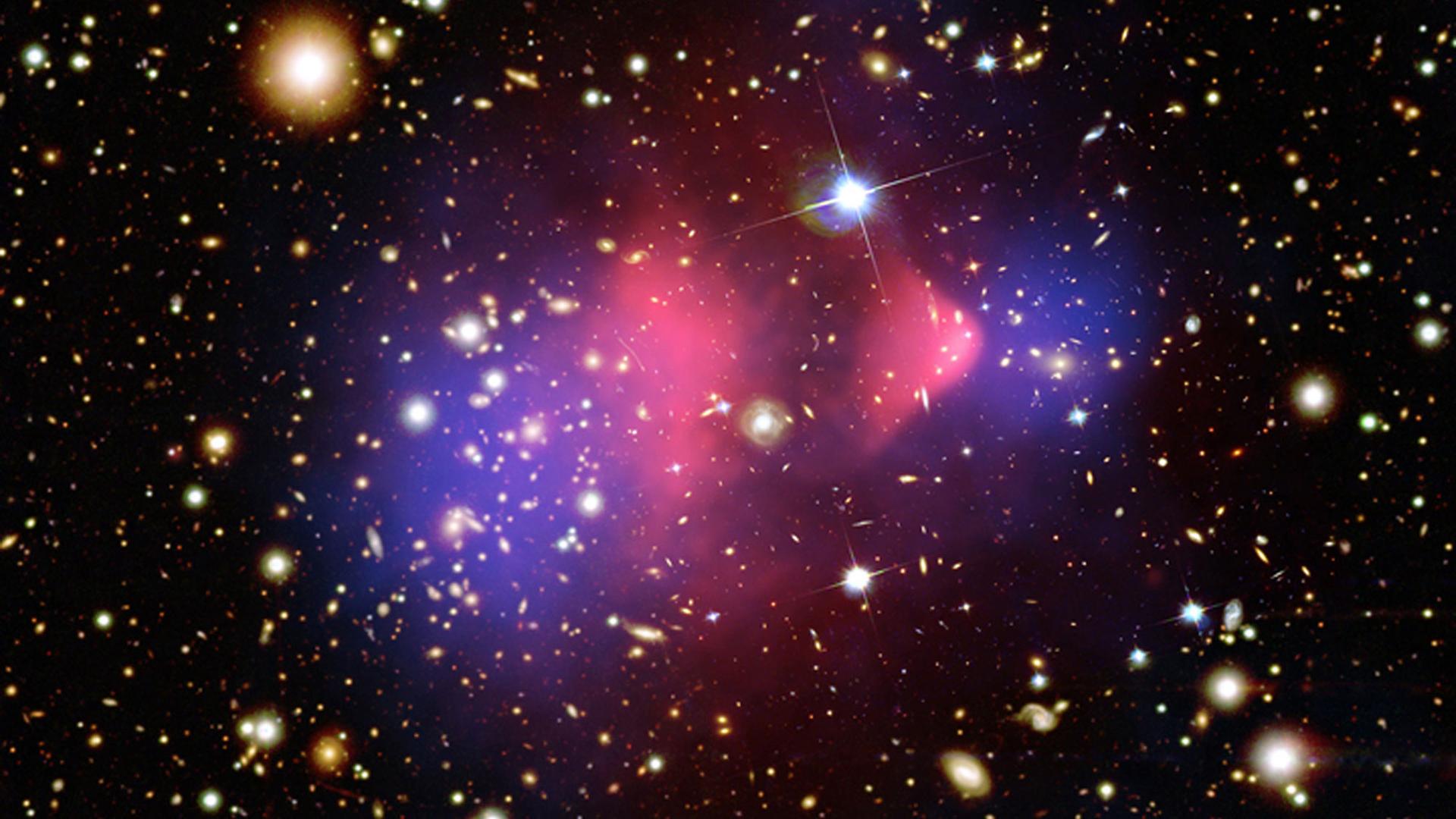Es ist kaum zu glauben: Die Vorfahren selbst des schwersten Argentinosaurus waren kleine, zweibeinige Raubtiere. Die verlegten sich dann im Lauf ihrer weiteren Evolution aufs Pflanzenfressen - und auf Riesenwuchs: "Die riesigen pflanzenfressenden Saurier sind faszinierend, weil sie die größten Landtiere waren, die jemals gelebt haben. Doch wer als riesenwüchsiges Landtier erfolgreich sein will, muss in seiner Evolution viele Veränderungen im Knochenbau und der Physiologie durchlaufen. Um die Entwicklungen zu verstehen, müssen wir in der Trias ansetzen, der Zeit vor mehr als 200 Millionen Jahren: Das beweisen uns die beiden Fossilien, die wir beschreiben, und die derzeit die ältesten Landtiere mit Riesenwuchs überhaupt sind."
Es geht um eine neue Art namens Ingentia prima und um ein weiteres Exemplar von Lessemsaurus, die beide im Nordwesten Argentiniens gefunden worden sind. Beide belegen, dass das Phänomen Riesenwuchs mindestens 15 Millionen Jahre früher auftauchte als bislang gedacht. Ingentia und Lessemsaurus lebten zu einer Zeit, als andere Dinosaurier höchstens 1,8 Tonnen wogen.
Überlanger Hals kein zentraler Faktor für die Größe
Sie sind entfernte Verwandte der Titanosauria, erklärt Diego Pol vom Museo Paleontológico Egidio Feruglio in Patagonien, und sie stehen für die ersten evolutionären Versuche mit Riesenwuchs, den die riesigen, pflanzenfressenden Sauropoden mit ihren Säulenbeinen, langen Schwänzen und Hälsen dann perfektioniert haben.
"Diese frühen Arten waren wohl fünf bis neun Tonnen schwer und lagen damit im Bereich der modernen Elefanten. Für die Dinosaurier waren Ingentia und Lessemsaurus jedoch nur der erste Schritt. Wenn man sie mit den anderen Sauriern ihrer Zeit vergleicht, dann liefen sie bereits auf vier Beinen, und ihre Köpfe waren klein. Doch ihre Hälse waren sehr viel kürzer als beispielsweise bei einem typischen Titanosaurier."
Als derzeit älteste bekannte Landtiere mit Riesenwuchs bieten die beiden den Paläontologen die Chance, die vielen Veränderungen, die auf dem Weg zu Gigantismus notwendig waren, zu gewichten. So scheint - entgegen der bisherigen Meinung - der überlange Hals kein zentraler Faktor zu sein, wohl aber vier kräftige Beine.
"Auch das schnelle Wachstum war wohl ein Schlüssel zum Gigantismus. Ganz nach Dinosaurierart sind die beiden im Sommer schneller gewachsen als im Winter. Doch wir erkennen außerdem, dass ihr Wachstum in der ersten Lebensphase sprunghaft und besonders schnell war."
Hohlräume in den Knochen
Ein weiterer wohl zentraler Punkt: In ihr Skelett sind anscheinend schon Luftsäcke "eingearbeitet" - Hohlräume in den Knochen.
"In den Skeletten der Riesensaurier sehen wir viele dieser Lufthohlräume. Sie standen wahrscheinlich mit der Lunge in Verbindung und wären dann - wie bei den Vögeln - Teil eines verbesserten Atmungssystems. Wenn Du ein riesiges Landtier sein möchtest, musst du zum einen dein Skelett leichter machen, und da sind Hohlräume gut. Und zum anderen ist dein Energiebedarf höher - für die Bewegung, die Fortpflanzung, für alles. Du brauchst einen sehr aktiven Stoffwechsel und deshalb hast du einen höheren Sauerstoffbedarf."
Die wirklichen Giganten sollten erst 30 Millionen Jahren später entstehen, im Jura. Und welche weiteren Entwicklungen dazu notwendig waren, damit will sich die Gruppe um Diego Pol als nächstes beschäftigen.