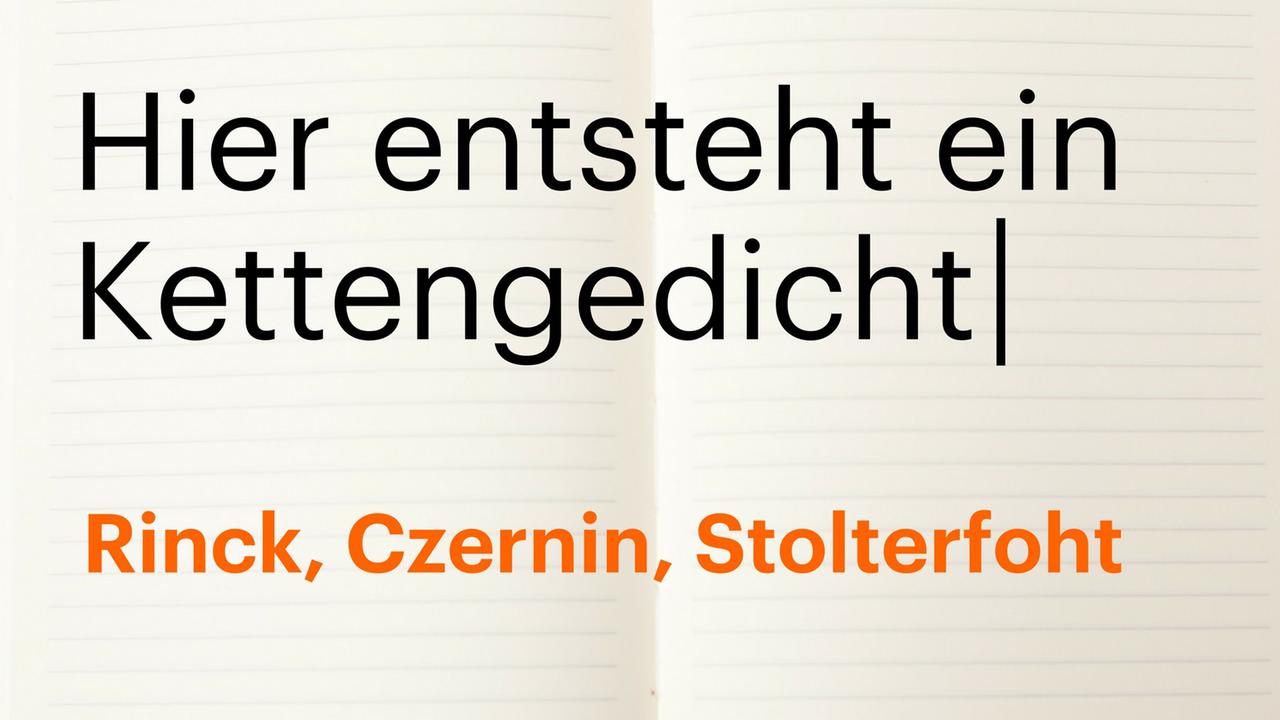Eine treffende Formulierung besagt, dass nach dem Ende des Nationalsozialismus die deutsche Literatur zur Moral fand, die österreichische dagegen zur Moderne. In der Tat hat die Sprachskepsis der Nachkriegszeit vor allem in Österreich zu einer reichen Praxis und Theorie experimenteller Literatur geführt. In dieser Tradition steht der als "poeta doctus" gefeierte Franz Josef Czernin, der seit nunmehr vierzig Jahren mit seinen Gedichten und Essays eine Art Universalpoesie anstrebt. Unter diesem hochfahrenden, ursprünglich romantischen Impuls arbeitet er sich an literarischen Quellen ab – von Dante und Shakespeare über den Barock bis zum Symbolismus. Czernin schreibt quasi im Auftrag der Früheren. Nach zwei als Umschreibung der Grimmschen Märchen angelegten Prosabüchern ist es nun Wilhelm Müllers "Winterreise", die ihn zum Weiterdichten anregt – jener romantische Liederzyklus, den Schubert vertonte, mit Versen wie diesen:
"Manche Trän’ aus meinen Augen
Ist gefallen in den Schnee;
Seine kalten Flocken saugen
Durstig ein das heiße Weh."
Müllers Winterwanderung
Tränen und Flocken, heiß und kalt, Sehnsucht und Klage, Winterweiß und Frühlingsgrün, Herz und Liebe, Posthorn und Wegweiser, Eis, Schnee und brennendes Weh – diesen Motiven und Antithesen aus Müllers düsterer Winterwanderung begegnet man in dem Band "reisen, auch winterlich" wieder. Bei Czernin werden sie als Teil des Sprachmaterials durch fragmentierende und transformierende Verfahren in eine mehrdeutige, abweichende Kombinatorik überführt. Ein Bekenntnis zu dieser Operation kann man gleich im zweiten Gedicht erkennen, wo es unter dem bezeichnenden Titel "immer nachfahren" heißt:
"ich tret dir gleich die ferse ab"
vorausgesetzt, man ersetzt das F der Ferse durch ein V – wobei offen bleibt, welcher Dichter dem anderen hier seine lyrischen Verse abtritt. Das Kompositum "Fersengold" evoziert dementsprechend nicht nur "Fersengeld", sondern etwas wie einen "goldenen Vers". Ebenso lassen die Lider des Auges an sangbare Lieder denken, und ein Wort wie "erzelend" konnotiert natürlich "erzählend", zumal wenn es in der Nachbarschaft von "schmerzzählend", "herzquälend", "fortwähr" und "immer wehrend" erscheint. Wer einmal auf diesen Trichter gekommen ist, stößt allüberall auf Czernins altbewährte, an der konkreten Poesie geschulte Methode der Verschiebung abgesunkener Metaphern und Redewendungen. Der Dichter schafft es, in zehn Zeilen neun von ihnen unterzubringen: "außer Rand und Band, krumm nehmen, schlimmer Finger, über Stock und Stein, zu Tränen gerührt, auf dem falschen Fuß, im Handumdrehn, am seidnen Faden hängen, auf den Kopf stellen". Man höre und staune:
"... schon
ausser rand und bänder dies
verfahren, krumm genommen, ungrad
gebend, zeigst mir schlimm den finger,
also schief anbahnend selbst dich
über stock und bein; ob auch
zu sehnen bist gerührt; am falschen
fluss verleitend irrführst mich,
gelockt an seidne fäden hängst,
im hand-, ja auch dreist rumpfumdrehn:
so stellt sich alles auf den schopf ..."
Romantisches Herzklopfen
Die kalauernde Anmutung solcher Passagen steht im Widerspruch zu dem klassischen Ernst von Czernins Kompositionen. Trotz ihrer kalkuliert zersprengten Syntax erzielt die rhythmisch gefällige, zuweilen sogar metrisch exakte Form der in Strophen angeordneten Verse eine harmonische Prosodie, synkopiert durch Zeilensprünge und klanglich ausgearbeitet mit weitgespannten Binnenreimen und lautmalerischen Tönen. Nur eine Lektüre, die davon absieht, dass etwa im wort "dickluft" auch "die Kluft" entdeckt werden will oder der Ausdruck "fleischnebel kreissten" die Bedeutung "Schnäbel kreischten" enthält, kann sich einem Sinn überlassen, der sich aus der puren Sinnlichkeit von Klang und Lexik ergibt. Dann vernimmt man z.B. im Gedicht "post" ein wahrhaft romantisches Herzklopfen:
"dies schellen: da bin längst vernarrt,
herzlautend heftig, schlag um schlag,
rasch liefst, doch kaum auf uns hinaus,
mich nur am anderen platz liesst ein,
halbwach; was hier auf schwellen harrt,
mir bat sich erzerweichend kund:
fernlieb rief ort, gemeinsam weg,
da, töricht, räume trug aus weit,
dir nach; mir weh verfahren, dich hast
fortgemacht, doch offen tor verblieb;
sehr wund dir angetan ..."
Rhetorische Spielchen
Dennoch: Eine unmittelbare, vom buchstäblichen Geklingel der Andeutungen unbehelligte Wahrnehmung, ein wenigstens erster freier Eindruck stellt sich kaum je ein. In den rhetorischen Spielchen spürt man die Absicht einer irgendwie gearteten "Dekonstruktion" und ist verstört, gehemmt, ja gelangweilt. Da hilft auch Czernins Nachwort nicht, das mit einer Umdeutung von Walter Benjamins "Engel der Geschichte" auftrumpft. Trotz oder gerade wegen ihrer technischen Brillanz zeigen diese Texte, dass sich die Methode auf Kosten der Substanz erschöpft hat. Sie sagen uns nichts Neues mehr. Das unterscheidet Czernins Lyrik und die seiner Mitstreiter von jener der Pioniere wie Eugen Gomringer, Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Denn, um es in Jandls Worten aus den siebziger Jahren zu sagen:
"In der Poesie ... brauchen wir alles, woran wir uns nicht gewöhnt haben; wir brauchen es, um Poesie überhaupt anfangen zu können, und wir brauchen es, um mit Poesie etwas anfangen zu können, etwas, das ein Beginnen ist ... und wir haben ein Wort dafür, das für uns außerordentlich wichtig und notwendig ist, das einfache Wort neu ...".
"In der Poesie ... brauchen wir alles, woran wir uns nicht gewöhnt haben; wir brauchen es, um Poesie überhaupt anfangen zu können, und wir brauchen es, um mit Poesie etwas anfangen zu können, etwas, das ein Beginnen ist ... und wir haben ein Wort dafür, das für uns außerordentlich wichtig und notwendig ist, das einfache Wort neu ...".
Franz Josef Czernin: "reisen, auch winterlich"
Gedichte.
Carl Hanser Verlag, München.
80 Seiten, 18.- Euro
Gedichte.
Carl Hanser Verlag, München.
80 Seiten, 18.- Euro