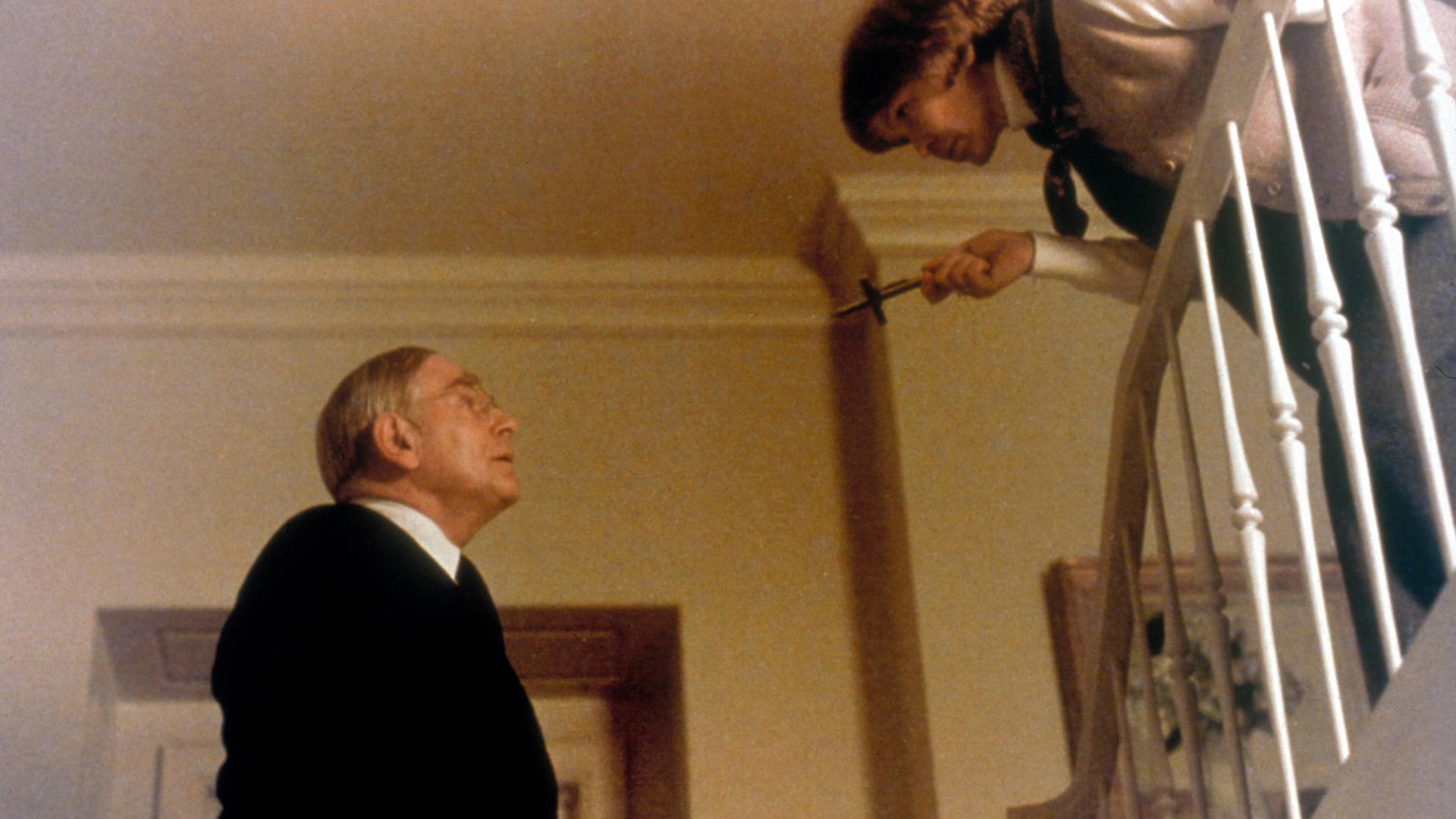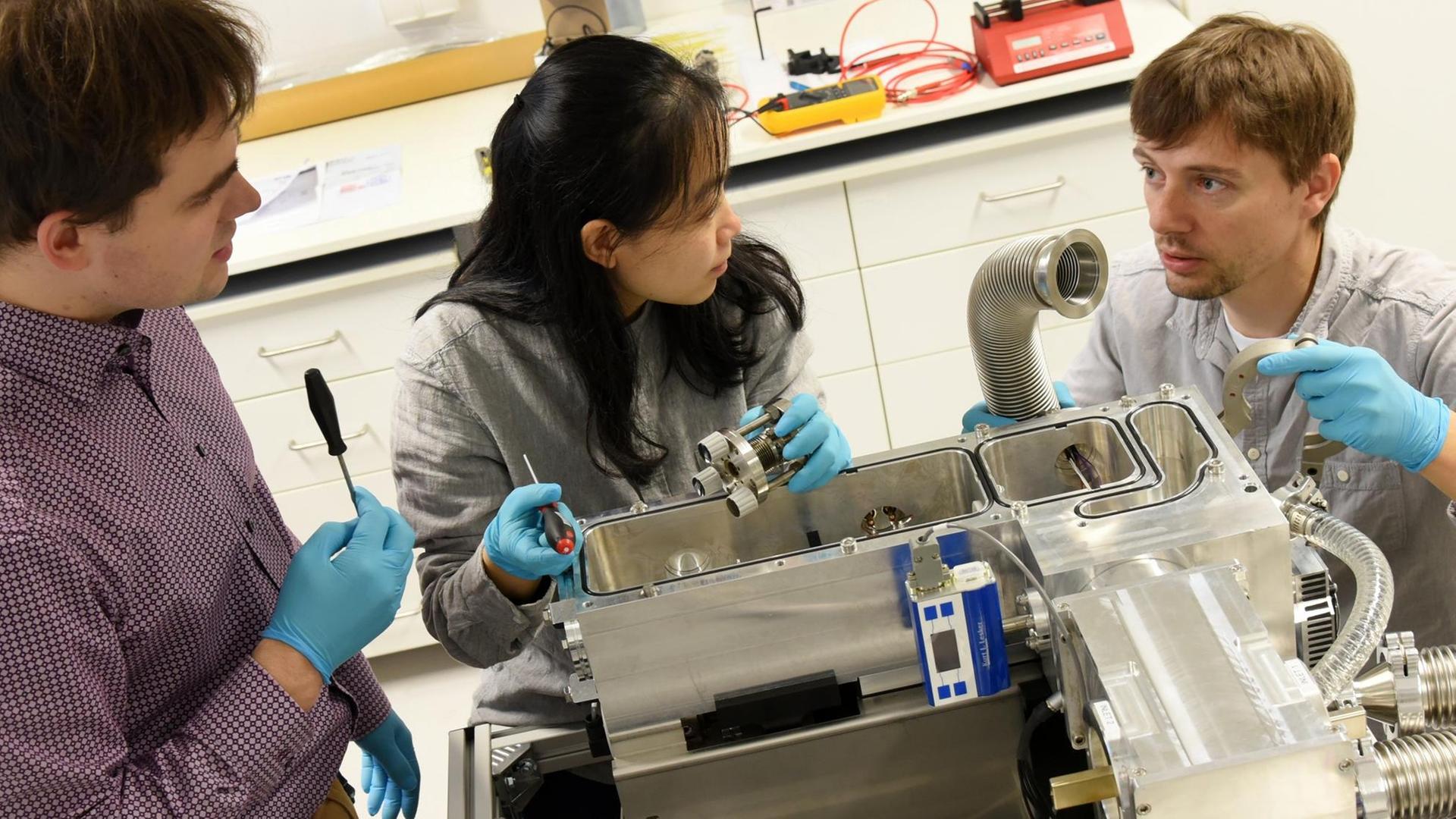Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Deutschland heftig darüber debattiert, ob Frauen studieren dürfen. Die ersten Hochschulzulassungen für Frauen hierzulande gab es 1900 in Baden. Im selben Jahr veröffentlichte der Neurologe und Psychiater Paul Julius Möbius einen Essay mit dem Titel: „Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes“.
Frauen, so behauptete Möbius, könnten gut Auswendiglernen. Selbständig Denken, Kombinieren oder Dinge erfinden, könnten Frauen aber nicht. Fazit: "Dass die Wissenschaften von den Weibern keine Bereicherung erwarten können, ist demnach begreiflich. Die wenigen weiblichen Gelehrten, deren Namen die Geschichte der letzten zwei Jahrtausende enthält, waren gute Schüler, nichts weiter.“
Frauen dürfen nicht an die Uni
Mit solchen Thesen stand Möbius nicht alleine da, sagt die Wissenschaftshistorikerin Prof. Annette Vogt vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Sie verweist auf das Gutachten „Die akademische Frau“, herausgegeben 1897 von Arthur Kirchhoff.
„Kirchhoff fragte die Professoren von Hamburg bis München: Sind Sie für das Frauenstudium? Da war die Mehrzahl dieser befragten Professoren aber immer noch die Meinung, die Unis müssen geschlossen bleiben, Frauen dürfen nicht rein.“
Vor allem Mediziner und Historiker lehnten die Zulassung von Frauen zum Studium strikt ab. Und das zu einem Zeitpunkt, als die allermeisten europäischen Universitäten für Frauen bereits geöffnet waren.
„Etwas Interessantes ist, dass es zumindest an der Berliner Universität bereits ab 1895 die Möglichkeit gab, für junge Frauen einen sogenannten Hörerinnenstatus wahrzunehmen. Sie durften also Vorlesungen besuchen. Das bedeutete, sie mussten den jeweiligen Professor fragen. Dieser Herr musste dann ja sagen, und ab 1899 durften sie mit Ausnahmegenehmigung promovieren.“
13-mal für den Nobelpreis nominiert
Eine der Frauen, die trotz aller Widerstände in Deutschland Karriere machte, war die Neurowissenschaftlerin Cécile Vogt. Die Autorin Dr. Birgit Kofler-Bettschart hörte ihren Namen zufällig auf einem europäischen Neurologenkongress und wurde neugierig.
„Da gibt es eine ‚Vogt-Erkrankung‘, die nach Cécile Vogt benannt ist. Und da habe ich mir gedacht: Das ist schon ungewöhnlich, dass diese Frau so früh so spannende Leistungen gebracht hat in der Hirnforschung - und in Vergessenheit geraten ist.“
Cécile Vogt, 1875 als Cécile Mugnier in Frankreich geboren, wurde 13-mal für den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin nominiert, bekam ihn aber nie zugesprochen. 1989 ehrte die deutsche Post sie mit einer Briefmarke. Trotzdem kennt heute kaum jemand ihren Namen - während ihr Mann, der Gehirnforscher Oskar Vogt immerhin im Brockhaus-Lexikon auftaucht. Birgit Kofler:
„Man spricht ja vom berühmten Matilda-Effekt.“ Benannt ist dieser Effekt nach der US-amerikanischen Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage, die Ende des 19. Jahrhunderts dieses Phänomen beschrieben hat. „Das heißt, wenn eine Forscherin und ein Forscher an einem bestimmten Projekt oder einem Ergebnis beteiligt sind, dann wird sozusagen die Leistung eher dem Mann zugeschrieben, vor allem von der Nachwelt.“
Entdeckerin der "Dysamnesie"
Cécile Vogt wurde 1900 in Paris zur Doktorin der Medizin promoviert. Schon da forschte sie zusammen mit ihrem Ehemann. Zuerst an der Universität Berlin, ab 1919 dann an dem von ihm gegründeten Neurobiologischen Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die Eheleute waren überzeugt, dass Veränderungen in der Hirnrinde bestimmte Verhaltensweisen oder Erkrankungen erklären.
„Und das war natürlich schon sehr fortschrittlich. Man konnte ja damals ins Gehirn noch nicht hineinschauen. Ein großes Interesse hatte Cécile aber auch immer sozusagen für die Psychologie und für die psychotherapeutische Arbeit. Und das war eine ihrer großen Arbeiten, mit denen sich beschäftigt hat, das so genannte Nicht-vergessen-können. Also sozusagen das Gegenteil von der Freudschen Verdrängung.“
„Dysamnesie“ – Menschen können ihre traumatisierenden Erlebnisse nicht vergessen. Ein Konzept, das in der Medizin bis heute Geltung hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Cécile Vogt von den männlichen Kollegen dafür ausgelacht, sagt Birgit Kofler.
„Weil es schwer aushaltbar war für manche Professoren in den Universitätsinstituten, dass sozusagen eine junge Frau im außeruniversitären Institut interessante neue Erkenntnisse publizierte, dass so mancher eingesessene Professor den Saal verlassen hat aus Protest gegen diese Zumutung.“
Akademikerinnen – plötzlich dringend gebraucht
Eine Widersprüchlichkeit, so die Berliner Wissenschaftshistorikerin Annette Vogt, die übrigens mit ihrer Namensvetterin Cécile nicht verwandt ist, gab es dabei. Trotz der strikten männlichen Ablehnung akademisch gebildeter Frauen wurden sie spätestens ab 1910 in Deutschland dringend gebraucht. Vor allem als Lehrerinnen an Mädchenschulen und in der Chemieindustrie.
„Die Chemieindustrie war ein wachsender Bereich, in Berlin in den 20er-Jahren promovierten die meisten Frauen in Chemie. Es gab gute Berufschancen in einigen staatlichen Reichsanstalten; biologische Reichsanstalt und ähnliches.“
An den Universitäten waren Karrierechancen für Frauen aber gering. Die erste Frau, die es schaffte, wissenschaftliche Assistentin zu werden, war die Physikerin Lise Meitner. 1912 wurde sie Mitarbeiterin von Max Planck.
„Und dann gibt es diesen ersten Schub im Ersten Weltkrieg. Die Männer sollen für Kaiser und Vaterland kämpfen, und an den Unis fehlen die Assistenten. Und sie haben also dann zwischen 1914, 1918 vergleichsweise viele Assistentinnen. Die werden aber sukzessive 1918, '19, '20 wieder rausgedrängt.“
Die Männer fordern ihre alten Positionen zurück
Die Männer, die den Krieg überlebt hatten, wollten zurück in ihren Beruf, auf ihre Positionen. Die Frauen mussten weichen. Cécile Vogt betraf das nicht. Seit 1919 war sie Abteilungsleiterin und wissenschaftliches Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Damit, so Birgit Kofler, war sie gleichgestellt mit den Institutsdirektoren. Eine anerkannte und tatsächlich bezahlte Wissenschaftlerin, und nicht mehr nur eine quasi Privatgelehrte am Privatinstitut. In den folgenden Jahren erhielt sie zahlreiche Ehrungen.
„Die ist 1932 in die Deutsche Akademie der Naturforscher zu Halle und in die Leopoldina aufgenommen worden. Das ist wahrscheinlich die höchste Ehrung, die dann im damaligen Deutschland möglich war. Unnötig zu sagen, auch da gab es kaum Frauen außer ihr.“

Hetze gegen Forscherpaare als „weiße Juden“
Nachdem in Deutschland 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, passte ihnen eine hoch geehrte Wissenschaftlerin genauso wenig ins Konzept wie ein Ehepaar, das gleichberechtigt wissenschaftlich forscht, sagt Birgit Kofler.
„In so nationalsozialistischen Hetz- und Kampfblättern werden die beiden auch immer wieder als sogenannte ‚weiße Juden‘ bezeichnet. Das war ein Propagandabegriff der Nazis, um Leute schlechtzumachen, die zum einen mit Juden, jüdischen Wissenschaftlern zusammengearbeitet haben und zum anderen aus der Perspektive der Nazis jüdische Gesinnung hatten.“
Cécile und Oskar Vogt verließen 1937 ihr angesehenes Institut in Berlin und gründeten ein neues privates Forschungsinstitut im Schwarzwald.
Die Mitmacher beherrschen weiter die Forschung
1948 wurde die Max-Planck-Gesellschaft Nachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die anerkannten Hirnforscher Cécile und Oskar Vogt wurden nicht gebeten, wieder dort zu arbeiten. Birgit Kofler: „Diejenigen, die nach 1937 an dem Hirnforschungsinstitut weitergearbeitet haben, und die im Geiste des Nationalsozialismus weitergearbeitet haben dort und auch an Verbrechen beteiligt waren, die gab es noch, die waren in der Szene immer noch vorhanden. Und hatten natürlich alle kein großes Interesse, dass die Vogts zurückkommen, weil das hätte vielleicht auch ein schlechtes Licht auf sie geworfen.“