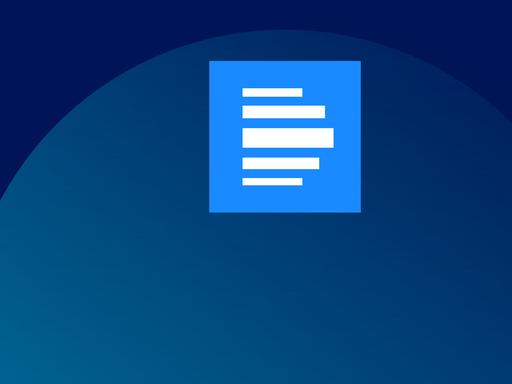Bei Geberkonferenzen treffen sich Vertreter von Staaten, internationalen Organisationen oder private Geldgeber, die in Krisenlagen Geld für verschiedene Hilfsmaßnahmen wie beispielsweise Erdbebenhilfe oder Wiederaufbauhilfe bereitstellen wollen.
Geberkonferenzen sind zu einem wichtigen Instrument der internationalen Zusammenarbeit geworden, insbesondere in den Bereichen Entwicklung – etwa für Bildung in Krisenregionen –, humanitäre Hilfe in Kriegs- und Krisenregionen wie in der Ukraine, im Sudan oder im Gazastreifen – und bei globalen Gesundheitsfragen wie der Coronapandemie.
Warum werden Geberkonferenzen einberufen?
Krisen erfordern so gut wie immer, dass die Staatengemeinschaft einander hilft. Das Büro zur Koordination humanitärer Hilfe der Vereinten Nationen, kurz OCHA, nennt 2023 als kritische Beispiele für die Weltlage etwa im Februar die Erdbeben in Syrien und in der Türkei, im April den Bürgerkrieg im Sudan. Außerdem den Krieg in der Ukraine, dann im Nahen Osten. Dazu komme der Klimawandel und seine dramatischen Folgen wie Dürren, Flutkatastrophen und Hunger. Nicht zu vergessen seien außerdem die „protracted crises“ – also Dauerkrisen wie in Afghanistan, in Myanmar, im Jemen oder in der Demokratischen Republik Kongo.
All diese Krisenherde haben eines gemeinsam: Allein werden die Staaten mit ihnen nicht fertig. Die Länder sind auf internationale Hilfe angewiesen. Deshalb gelten Geberkonferenzen als eines der wichtigsten Instrumente, um Hilfe zu generieren und zu verteilen.
Das OCHA liefert mit dem Global Humanitarian Overview auch den Überblick, wie viele Menschen weltweit humanitäre Hilfe brauchen – und wie viele diese Hilfe nicht bekommen werden – vor allem, weil es an Geld fehlt. Der Bericht gilt als Maßstab, wofür die internationale Gemeinschaft Hilfsgelder organisieren sollte.
Hilfe bei Naturkatastrophen und Pandemie
Im kommenden Jahr fehlt es demnach 300 Millionen Menschen am Nötigsten: an Wasser, Nahrung, Kleidung, medizinischer Versorgung, einem Dach über dem Kopf. Wenigstens 180 Millionen Menschen in mehr als 70 Ländern könnten theoretisch durch Projekte der Vereinten Nationen erreicht werden. Dafür aber müssten die Geber der Weltgemeinschaft für 2024 rund 46 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen. Eine große Summe, betont eine Sprecherin des OCHA. Aber deutlich geringer als beispielsweise der Jahresgewinn des US-Energieriesen Exxon Mobil alleine.
„Geberkonferenzen sind dringend erforderlich, leider“, sagt Udo Bullmann (SPD), der Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte im Europäischen Parlament. „Das liegt daran, dass die Anzahl der internationalen Krisen ständig steigt. Es ist eine gute Praxis, wenn Geberkonferenzen ausgerufen werden.“ Zunächst jedenfalls.
Welche Formen von Geberkonferenzen gibt es?
Etabliert sind klassische Geberkonferenzen. Sie gibt es entsprechend der verschiedenen Krisen auf der ganzen Welt in fast regelmäßiger Wiederkehr. So lud etwa Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Anfang November zu einer kurzfristig einberufenen Geberkonferenz zur humanitären Lage in Gaza. Anwesend waren unter anderem europäische Regierungen, Vertreter der EU-Kommission und Mohammed Schtajjeh, Ministerpräsident der palästinensischen Autonomiebehörde. Israel war an der Konferenz nicht beteiligt.
Macron ging mit dem Versprechen von 100 Millionen Euro voran, auszahlbar bis Ende des Jahres. Teil davon sind 20 Millionen Euro, die Frankreich schon zu Beginn des Nahost-Krieges in Aussicht gestellt hatte. Die EU-Kommission vervierfachte in Paris ihre Hilfe für Gaza auf insgesamt 100 Millionen. Doch viele andere Teilnehmerländer ziehen bei dieser Konferenz nicht mit. Die UN schätzen, dass im Gazastreifen humanitäre Hilfe im Umfang von einer Milliarde Euro und mehr nötig wäre.
„Kein einheitliches Format“
Generell gebe es „kein einheitliches Format“ bei den Konferenzen, sagt Christian Behrmann. Er arbeitet für die EU-Kommission im Bereich humanitärer Hilfe. „Der Charakter ist sehr ‚ad hoc‘, wird sehr von der ‚Ad-hoc‘-Situation getrieben und geleitet. Das ist der Natur der Dinge geschuldet.“
Ein weiteres Beispiel für eine Geberkonferenz: Afghanistan. Eine große Konferenz der UN gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich im März 2022 blieb allerdings massiv hinter den Erwartungen zurück. Mit Ausnahme von Katar spendeten reiche Ölstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate so gut wie nichts. So läuft es auf UN-Geberkonferenzen immer wieder – beispielsweise für den Jemen. Auch für das ostafrikanische Bürgerkriegsland Sudan kann der große humanitäre Bedarf nicht gedeckt werden – trotz großer Bemühungen einzelner Geber.
Langfristige Hilfe durch „Wiederauffüllungskonferenzen“
Ein anderes Modell stellen sogenannte Wiederauffüllungskonferenzen dar. Christoph Benn, Arzt und Direktor für Global Health Diplomacy am Joep Lange Institut in Amsterdam, hat für den „Global Fund“, einem weltweiten Fonds für die Bekämpfung von Aids, Malaria und Tuberkulose, diese Form der Krisenbewältigung ins Leben gerufen. Ziel ist es, langfristige Unterstützung sicherzustellen.
Diesen Konferenzen ging immer eine intensive und öffentlichkeitswirksame Vorbereitung durch Nichtregierungsorganisationen und auch Prominente voraus – der Druck der Zivilgesellschaft auf Staaten, private Spender und die Industrie war enorm. Auf der anderen Seite boten diese Konferenzen viel PR-Potenzial für die Geber.
„Man beschränkt sich nicht einfach darauf zu sagen, hey, wir brauchen so und so viel Geld, und jetzt warten wir mal, was die Regierung machen“, so Christoph Benn. „Sondern es wurde darauf hingearbeitet, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Konferenz zu organisieren und aber bis dahin alle Regierungen zu beeinflussen, damit sie möglichst großzügig dazu beitragen.“
Staaten wurden also gewissermaßen dazu konditioniert, regelmäßig zu spenden: Über 50 Milliarden Dollar konnten die regelmäßigen „Wiederauffüllungskonferenzen“ binnen weniger Jahre einsammeln. Viele andere Fonds übernehmen inzwischen dieses Modell regelmäßig: etwa die Impfstoff-Allianz Gavi, die Globale Bildungspartnerschaft oder auch der Green Climate Fund.
Der „Global Fund“
Die Wiederauffüllungskonferenzen sind Teil des „Global Fund“, den Benn vor 20 Jahren mitaufgebaut hat. Der globale Fonds für die Bekämpfung von Aids, Malaria und Tuberkulose dient der Finanzierung nationaler Maßnahmen gegen die drei Krankheiten und soll die Gesundheitssysteme weltweit stärken. Finanziert wird der Fonds besonders von Geldern der Gates-Stiftung, regelmäßig wirbt er jedoch auch große Spenden von Staaten und anderen privaten Organisationen ein. Der Fonds gilt als Beispiel für das Schmieden erfolgreicher Partnerschaften zwischen Staaten und dem privaten Sektor im Gesundheitsbereich.
Eine denkwürdige Geberkonferenz war die EU-Covid-Geberkonferenz: eine Spendengala und ein dreistündiger Telemarathon. Regierungen, internationale Organisationen und private Stiftungen waren aufgerufen, Geld für die Entwicklung von Corona-Impfstoffen, für Medikamente und Testmaterial zur Verfügung zu stellen. Am Ende kamen 7,4 Milliarden Euro zusammen. 40 Länder und viele Organisationen waren mit großen Summen dabei. Aber auch private Spender wie die Bill und Melinda Gates-Stiftung – was die Kritik einbrachte, in einer globalen Pandemie zu abhängig von Privaten zu sein. Regierungen wie die USA und China waren auf der anderen Seite nicht vertreten und haben auch nicht gespendet.
Was sind die Ziele von Geberkonferenzen?
Übergeordnetes Ziel aller Konferenzen ist es, in Krisenfällen Hilfe zu leisten. Und: „Geberkonferenzen leisten einen wichtigen Beitrag, um Länder auf internationaler Ebene überhaupt miteinander in den Austausch zu bringen“, sagt der Bonner Politologe Stephan Klingebiel von der entwicklungspolitischen Denkfabrik German Institute of Development and Sustainability. Andere Stichworte, wenn es um Ziele geht, sind: Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit schaffen.
Wichtig ist auch das Setzen von politischen Signalen, etwa im Falle von Macrons Gaza-Geber-Initiative, sagt Klingebiel. Der Gedanke dahinter sei für die potenziellen Geber: „Lässt man das zu, dass die internationale Gemeinschaft humanitär nicht reagiert oder völlig unzureichend reagiert – oder lässt man es nicht zu.“ Dennoch beginnen hier auch die Probleme und die Kritik an Konzept und besonders der Praxis von Geberkonferenzen.
Welche Probleme und welche Kritik sind mit den Geberkonferenzen verbunden?
Politologe Klingebiel gibt zu bedenken, dass der Mechanismus von Geberkonferenzen dazu führen kann, dass die Aufmerksamkeit für eine Krise die Wahrnehmung einer anderen verdeckt. Zudem: Hilfe sei zwar im Prinzip unparteiisch, aber trotzdem immer politisch, also nie frei von Strategien und Interessen aufseiten der Geber.
Eine andere große Frage ist: Halten die Geber tatsächlich ein, was sie versprochen haben? Zwar erfassen die Vereinten Nationen die Beiträge der Geber im sogenannten FTS, dem Financial Tracking System: Dort werden alle Zusagen aufgelistet, die von Regierungen, UN-Organisationen, UN-Fonds, Nichtregierungsorganisationen, dem Internationalen Roten Kreuz und dem Roten Halbmond geleistet werden. Doch Transparenz als solche ist noch keine Lösung für das Grundproblem. Denn es passiert allzu häufig, dass die Geber sich nicht an das halten, was sie versprechen. Die Lücke zwischen zugesagter und tatsächlich geleisteter finanzieller Hilfe ist groß – und sie droht bestehen zu bleiben, solange das gesamte System – ein weiteres Problem – auf Freiwilligkeit basiert.
Hilfsgelder: Wie valide sind Zusagen?
Simone Pott, Sprecherin der Deutschen Welthungerhilfe, ergänzt: „Zu bestimmten Zeiten waren die Zusagen auf einer Syrien-Konferenz oder einer Afghanistan-Konferenz hoch; die Frage ist aber am Ende, wie valide ist das, was da kommt. Und: Ist es zusätzliches Geld, oder ist es Geld, das sowieso schon versprochen war? Dann kriegt das Geld nur einen anderen Aufkleber, aber das ist keine Geldvermehrung.“
Knappe und oft umgewidmete Ressourcen sind für die Hilfsorganisationen wie die Welthungerhilfe, die die Hilfszusagen ganz konkret umsetzen müssen, oft ein großes Problem – das noch größere ist, mit diesen Mitteln dann auch in Ländern Hilfe zu leisten, in denen die politische Führung die humanitäre Krise selbst massiv beschleunigt wie im Fall der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan 2021. Die Übernahme führte für Afghanistan zu einer „donor drought“, zu einer Spendendürre.
Dass der Bedarf an humanitärer Hilfe in vielen Kriegs- und Krisenregionen nicht gedeckt werden kann, dafür hat Christian Behrmann von der EU-Kommission eine ernüchternde Erklärung: Fast 90 Prozent der Hilfe weltweit werde durch maximal fünf große Geber geleistet: die USA, die EU-Kommission, Deutschland, Schweden und die Niederlande. Wichtige Beiträge kämen auch von Großbritannien und Frankreich. Danach aber werde es schon dünn, sagt Behrmann. „Deswegen ist es uns ein großes Anliegen, diese Donor Base, diese Gebergrundlage zu vertiefen und zu verbreitern. Diese Geberkonferenzen sind auch eine Möglichkeit, andere Länder mit einzubeziehen in dieses Gespräch, um ihnen Sichtbarkeit zu geben und klarzumachen, wir sitzen alle in einem Boot.“
Deshalb müssten nicht nur die Staaten der G7 mehr Geld geben, sondern auch reiche Staaten der G20 und in der OECD. Beispiel Corona-Pandemie: Auch in dieser globalen Gesundheitskrise zeigten sich die problematischen Muster von Geberkonferenzen: zu wenige Geber, freiwillige Spenden. Dazu kam in dem Fall noch die Abhängigkeit von privaten Unternehmen und der Pharmaindustrie.
Ein weiteres großes Problem: Die völlig unzureichende Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation. Dadurch hätten zum Beispiel die Pharmakonzerne während der Impfstoffentwicklung der WHO ihre Bedingungen diktieren können, sagt Anne Jung, Gesundheitsreferentin der Menschenrechtsorganisation medico international.
Gibt es Alternativen, um nachhaltiger auf Krisen reagieren zu können?
Man kann die Frage stellen, ob die sogenannten Wiederauffüllungskonferenzen des „Global Fund“ ein Modell für eine Art Geberkonferenz 2.0 zur Linderung der Großkrisen auf der Welt sind. Für Gründer Christoph Benn zumindest bedenkenswert. „Die Politiker ermüden, wenn sie alle paar Monate auf eine neue Krise reagieren sollen. Wäre es nicht viel besser, man hätte eine Art globalen Krisenfonds, in den zahlen die Geber regelmäßig ein. Dann hätte man das Geld, wenn eine Krise irgendwo passiert.“
Anne Jung von medico international ist skeptisch: Auch bei diesem Modell diktierten freiwillige Zusagen von Regierungen und Industrie das Ergebnis, außerdem bekämpfe man weiter nur Symptome – und nicht die Ursachen von Krisen. Wenn überhaupt, müsse man über einen verpflichtenden, staatlich kontrollierten Fonds nachdenken.
Mit gestaffelten Beiträgen je nach Wirtschaftsleistung eines Landes. „Mit solchen Summen könnte man schnell auch in akuten Gesundheitskrisen eingreifen. Das betrifft nicht nur Pandemien, das können auch Gesundheitskrisen sein, wie wir sie derzeit erleben in Folge von bewaffneten Konflikten, wenn Krankenhäuser zerstört werden und vieles mehr. Dadurch, dass es öffentliche Mittel sind, die auch demokratisch gesteuert veräußert werden können, wäre die Struktur aufgehoben, dass Länder fast schon um diese Mittel betteln müssen.“
Alexander Göbel, aha