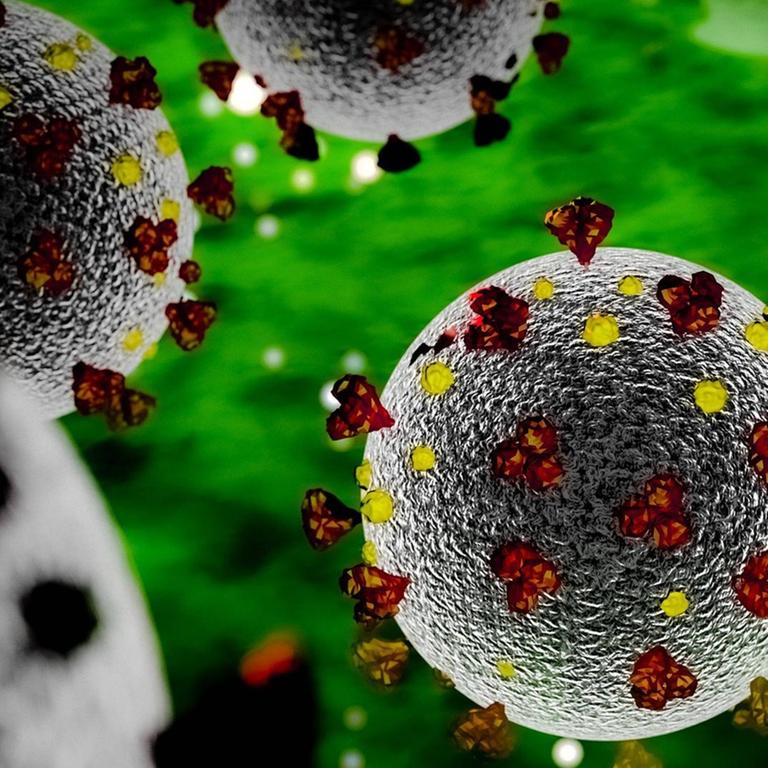Er war Lehrer an einer Gemeinschaftsschule in Berlin. 39 Jahre alt. Kolleginnen und Kollegen hatten den Eindruck, nichts und niemand könne ihn umhauen. Dann infizierte er sich mit dem Corona-Virus, kam binnen weniger Tage auf die Intensivstation, und starb kurz vor Weihnachten. Seine Geschichte und sein Foto finden sich auf einer Erinnerungsseite für Corona-Tote im Netz.
"Jeden Tag hören wir von Menschen, die sterben, und das ist natürlich furchtbar. Das sind ja nicht nur Zahlen, Statistiken und Kurven, die wir uns da anschauen. Sondern es sind ja immer Menschen, die da dahinterstehen." Sagt Eva-Maria Will. Sie ist Referentin für Trauerpastoral im Erzbistum Köln. Mit dem Tod gehen starke Gefühle einher, sagt die katholische Theologin: Trauer, Wut, Schmerz.
"Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und das beiseiteschieben und versuchen, das in den Griff zu kriegen. Sondern dass wir sagen, wir müssen innehalten. Und es ist gut, dass wir uns als Gesellschaft diese Zeit nehmen. Damit eine Gesellschaft nicht dauerhaft krank wird, ist es wichtig, eine zentrale Trauerfeier zu halten."
Sterben, Tod, Schuld - verdrängte Themen
Deutschland und die Welt sind noch mitten in der Krise. Da ist es naheliegend, vor allem daran zu denken, wie man selbst gesund bleibt. Wie den Kranken geholfen werden kann. Und wie sich das Virus besiegen lässt. Darüber können die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie leicht aus dem Blick geraten. Konkret, was es bedeutet, dass so viele sterben. Nun plant Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. April eine zentrale Gedenkfeier in Berlin. Daran soll die gesamte Staatsspitze teilnehmen. Zugleich soll es regionale Feiern geben.
Fachleute begrüßen diese Form des kollektiven Gedenkens. Bei früheren Katastrophen sei das immer wieder versäumt worden. Als Folge sei noch vor wenigen Jahrzehnten die offen zur Schau gestellte Trauer hierzulande ein Tabu gewesen, sagt die Theologin Eva-Maria Will: "Das hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, das ist eine Langzeitfolge davon. Weil sich mit dem Krieg natürlich Gefühle von Scham und Schuld verbunden haben, die ganz stark in der Gesellschaft vorhanden sind. Und gerade ja die Älteren versucht haben, dieses Thema von Sterben, Tod, Schuld, und alles, was sich damit verbindet, auch zu verdrängen, nicht an sich heranzulassen."
Der Tod als gesellschaftliches Tabu – das treibt auch die evangelische Theologin Petra Bahr um. Sie ist Regionalbischöfin in Hannover und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Corona sei eine kollektive Katastrophe, aber die Tode würden immer noch wie individuelle Schicksalsschläge behandelt, sagt Bahr: "Das ist deswegen für mich als Ethikerin auch so verstörend, weil man das in den letzten Pandemien auch genauso beobachten kann. Also bei der Spanischen Grippe ist es so: Es gibt fast nirgendwo Mahnmale, die an die Millionen Toten erinnern. Es wurden ja ganze Landstriche ausgerottet."
Die vergessenen Opfer der Spanischen Grippe
Die Spanische Grippe dauerte von 1918 bis 1920. Deren Opfer seien oft einfach aus dem Dorf- oder Familiengedächtnis verschwunden, so die Regionalbischöfin. Das soll sich nicht wiederholen. Deshalb denken manche in Politik und Kirchen schon seit geraumer Zeit über Ausdrucksformen kollektiver Trauer nach. Holger Zaborowski, Philosophie-Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, sagte dazu vor einigen Monaten im Deutschlandfunk: "Wir wissen, dass bestimmte Entscheidungen dazu geführt haben, – Entscheidungen, die politisch getroffen wurden, die auch richtig waren –, dass zum Beispiel Menschen einsam gestorben sind. Das sind vielfach Dilemma-Situationen gewesen. Oder wenn Sie an die Kollateralschäden der Krise und der Maßnahmen, die man gegen das Coronavirus ergriffen hat, denken. Ich glaube, dass es da sehr wichtig ist, eine gesellschaftliche Form des Andenkens und der Erinnerung zu finden. Und damit auch den Opfern Respekt zu zollen, und damit auch diese Krise und die Erinnerung daran lebendig zu halten."
Das könne auch ein Denkmal sein für die Menschen, die sich eingesetzt haben. Oder als Verweis darauf, wie die Gesellschaft mit dieser Krise umgegangen ist, so der Philosophie-Professor. "Es geht ja auch vielleicht in diesem Zusammenhang darum, den Blick über die nationalen Grenzen hinauszuwagen und zu sehen, die Pandemie hat für uns eine europäische, aber auch eine globale Dimension. Darum geht es: zu fragen, wie kann man hier etwas erinnern? Denken Sie an die vielen Formen von Solidarität, die entstanden sind. Wie kann man das bewahren? Wie kann man auch die Menschen, die Leid erfahren haben, die Menschen, die gestorben sind, die Menschen, die chronisch krank bleiben nach einer Infektion, wie kann man dieses auch erinnern?"
Was angeschaut werden kann, kann geheilt werden
Eva-Maria Will, Referentin für Trauerpastoral und Bestattungskultur im Erzbistum Köln, erklärt: Öffentliche Symbole könnten helfen, dass die Gesellschaft im umfassenden Sinne wieder gesund wird, wenn die Pandemie einmal vorüber ist. "Ich denke, dass das auf die Dauer sehr schädlich sein kann oder krank machen kann, wenn wir sagen, wir verdrängen das und wir schieben das beiseite. Wir machen es klein und sagen, Augen zu und durch, wir lassen es nicht an uns heran. Das wird uns irgendwann wieder einholen. Es heißt ja auch: Nur was angeschaut werden kann, kann geheilt werden. Innezuhalten, um damit auch fertig zu werden."
Es gibt bewährte Rituale nach Katastrophen mit vielen Toten, seien es Erdbeben, Tsunamis, Flugzeugabstürze, Zugunglücke. Das können staatliche Gedenkfeiern sein oder Gottesdienste in Kirchen. Es kann trösten, in Gemeinschaft eng beieinander zu stehen, sich in den Arm zu nehmen. Vieles davon ist ausgeschlossen, solange das Virus zirkuliert. Dies wird auch den geplanten Gedenktag im April erschweren. Aber kollektive Trauer lässt sich auch anders ausdrücken: In Form einer Musik-Komposition. Oder durch ein Kunstwerk im öffentlichen Raum. Eva-Maria Will: "Weil der Mensch Orte braucht, an denen er sich festmachen kann. An die er hingehen kann und mit denen er auch etwas verbindet. Deswegen gehen ja ganz viele Trauernde regelmäßig an das Grab. Andere haben sich eine Ecke in ihrer Wohnung eingerichtet, wo sie ein Bild stehen haben, frische Blumen hinstellen, eine Kerze anzünden. Das hilft, die Trauer zu verorten."
Digitale Trauercafés und Instagram-Initiativen
Die evangelische Kirchengemeinde Sankt Andreas in Hamburg hat einen solchen Ort eingerichtet: eine Kapelle, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche offensteht. Auf einer Tafel finden sich die Namen von Corona-Toten. Andernorts bieten Seelsorgerinnen und Seelsorger digitale Trauercafés an oder starten Gedenk-Initiativen auf Instagram – mit Kurzbiografien der Verstorbenen. Um die Trauer ins öffentliche Bewusstsein zu holen, könnten auch sogenannte ‚geprägte Zeiten‘ dienen wie die beginnende Fastenzeit, sagt die Theologin Eva-Maria Will.
"Es geht ja nicht nur darum, in die Vergangenheit zu blicken, sondern auch immer das aktuelle Leiden der Menschen miteinzubeziehen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Jugendkreuzweg die Pandemie mit einbezieht. Die wollen die Passionsspiele von Oberammergau in den Mittelpunkt rücken, wollen da hinter die Kulissen gucken und den jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich besonders mit Sterben, Tod und Trauer intensiv auseinanderzusetzen."
Kennzeichnend für die Pandemie ist der einsame Tod – und die Beerdigung im kleinen Kreis, weil größere Feiern meist nicht möglich sind. Deshalb setzt Eva-Maria Will auf den Contra-Punkt des öffentlichen Gedenkens.
"Wenn man bedenkt, dass jeder Mensch ein soziales Wesen ist, der im Beruf gestanden hat und Freunde gehabt hat, Arbeitskollegen, dann ist es auch gut, wenn das entsprechend gewürdigt wird."