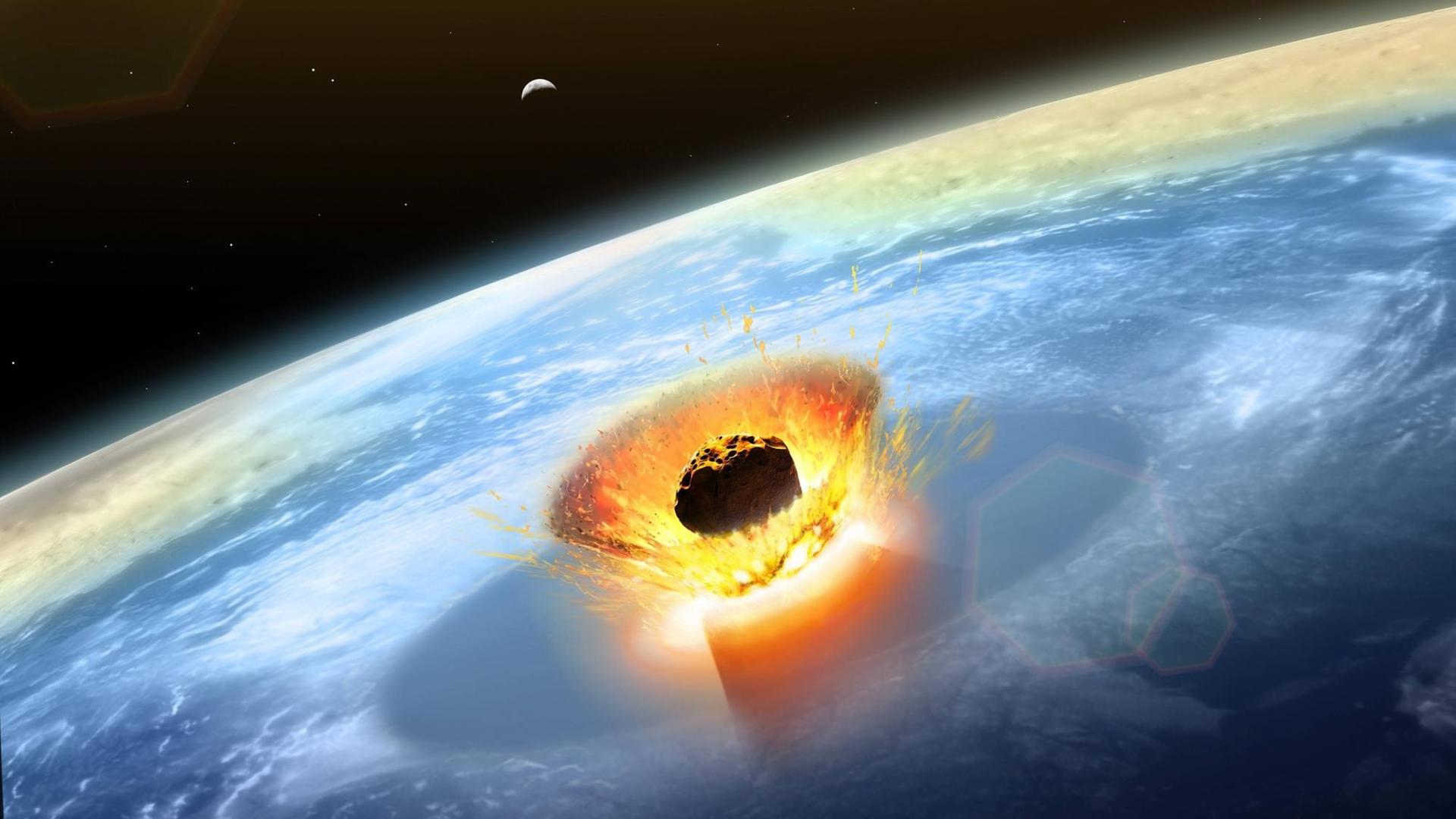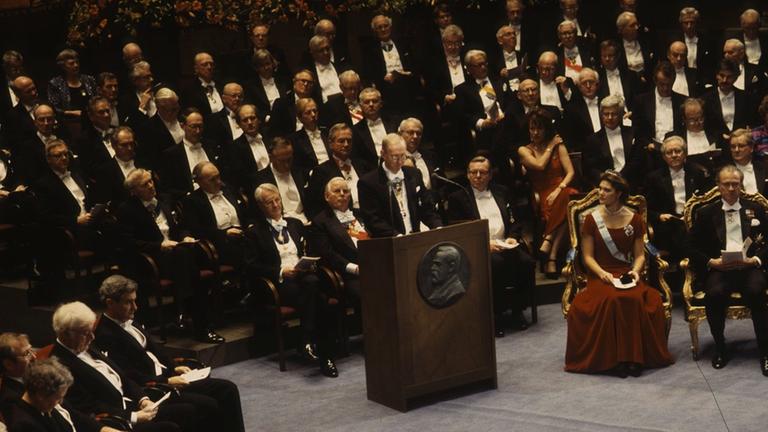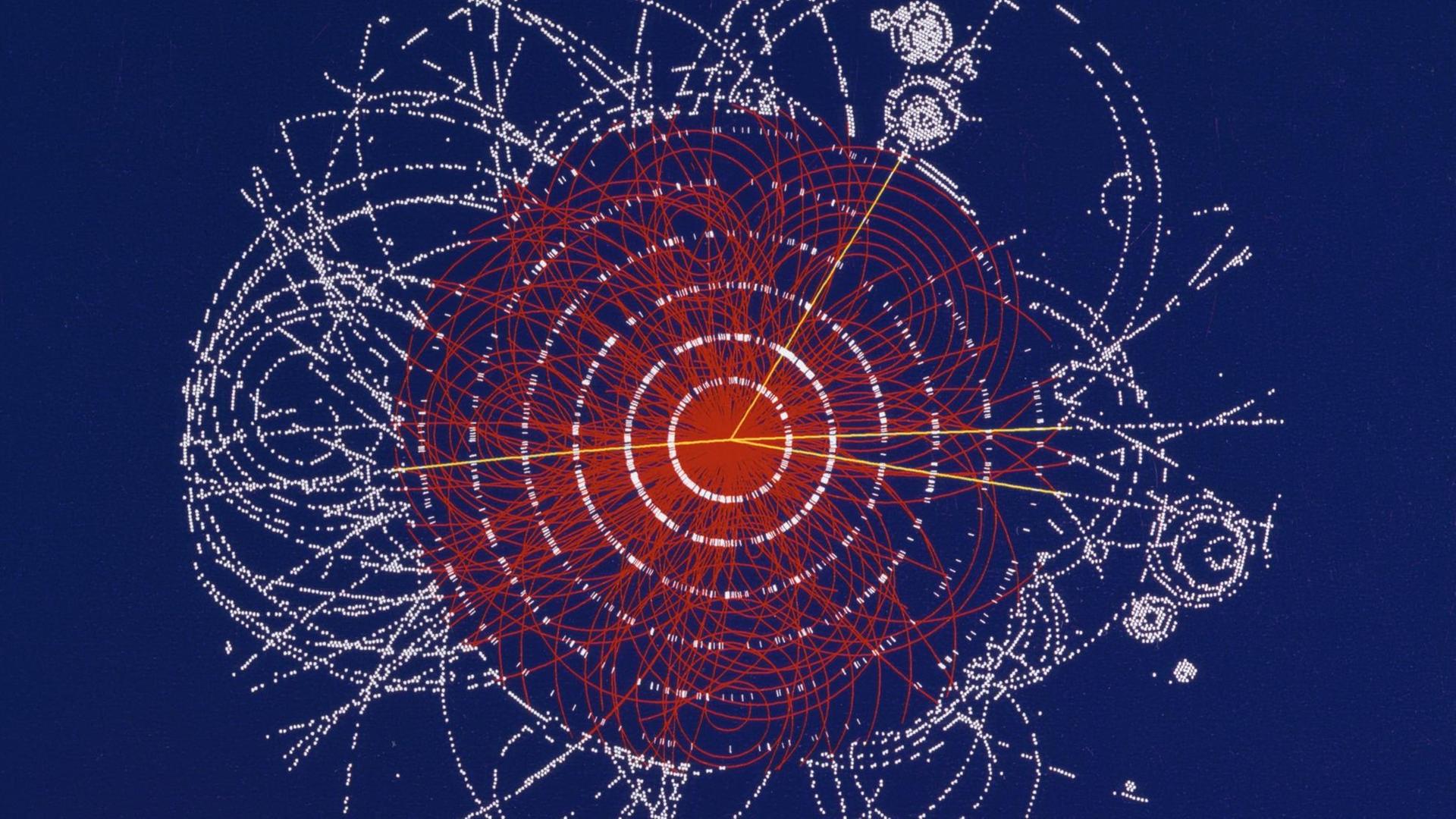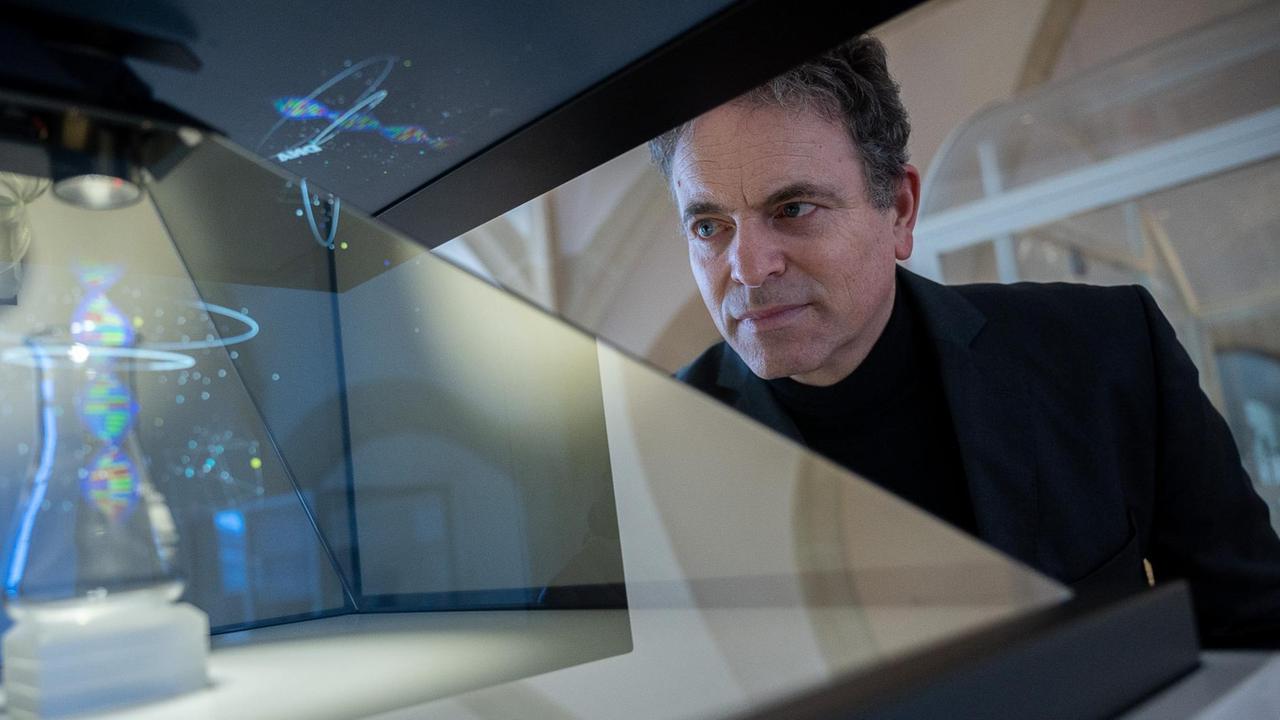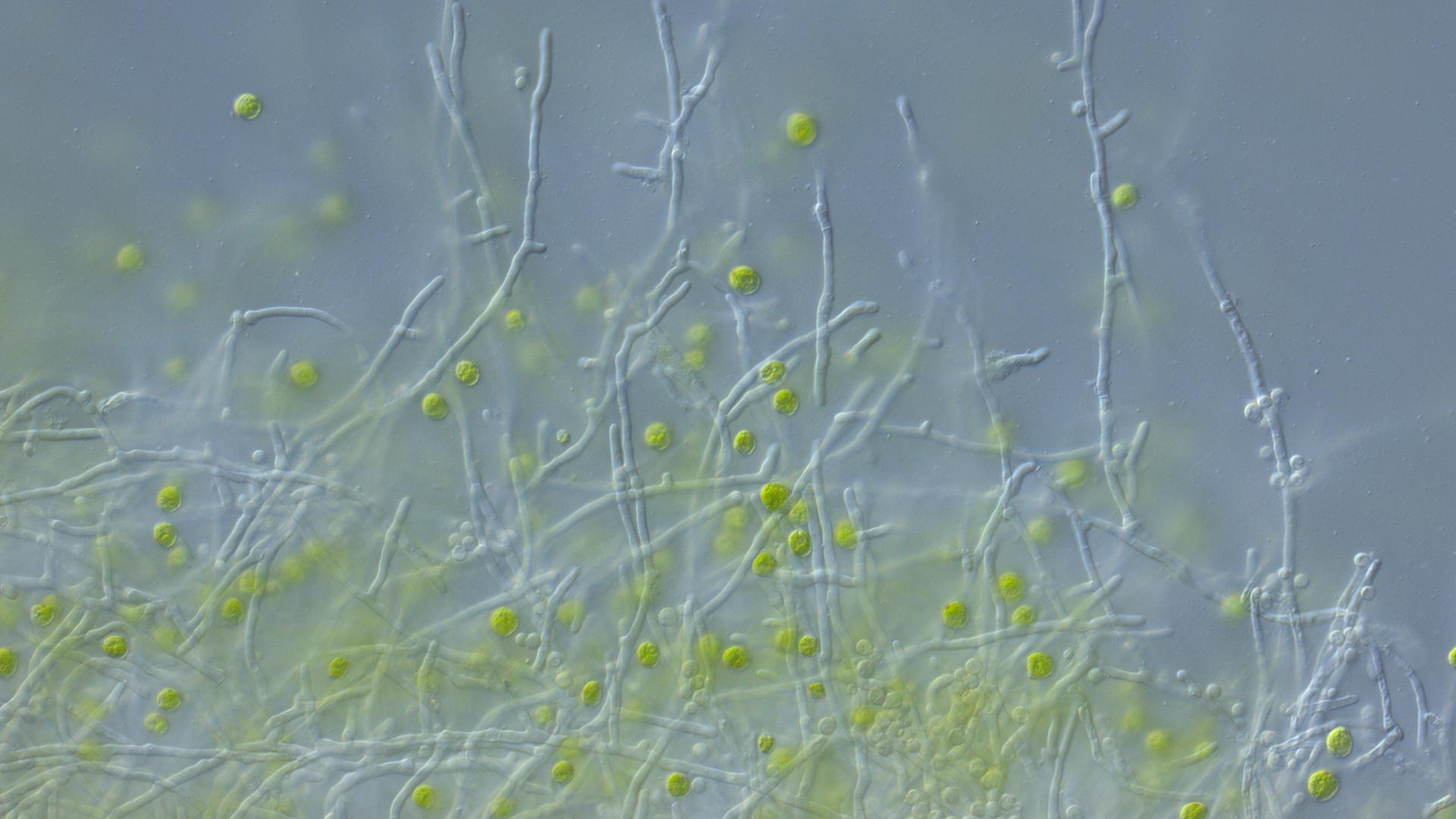Bulgarien, Mitte der 1990er Jahre. Eine Gruppe Wissenschaftler beginnt ein Projekt, in dem sie so viele genetische Daten von Roma sammeln will wie möglich. In Bulgarien leben damals viele Roma in isolierten Dörfern, in die kaum einmal jemand von außen hineinheiratete. Im Jahr 2014 schreiben die bulgarischen Forscherinnen und Forscher über ihr Projekt, sie hätten 97 Prozent aller Einwohner dieser Siedlungen dazu bewegen können, eine DNA-Probe abzugeben, sagt Veronika Lipphardt von der Universität Freiburg:
„Das sind unglaublich viele, das ist beeindruckend deutlich, und man hat auf der Grundlage dann Dutzende von Forschungspapers verfasst, in denen man zeigen wollte, dass Roma ganz bestimmte Krankheiten viel stärker akkumulieren als andere, also genetische Krankheiten zum Beispiel.“
These: Aus Indien eingewanderte, homogene Gruppe
Neben diesen medizinischen Fragen interessiert die Populationsgeschichte der Roma. Seit dem späten 18. Jahrhundert haben Linguisten und Völkerkundler ein Bild entworfen, nach dem die Roma eine Gruppe seien, die aus Indien nach Europa eingewandert sei und sich hier als homogene Gemeinschaft erhalten habe.
Das Konzept „Rasse“ – Man sieht es doch! Was sieht man?
Bulgarien – Die tragische Komödie der Roma-Integration
Genkarte von Estland
Bulgarien – Die tragische Komödie der Roma-Integration
Genkarte von Estland
Die bulgarischen Genetiker kombinierten ihre Erkenntnisse mit Daten von isolierten Roma-Gruppen aus anderen europäischen Ländern. Ihre Publikation bestätigt das Bild von der homogenen Gruppe. Zumindest scheinbar.
„Was man dann also geschrieben hat: Alle europäischen Roma stammen von fünf kleinen Gründungspopulationen sozusagen, die auf diese indische Gruppe zurückgehen. Und man hat im Prinzip die Akkumulation von bestimmten genetischen Varianten, die man in diesen kleinen abgeschlossenen Communities gefunden hat, extrapoliert auf alle europäischen Roma. Und europäische Roma als eine ‚Genetic High Risk Group‘ bezeichnet.“
Bezeichnung „Roma“ ist vielfach nur Zuschreibung
In den meisten Regionen Europas leben Roma gar nicht in solchen abgeschlossenen Siedlungen. Die bulgarischen Genetiker haben also eine Betrachtungsweise mit unrühmlicher Tradition übernommen und auf die Spitze getrieben, sagt Veronika Lipphardt:
„Das ist eine Imagination. In den Geschichtswissenschaften sagt man auch: Das ist eine ‚Imagined Community‘ – aber eine, die nicht von sich selbst imaginiert wird, sondern von den anderen. Eigentlich alle europäischen Staaten nennen sehr viel mehr Menschen Roma, als sich selbst Roma nennen würden, jeder Versuch, diese Gruppe auf einen Nenner zu bringen, ist eigentlich von vornherein gescheitert. Ich habe diesen gemeinsamen Nenner jedenfalls nirgendwo gefunden.“
Und doch suchten sich Forscher immer wieder einen solchen Nenner. Und wenn ihnen die Auswahl der Studienteilnehmer nicht gefiel, halfen sie bei der Analyse nach.
„Im Labor ist es so, dass die Forscher dann oft rausfinden, dass jemand, der gesagt hat, seine vier Großeltern sind Roma, offensichtlich nicht die Wahrheit über seine Großeltern wusste, denn im Labor sehen diese Daten so europäisch aus für die Genetiker. Diese Proben werden auch aus dem Sample entfernt, weil sie zu europäisch aussehen.“
Datenmanipulation und fehlende Einwilligungserklärung
Die Ergebnisse solcher Studien enthalten also von vornherein eine Verzerrung, einen sogenannten Bias. Und eine unzulässige Verallgemeinerung: „Das wäre ein bisschen so, wie wenn Sie sagen: Ja, in der Schweiz, die Bergdörfer da oben, die akkumulieren ja auch alle möglichen genetischen Krankheiten, jetzt können wir was über die Schweizer Bevölkerung aussagen.“
450 Publikationen aus den letzten 100 Jahren hat sich das Freiburger Team angeschaut. Bei vielen gibt es zusätzlich ein wissenschafts-ethisches Problem: Heutzutage müssen Forscher genau belegen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Studien der Verwendung ihrer genetischen Daten zustimmen. So eine Dokumentation fehlt bei vielen Studien mit Roma-Daten.
„In den 80er Jahren haben wir noch Studien gefunden, wo man das einfach in Gefängnissen machen konnte, also die forensischen Genetiker, die das gemacht haben, einfach in Gefängnisse gegangen. Da kann mir keiner erzählen, dass die Leute freiwillig und mit informierter Einwilligungserklärung teilgenommen haben. Wir haben eine Publikation von 1992 gefunden, in der ein bulgarischer Genetiker und ein ungarischer Genetiker schreiben, dass ‚informed consent‘ in den kommunistischen Staaten komplett unüblich war und dass das auch nicht zu der Doktor-Patienten-Beziehung passen würde, die man in diesen Staaten hatte.“
Nutzung der DNA-Daten müsste eigentlich neu legitimiert werden
Und doch sind die Gen-Daten von Roma in verschiedene europäische Gendatenbanken eingeflossen, aus denen sich bis heute nicht nur Forscher, sondern auch Polizei und Justiz bedienen. Für die Wissenschaftshistorikerin Lipphardt können die Daten dort nicht ohne Weiteres einfach bleiben.
„Löschen und neue Daten aufnehmen wäre die eine Lösung, und die andere Lösung wäre, dass man tatsächlich die Leute kontaktiert – das müssten die Leute machen, die die Sammlung gemacht haben, dass man die kontaktiert und wirklich jeden Einzelnen befragt, ob das in Ordnung ist, die Daten so zu nutzen, wie sie heute genutzt werden. Es sind beides aufwendige Schritte. Ich verstehe, dass das keine einfache Entscheidung ist, aber ich finde, dass man das den Probanden oder den Teilnehmern einfach schuldig ist.“
Und man muss Menschen, die ihre DNA-Daten für eine Studie zur Verfügung stellen, die Möglichkeit geben, der Verwendung bei künftigen Studien zu widersprechen. Schließlich kann heute niemand sagen, was in 30 Jahren technisch möglich sein wird.
„Es gibt Konzepte dafür, wie Probanden oder Teilnehmer ihre Daten für jede einzelne Studie freigeben können. Also mit einer App auf dem Handy sagen können, an der Studie nehme ich nicht teil. Oder ja, an der Studie nehme ich teil. Und je nachdem, wird die DNA verwendet oder nicht.“