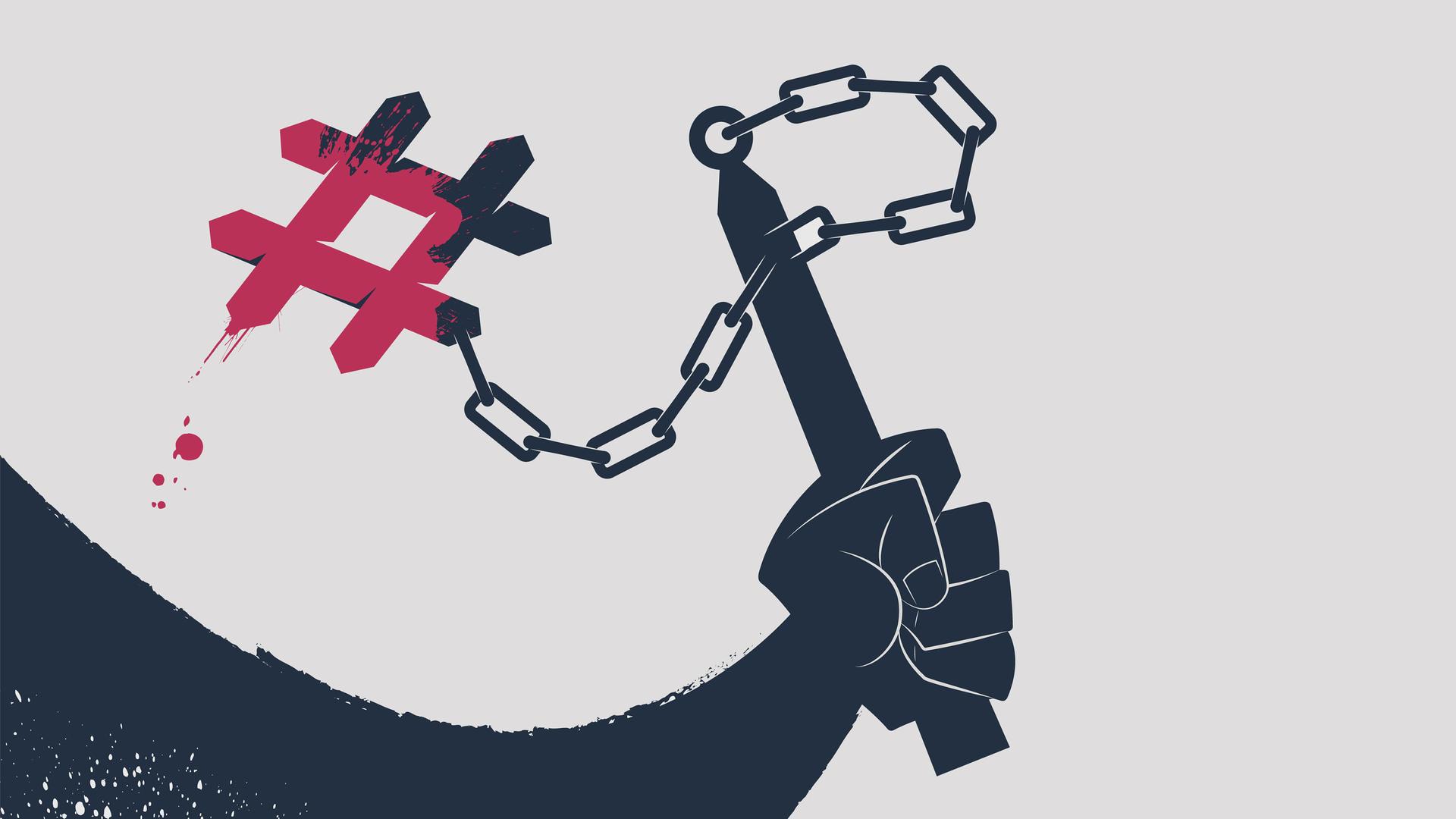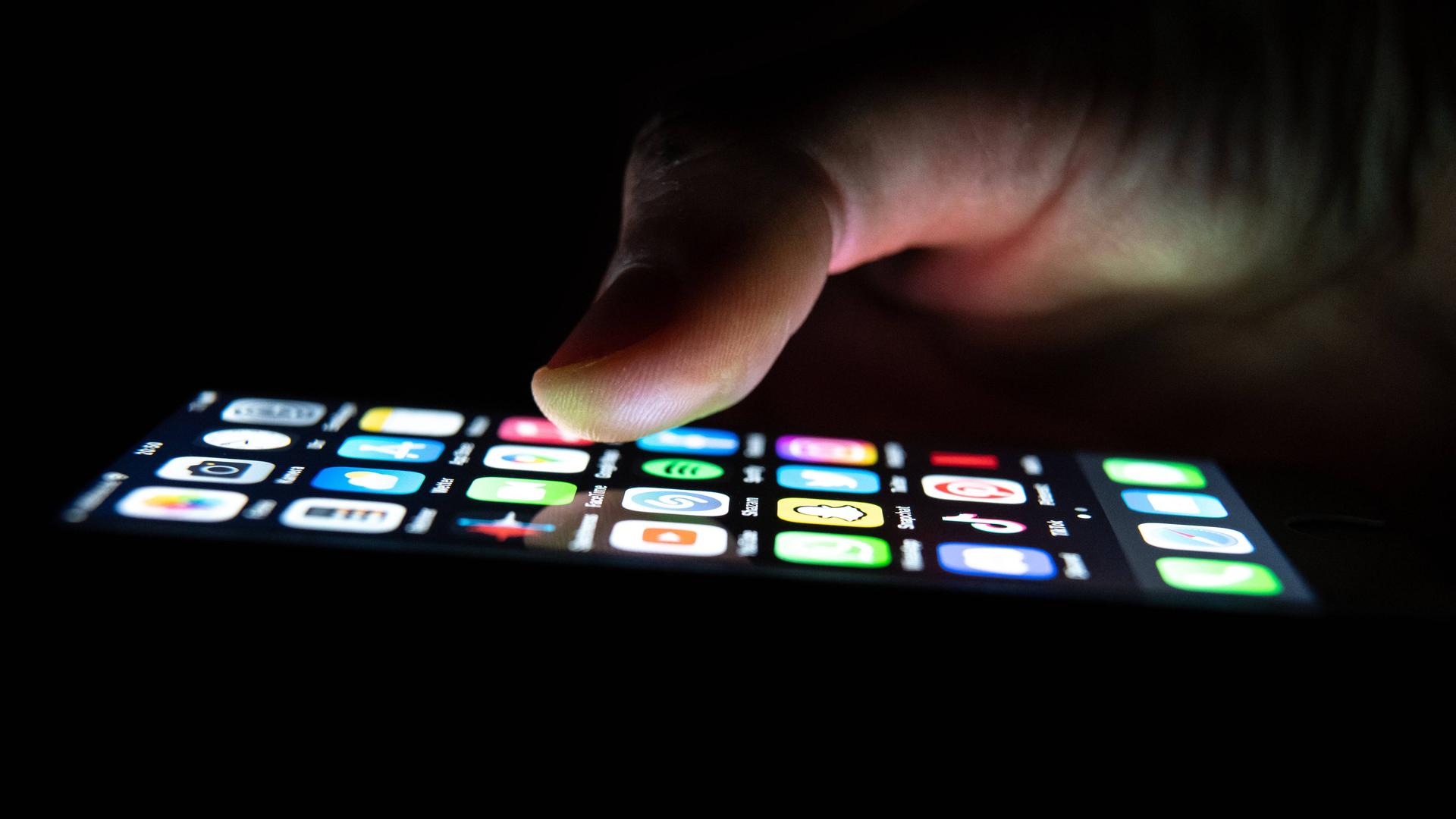
Betroffene von Rufmord, Beleidigung oder Bedrohungen im Internet, von digitalem Stalking und Belästigung sollen sich künftig leichter zur Wehr setzen können. Das Bundesjustizministerium veröffentlichte dazu am 12. April 2023 die Eckpunkte zu einem „Gesetz gegen digitale Gewalt“.
Was plant die Bundesregierung mit dem „Gesetz gegen digitale Gewalt“?
Wer im Internet beleidigt, bedroht oder verleumdet wird, soll künftig leichter die IP-Adressen der Urheber erhalten können, um gegebenenfalls zivilrechtlich dagegen vorzugehen. Betroffene sollen laut dem Eckpunkte-Papier „unter gewissen Voraussetzungen“ per Gericht eine Sperre von Social-Media-Konten erwirken können. Dies soll bei „schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen“ möglich sein – und vor allem dann, wenn „Wiederholungsgefahr“ besteht. Die Sperre soll nach den Vorstellungen des Ministeriums „verhältnismäßig“ und auch nur zeitlich befristet erfolgen.
Warum soll das „Gesetz gegen digitale Gewalt“ eingeführt werden?
Grundsätzlich kann jede Person, die sich im Netz bewegt, zum Opfer werden – von Verleumdung, Beleidigung, Bedrohungen im Internet, digitalem Stalking oder Cybermobbing. Weitreichende Daten zu Fallzahlen zur sogenannten digitalen Gewalt gibt es nicht. Experten sprechen jedoch von einem weitverbreiteten Phänomen. Eine Studie von 2019 zeigte etwa, dass acht Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland schon selbst Cybermobbing erlebt haben.
Betroffene haben nach Ansicht des BMJ bislang oft nur unzureichende Möglichkeiten, ihre Rechte selbst durchzusetzen. Häufig gelinge es schon nicht, zügig und mit vertretbarem Aufwand Auskunft über die Identität des Verfassers rechtswidriger Inhalte zu erlangen.
Ein Gesetz, das digitale Gewalt insgesamt unter Strafe stellt, existiert bislang nicht. Stattdessen greifen eine Vielzahl unterschiedlicher Strafvorschriften, unter anderem zu Beleidigungsdelikten (Paragraf 185 StGB), Nötigung (Paragraf 240 StGB) oder Bedrohung (Paragraf 241 StGB). Laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) müssen zudem rechtswidrige Inhalte von Plattform-Betreibern gelöscht oder gesperrt werden. Doch dabei sind Betroffene darauf angewiesen, dass die Tech-Konzerne aktiv werden.
Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli, die selbst immer wieder Opfer digitaler Gewalt geworden ist und unter Polizeischutz steht, vermisst zudem eine konsequente Umsetzung des NetzDG. Die frühere Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement in der Berliner Senatskanzlei berichtet von erfolglosen Gerichtsverfahren, die sie selbst in die Wege geleitet hat, um Beleidigungen zu ahnden. Erst jüngst sei entschieden worden, der von ihr bemängelte Sachverhalt sei von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Dagegen wolle sie nun Berufung einlegen und sich dabei auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stützen, mit der der Grünen-Politikerin Renate Künast in letzter Instanz Recht gegeben worden ist. Facebook muss nun die Daten der Onlinehetzer, gegen die Künast vorgegangen ist, an sie herausgeben.
Wird der Aufwand für Betroffene digitaler Gewalt geringer?
Für Betroffene ist die Durchsetzung der geplanten neuen Rechte mit einigem Aufwand verbunden. Sie müssten sich einen Anwalt nehmen und vor Gericht ein Auskunftsverfahren einleiten, um die Identität des Verfassers ermitteln zu lassen. Nach dem Willen des Justizministeriums sollen für dieses Auskunftsverfahren allerdings keine Gerichtskosten anfallen.
Nach Ansicht der Organisation Hate Aid, die Betroffene von „digitaler Gewalt“ unterstützt, ist das aber noch nicht ausreichend, da Anwaltskosten weiter anfallen. Die Organisation fordert daher, die Streitwerte für die Verfahren pauschal festzulegen, um sie so günstiger zu machen. Zudem sollten Betroffenen-Organisationen die Möglichkeit erhalten, die Opfer auf dem Rechtsweg vertreten zu können, so die Forderung.
Welche Kritik gibt es an dem Gesetzentwurf?
Die Eckpunkte des Bundesjustizministeriums stoßen bei Netzaktivisten auf teils scharfe Kritik. Ein Vorwurf: Das geplante Gesetz schieße weit übers Ziel hinaus. Denn der Auskunftsanspruch zur Identität eines Verfassers soll nicht nur für Straftaten im Bereich der sogenannten Hasskriminalität gelten, sondern beispielsweise auch bei „Schädigung durch wahrheitswidrige Nutzerkommentare“ in Online-Restaurantbewertungen. Der digitalpolitische Verein D64 befürchtet durch solche Ausweitungen „erheblich negative Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit“.
Ein weiterer Kritikpunkt: Das geplante Gesetz zielt nicht nur auf Kommentare, die User auf Plattformen wie Facebook oder Twitter absetzten, sondern auch auf die private Kommunikation in Messenger-Diensten wie etwa WhatsApp.
Der Chaos Computer Club (CCC) warnt eindringlich vor dem geplanten Gesetz, das „erhebliche Gefahren für die Bürgerrechte und die informationelle Selbstbestimmung“ berge. Die „erzwungene Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür wäre ein massiver Eingriff in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in einer Erklärung des CCC. Die Hackervereinigung fordert die Ampelregierung auf, stattdessen für eine personelle Stärkung und bessere Ausbildung der Ermittlungsbehörden zu sorgen. Diese würden bislang in vielen Fällen vorhandene Ermittlungsansätze ungenutzt lassen.
Auch die erhoffte Wirkung der Accountsperren ist umstritten, da blockierte Personen die Möglichkeit haben, sich mit einer neuen Identität anzumelden. Sogenannte Internet-Trolle sind ohnehin mit mehreren Konten parallel unterwegs.
Quellen: Johannes Kuhn, netzpolitik.org, dpa, KNA, Bayerisches Familienministerium, tmk