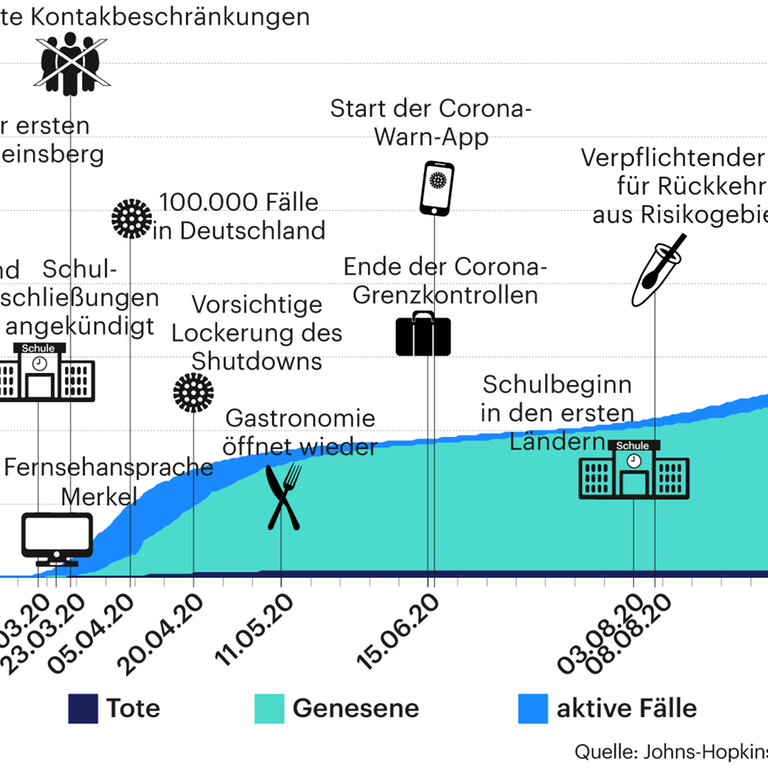Gesundheitsamt Plön. Ein Raum mit drei Arbeitsplätzen, die Schreibtische durch blaue Stellwände voneinander getrennt. An einer Wand hängt die Karte des Landkreises, jeder neue Fall darauf eine Nadel mit rotem Kopf. Ein Arzt und zwei Mitarbeiterinnen vom Amt versuchen hier, die Kontakte der neu bestätigten Coronafälle nachzuverfolgen. Anstrengend sei das, sagt Andrea Burmeister.
"Ständig ist man in Bereitschaft, ständig geht das Telefon und es kommen die unterschiedlichsten Fragen, wirklich, von: *Ich habe Kontakt gehabt', bis: 'Ich habe gehört, dass … oder ich habe ein positives Testergebnis, was muss ich tun'?"
Andrea Burmeister ist sozialmedizinische Assistentin – zu Nicht-Pandemie-Zeiten arbeitet sie im kinder- und sozialmedizinischen Dienst des Gesundheitsamtes. Nun aber hat Corona oberste Priorität.
Der Landkreis Plön liegt weit im Norden, knapp 130.000 Einwohner, viele Seen, die Ostsee – ein beliebtes Urlaubsgebiet. Und auf dem "COVID-19-Dashboard" des Robert-Koch-Institutes einer der letzten gelben Flecken in einem rot gefärbten Deutschland. Denn der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in Plön bei gerade mal 20 Fällen auf 100.000 Einwohner. Dennoch – dass die zweite Corona-Welle rollt, spüren sie auch hier.
Andrea Burmeister: "Es kommt schon vor, dass wir so wie gestern zwei Stunden länger geblieben sind, weil wir halt einfach noch Kontakte nachverfolgen müssen, wollen. Weil, es hängt ja auch davon ab: Die Leute wollen ja den nächsten Tag zur Arbeit oder zur Schule gehen. Und die müssen wir natürlich festhalten, wenn die unter Quarantäne gestellt werden müssen."
Neben Andrea Burmeister kümmern sich in Plön noch 34 weitere Menschen um die Pandemiebekämpfung. Ihr Chef, Josef Weigl, hat das Amt früh, schon im Januar, auf die neue Lage eingestellt. Und intern alles über den Haufen geworfen.
"Unsere Zahnärztin ist jetzt Datenbankmanagerin, die fährt auch und macht Abstriche, ist natürlich vertraut mit Mund und Nase. Und so wurde das im rollierenden System – ich habe erst mit der Kerngruppe angefangen, vom Stab her. Und dann die die Fälle abgearbeitet haben, und habe dann diese Gruppe sukzessive erweitert, und damit immer mehr Leute im Amt eingebunden, sodass jetzt der Großteil des Amtes eingebunden ist."
Crash-Kurs für die Hilfskräfte
Verstärkung bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes derzeit von einer Medizinstudentin und einem Arzt des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung. Michael Wessendorf wäre bei seinem Arbeitgeber eigentlich im Home Office – aber nun im Gesundheitsamt auszuhelfen, scheint ihm sinnvoller.
"Ich bin von Haus aus Chirurg und sich dann mit Viruserkrankungen zu beschäftigen, da war ich Azubi. Aber mit unserem Amtsleiter bin ich dann im Crash-Kurs mit den Dingen vertraut gemacht worden, die hier wichtig sind."
Einen solchen Crash-Kurs haben gerade viele Menschen in den Pandemie-Teams der Gesundheitsämter hinter sich. Überall wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Abteilungen abgezogen, die Bundeswehr hat mittlerweile ein Kontingent von 20.000 Kräften abgestellt, gut 5.600 Soldatinnen und Soldaten tun bereits Dienst im Kampf gegen das Corona-Virus. Bewaffnet mit Papier und Stift – und einer Checkliste zum Telefonieren.
Telefondienst lernt man nicht in der Grundausbildung
Neuland für Pascal Kaper und seine Kameraden "Definitiv, das gibt´s nicht in der Grundausbildung." (Gelächter) Der Oberstabsgefreite und sieben weitere Soldaten sind seit Kurzem in der Kreisstadt Bad Segeberg eingesetzt.
"Wenn wir anrufen, dann gehen wir hier auch wieder nach, also Geburtsdatum, männlich, weiblich, telefonische Erreichbarkeit, Adresse, E-Mail, wenn wir uns jetzt unsicher sind. Oder wenn die eine Frage haben, die wir noch nicht wissen. Denn wir wissen auch nicht alles, wir müssen uns auch erst einlesen."
Landrat Jan Peter Schröder ist trotzdem froh über jede helfende Hand. Im Gesundheitsamt wird seit Monaten sieben Tage die Woche gearbeitet, nur im Sommer gab es eine ruhigere Phase. Jetzt gehen die Fallzahlen wieder deutlich hoch. Der Kreis Segeberg grenzt im Norden an den beschaulichen Landkreis Plön, im Süden an die Großstadt Hamburg.
"Wir merken jetzt: Hamburg strahlt aus, das haben wir auch am Anfang gemerkt, im März, Februar, März, dass dann die Skiurlauber, die Ischgls – und jetzt merken wir, dass es aus Hamburg so ein bisschen rauswandert."
"Herzstück der Pandemiebekämpfung"
Die Großstädte sind von der Pandemie besonders betroffen – hier reißen die Sieben-Tage-Inzidenzwerte teilweise bereits die 200er-Schwelle. München, Frankfurt, Duisburg: Sie alle liegen weit über den durchschnittlichen Infektionszahlen.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bezeichnet die rund 400 Gesundheitsämter im Land als "Herzstück der Pandemiebekämpfung". Doch um mehr als jedes zehnte von ihnen ist es schlecht bestellt – 44 haben dem Robert-Koch-Institut offiziell eine Überlastung angezeigt. Auch in Berlin Mitte herrscht Ausnahmezustand. Veronika Weiß vom Pandemie-Team hofft, dass der Lockdown light, der seit zwei Wochen in Kraft ist, bald Wirkung zeigt. Denn hier kommen – Stand heute – sogar 331 Fälle auf 100.000 Einwohner.
"Im ersten Lockdown hatten die Leute ein bis vier Kontakte, enge Kontakte. Und jetzt vor dem Lockdown light hatten die Leute zwischen fünf und einhundert Kontakte. Also je nachdem, wenn jetzt Klassen im Spiel waren oder eine private Feier in geschlossenen Räumen im Spiel war, dann kann die Kontaktzahl natürlich unglaublich in die Höhe schießen."
Von "Kontrollverlust" will sie dennoch nicht sprechen. Sie verweist lieber auf die neue Allgemeinverordnung des Bezirks.
"Wir geben mehr Eigenverantwortung an die Bürger*innen und sagen: Gut, wenn Sie positiv auf Corona getestet wurden, bitte überlegen Sie: Mit wem haben Sie die letzten zehn, 14 Tage engen Kontakt gehabt. Erstellen Sie eine Kontaktliste mit Vornamen, Nachnamen, Meldeadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und schicken Sie uns das zu."
Ständig neue Regeln und Verordnungen
Mit Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen funktioniere das auch ganz gut. Individuell – räumt Veronika Weiß ein - könnte das aber durchaus schwierig werden. Im Klartext: Bei der Nachverfolgung einzelner Infektionsfälle kommt das Pandemie-Team mittlerweile kaum noch hinterher. Trotz Bundeswehr und Mitarbeitenden aus anderen Ämtern. Schon wegen der schieren Zahl der neuen Fälle. Dazu kommt: Die Leute müssen geschult werden, ständig kommen neue Regeln und Verordnungen dazu. Fachliche Qualifikation, sagt auch Ute Teichert, könne man den neuen Helferinnen und Helfern aber nicht ad hoc überstülpen. Sie ist Bundesvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
"Das andere ist aber auch, dass Sie natürlich so schnell auch die Organisation und die Logistik bereitstellen müssen. Sprich, Sie brauchen ja Räume für die Leute, PCs, Telefone, und so was alles. Und unter Umständen haben Sie das auch nicht so schnell verfügbar. Also das sind noch mal Herausforderungen auch jetztz, die vor Ort in unterschiedlicher Art und Weise gestemmt werden müssen."
Am Limit
In Dortmund leitet Frank Renken eines der größten Gesundheitsämter Deutschlands. Auch hier wurde massiv Personal zusammengezogen, auch hier unterstützt die Bundeswehr. Dennoch: Bei der Kontaktpersonenermittlung, sagt der Amtsleiter, habe man mittlerweile vier Tage Rückstand.
"Die Konsequenz bei uns ist ganz eindeutig, dass man Infektionsketten nur noch ganz vereinzelt unterbrechen kann. Dass man in einer sehr, sehr nennenswerten Anzahl der Fälle nicht mehr in der Lage ist, diese Infektionsketten aufzuklären. Wir können nur noch teilweise Kontaktpersonen ermitteln und teilweise Kontaktpersonen selber auch sprechen."

Auch in Frankfurt am Main sind sie mit ihren Kräften am Limit. René Gottschalk, der Amtsleiter, hat längst die Strategie geändert:
"Am Anfang, wenn Sie wenige Fälle haben bei einem pandemischen Prozess, da können Sie es sich leisten, auch wirklich jeden Fall nachzuverfolgen. Bis zu dem Punkt, wo die Fallzahlen so stark ansteigen, dass Sie das gar nicht mehr leisten können. Aber auch nicht müssen, weil das Wissen über das Virus – meistens sind es ja Viren – angewachsen ist."
Wichtig sei es, in dieser Phase zu priorisieren. "Wenn Sie vier Fünftel der Bevölkerung haben, die keine großen Probleme mit diesem Virus haben, dann ist es strategisch völlig richtig, dass Sie dann Ihre Anstrengungen auch auf die 20 Prozent richten.
"Vieles geht nur noch im Notdienst"
Dennoch bleibt eine Menge Arbeit liegen. Denn Gesundheitsämter sind nicht nur für den Infektionsschutz zuständig. Zu ihren Aufgaben gehören auch Hygienekontrollen in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Das fällt nun alles flach. "Schwierig", findet das Ute Teichert, die Bundesvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Es gebe ja nicht nur COVID-19, sondern auch andere Gesundheitsgefahren, gefährliche Krankenhauskeime etwa.
"Da kann sehr schnell etwas passieren, gerade, weil wir in einem sehr sensiblen Bereich sind. Und das finde ich sehr schade und auch gefährlich, dass uns das jetzt so ein bisschen aus den Händen gleitet."
In Dortmund sind zugunsten der Pandemiebekämpfung fast alle anderen Bereiche heruntergefahren, vieles geht nur noch im Notdienst. Der sozialpsychiatrische Dienst aber, der sich um psychisch kranke Menschen kümmert, soll weitermachen, sagt Amtsleiter Renken.
"Wenn wir die nicht besuchen, wenn wir uns nicht um die kümmern, wenn wir für die keine Beratungsdienste mehr anbieten, dann wird die Suizidrate massiv ansteigen. Auch der Dienst muss ganz klar laufen."
Keine Schuleingangsuntersuchung mehr
Was sie in Dortmund nicht mehr schaffen, sind Schuleingangsuntersuchungen. Das hat Folgen für die Kinder, die ohnehin schon schlechtere Chancen haben, weil sie aus Migrantenfamilien oder armen Haushalten kommen, weiß Frank Renken.
"Wenn wir vor Beginn der Schulpflicht nicht mehr feststellen, dass es noch einen gewissen Förderbedarf gibt, dann wird es niemand feststellen. Und das ist natürlich sehr schade, aber solche, ich sage mal, Kollateralschäden werden in unserer Gesellschaft momentan billigend in Kauf genommen, und zwar überall."
Im schleswig-holsteinischen Plön führt Josef Weigl durchs Haus. Prioritäten setzen, Strategien entwickeln, operativ denken – das sind Schlagwörter, die ihm häufig über die Lippen kommen. Er will sich dem Virus nicht geschlagen geben.
"Mein Tag geht in der Früh los, ich sitze um sechs Uhr am Schreibtisch, dann komme ich hierher. Dann gibt es um 9 Uhr das Morgenbriefing, wo ich dann entweder neue Wissenschaftserkenntnisse sage oder zum operativen Geschäft oder was halt gerade angesagt ist."
Umso mehr ärgert er sich über vermeintlich unnötige Bürokratie, etwa die neue Bundestest-Verordnung vom Oktober. Die dort vorgesehenen Antigentests seien häufig wenig aussagekräftig – belasteten aber die Gesundheitsämter, weil diese nun die Anträge diverser Anbieter prüfen müssten.
"Ich denke, dass die Gesundheitsämter nicht als echter Stakeholder, wie es Neudeutsch heißt, gesehen werden und nicht im Vorfeld überhaupt mit jemandem reflektiert wird, dass, wenn von oben was losgetreten wird: Was ist als Mehrwert oder als Wirksamkeit überhaupt zu erwarten? Und was macht das flussabwärts für Verwerfungen oder für Arbeitsbelastungen?"
Zuvor ein Amt unter vielen
Bis zum Ausbruch der Pandemie maßen Länder und Kommunen der öffentlichen Gesundheit wenig Bedeutung zu. Gesundheitsämter seien personell und technisch vielerorts schon vor Corona ausgemergelt gewesen, klagt Ute Teichert, Bundesvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes.
"Das hängt mit mehreren Gründen zusammen: Einerseits Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst. Andererseits aber auch eine schlechtere Bezahlung für den Bereich, was natürlich auch dazu beiträgt, dass es nicht gerade attraktiv ist, in den Bereich reinzuwechseln."

Im Verwaltungsgefüge deutscher Kommunen war das Gesundheitsamt bislang ein Amt unter vielen. In manchen Kommunen wurde hier in den vergangenen Jahren viel gespart, größere Städte haben meist besser besetzte Ämter. Die Lage ist regional sehr unterschiedlich. Allen gemein aber ist das schlechte Image. Für Medizinerinnen und Mediziner, bestätigt auch Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, sei das Gesundheitsamt kein attraktiver Arbeitsplatz.
"Es gibt einen schönen Spruch, der ist vielleicht ein bisschen gemein: Wer geht als Arzt zum Gesundheitsamt? Da war die Antwort: 08/15. Null Karrierechancen, acht Stunden Arbeit und höchstens A15. Das ist überspitzt, aber die standen nicht im Zentrum des Interesses."
"Virologen sollten nicht empfehlen, dass man eine Schule zumacht"
Dabei ist der "Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen" durchaus anspruchsvoll: Nach der ärztlichen Grundausbildung fünf Jahre lang klinische Medizin und Psychiatrie, dazu Praxis im öffentlichen Gesundheitswesen und Module in Management, Organisationsführung und Verwaltungsrecht.
"Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das alles hinzukriegen", sagt René Gottschalk vom Gesundheitsamt in Frankfurt. Selbst Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen, aber auch Internist und Infektiologe.
"Bei der ganzen Ausbildung lernen Sie halt sehr, sehr viel und Sie lernen vor allen Dingen viel, was Bevölkerungsmedizin angeht. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Virologen oder sonstige Nicht-Fachärzte für öffentliches Gesundheitswesen nicht empfehlen sollten, dass man eine Schule oder einen Flughafen zumacht. Das können sie nicht beurteilen, dafür haben sie nicht die Expertise. Das wiederum können Fachärzte für öffentliches Gesundheitswesen – und die wurden früher und in letzter Zeit viel zu selten gehört."
Nach Angaben des Deutschen Städte- und Gemeindesbundes verdient ein Arzt im Gesundheitsamt gut tausend Euro weniger pro Monat als der Kollege im Krankenhaus. Auch wenn Arbeitszeiten und -situationen in den Kliniken andere seien, sagt Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund ein, seien die Jobs im Gesundheitsamt vergleichsweise schlecht bezahlt.
"Das muss sich einfügen in das Gehaltsgefüge, wir sind eben keine Kliniken, sondern wir sind Verwaltungen. Man wird da ja auch etwas tun, es geht übrigens nicht nur um die Ärzte, sondern auch um die anderen Mitarbeiter. Der Bund investiert jetzt nicht nur in Personal, sondern auch in Digitalisierung, auch da haben wir natürlich Nachholbedarf. Also, die Pandemie ist uns auch eine Lehre, was die Gesundheitsverwaltung angeht – und das muss dauerhaft besser werden, ja."
Pakt nicht nachhaltig?
Ende September haben Bund und Länder einen "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" beschlossen. Der Bund stellt bis 2026 vier Milliarden Euro zur Verfügung, für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen. Die Länder sollen dafür Sorge tragen, dass schon bis Ende kommenden Jahres 1.500 neue Stellen geschaffen werden, bis Ende 2022 sollen mindestens 3.500 weitere Vollzeitstellen entstehen. Ute Teichert, Bundesvorsitzende der Amtsärztinnen und Amtsärzte ist skeptisch, wie nachhaltig die Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes ist – zur Bewältigung der Pandemie trage der Pakt derzeit jedenfalls noch nicht bei.
"Sprich, jetzt in der Pandemie, haben wir dasselbe Verhältnis wie vorher, wir haben viel zu wenig Personal dort und das führt dazu, dass wir vermehr auf Hilfskräfte angewiesen sind."
Der Landkreis Segeberg will im nächsten Jahr 20 neue Mitarbeiter einstellen, Vollzeit. Zunächst für den Infektionsschutz. Aber Landrat Schröder denkt auch schon an die Zeit nach der Pandemie – genug zu tun sei allemal.
"Wenn wir vorne eine Stelle bekommen, die wir in der Pandemie vielleicht irgendwann nicht mehr brauchen, dass wir sagen: Wir nehmen diese Stelle und stecken sie dann in die Schuleingangsuntersuchung oder in den Sozialpsychiatrischen Bereich. Das ist so die Idee, die dahintersteckt: Erst Mal Pandemie. Und im zweiten Schritt gucken: Wie können wir den Gesundheitsdienst insgesamt aufstocken?"

Neben dem zusätzlichen Personal soll vor allem die Digitalisierung die Gesundheitsämter in die Lage versetzen, die Corona-Pandemie besser zu beherrschen. Ute Teichert, die Vorsitzende der Amtsärztinnen und Amtsärzte, hält diesen Punkt für zentral. Digitalisierung würde Arbeitsabläufe verschlanken und helfen, das Personal besser einzusetzen. Etwa, wenn es um die Ergebnisse der Corona-Tests gehe.
"Momentan können die Testergebnisse digital zwar in der App eingelesen werden, aber die Gesundheitsämter haben keine Schnittstelle, um die Ergebnisse sozusagen direkt zu empfangen, weil man zum Beispiel bei der App gesagt hat: Das ist Datenschutz, das geht nicht, wir können die Daten nicht weiterleiten. Und das heißt, die Daten zum Beispiel werden in dem Fall doppelt verarbeitet, also einmal auf ganz schnellem Weg gehen die digitalisiert in die App. Und dann schickt das Labor das Ganze noch mal per Fax oder per PDF oder wie auch immer ans Gesundheitsamt. Und die müssen sich das dann erst Mal wieder alles hochladen und das wieder zusammenführen. Das ist ja verrückt!"
"Nach der Pandemie ist vor der Pandemie"
Datenschutz – so ist es derzeit aus vielen Gesundheitsämtern zu hören – sei zwar wichtig – erschwere aber in der aktuellen Krisensituation effizientes Handeln. Daran ändere auch die vom Robert-Koch-Institut entwickelte Software "DEMIS" nichts. Dortmund ist eines der Gesundheitsämter, in denen die Software gerade getestet wird. Bislang mussten Frank Renken und seine Mitarbeitenden die eingehenden Meldungen am Faxgerät einsammeln und in die eigene EDV eingeben. Nun müssen sie zwar nicht mehr zum Faxgerät laufen, die Meldung wird elektronisch übermittelt.
"Und dann kommt das große Aber: Diese Meldung ist für den Computer so anonymisiert, Datenschutz wird ja in Deutschland immer sehr groß geschrieben, dass unser Computer die nicht lesen kann. Ich muss jede einzelne Meldung am PC aufmachen, und muss aus jeder einzelnen Meldung die personenbezogenen Daten rauslesen und muss sie wieder händisch eingeben. Also, Sie werden verstehen, dass das jetzt nicht die große Arbeitserleichterung für die Gesundheitsämter ist."
Gesundheitsämter dauerhaft effektiver machen
Wegen solcher Widrigkeiten haben sie es in Plön überhaupt nicht eilig, neue Software auf ihren Rechnern zu installieren. Josef Weigl setzt lieber auf sein eingeschworenes Team und plant die nächsten Schritte, sollten die Fallzahlen auch bei ihm im Landkreis weiter steigen.
"Falls der Effekt nicht eintreten würde vom momentanen Teil-Lockdown, dann würden wir ein zweites operatives Zentrum anfahren, und das ist dann halt laufend Planung, dass die Besetzung hinhaut."
Reichen die Maßnahmen aus? Halten sich die Menschen an die Hygieneregeln? Können Krankenhäuser, Labore – aber auch die Gesundheitsämter - die Krise in den kommenden Monaten bewältigen? Nie war ein funktionierender öffentlicher Gesundheitsdienst wichtiger als heute. Und daran, glaubt Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, wird sich auch in Zukunft nichts ändern.
"Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Niemand garantiert uns, dass es nicht einen Erreger, wir hoffen es nicht, aber wir wissen es nicht, in zwei, drei Jahren wieder gibt. Und dann müssen wir entsprechend vorbereitet sein. Also das Augenmerk auf die Gesundheitsämter wird dauerhaft effektiver gerichtet sein müssen."