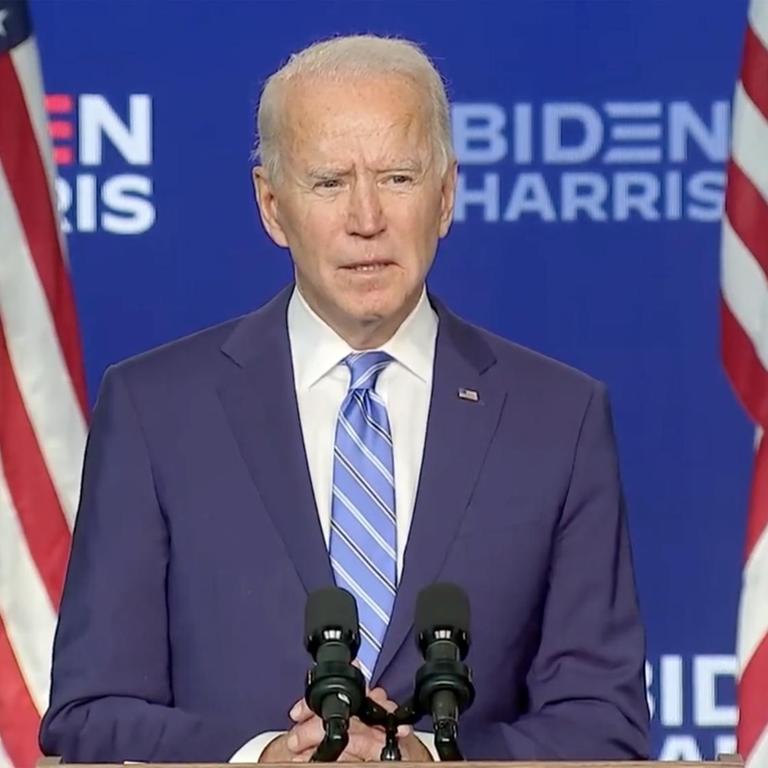Der Hafen von Piräus, nicht weit von der griechischen Hauptstadt Athen entfernt. Wie Bauklötze stapeln sich grüne, blaue und silberne Container mit den Schriftzügen großer Reedereien: Evergreen, Hapag Lloyd oder Maersk. Container sind das Symbol für den weltumspannenden Handel mit Gütern, der seit dem Jahr 1950 um mehr als das 250-fache gestiegen ist.
Am Kai liegt das Containerschiff Tampa Triumph. Lastenkräne hieven die mehr als 10.000 Stahlboxen herunter.
"Wir haben hier Super-Post-Panama-Kräne, die in der Lage sind, Schiffe zu bedienen, die so groß sind, dass sie den Panama-Kanal nicht durchfahren können", erzählt ein Mitarbeiter der Hafengesellschaft. Den Hafen von Piräus steuern häufig Schiffe an, nachdem sie den Suezkanal durchfahren haben, eine der wichtigsten Routen des Welthandels.
Das Umstellen auf Pandemie-Modus ist zur Normalität geworden. Im Windschatten der Krise spielten sich große und weniger große, aber markante Umbrüche ab. Der "Hintergrund" im Deutschlandfunk schaut in der Serie "Im Schatten von Corona – Nebenwirkungen" auf fünf Politikfelder.
Der vorliegende Hintergrund ist Teil 2 der Serie.
28.12.2020
Europa und die USA - Trumps transatlantisches Erbe
30.12.2020
Wie sich Politik in der Pandemie digital darstellt
31.12.2020
Straßburg, die Pandemie und das leere Parlament
1.1.2021
Brexit im Pandemiemodus
Der vorliegende Hintergrund ist Teil 2 der Serie.
28.12.2020
Europa und die USA - Trumps transatlantisches Erbe
30.12.2020
Wie sich Politik in der Pandemie digital darstellt
31.12.2020
Straßburg, die Pandemie und das leere Parlament
1.1.2021
Brexit im Pandemiemodus
Umdenken bei der globalen Arbeitsteilung
Gut 5.000 Containerschiffe verkehren auf den Weltmeeren, doppelt so viele wie im Jahr 2000. Sie transportieren alle erdenklichen Waren und Vorprodukte, die dann weiterverarbeitet werden – oft von China in den Rest der Welt, oder zwischen den Kontinenten.
Aber der Beginn der Pandemie im Frühjahr mit weltweiten Grenzschließungen und Produktionsstopps legte die Risiken dieser intensiven globalen Arbeitsteilung offen. Als Lieferketten rissen, fehlten Atemschutzmasken und Vorprodukte für Antibiotika wurden knapp – beides kommt vor allem aus Asien. Seitdem gibt es eine Diskussion über die Produktion lebenswichtiger Güter in Europa. Eine Nebenwirkung der Coronakrise.
Schon vor der Pandemie hatte ein Umdenken über die globale Arbeitsteilung eingesetzt: aus technologischen Gründen, weil Roboter die Fertigungskosten senken, und aus politischen und wirtschaftlichen Gründen. Hier spielt vor allem die zunehmende Systemkonkurrenz zwischen den USA und Europa, also den marktliberalen Demokratien, und China mit seinem autoritären Staatskapitalismus eine Rolle. Aber auch ökologische Gründe werfen seit einiger Zeit Fragen zur globalen Arbeitsteilung auf, etwa die Idee, eine klimaneutralere Industrieproduktion in Europa zu schaffen.
"Coronakrise beschleunigt viele Trends"
Die Pandemie wirkte hier als Katalysator, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft:
"Die Coronakrise beschleunigt viele Trends, die schon vorher sichtbar waren, das gilt auch in Hinblick auf den Welthandel und die systemische Rivalität vor allem zwischen China und USA, die spitzt sich in dieser Krise zu."
Denn während in den USA die Wirtschaft 2020 um mehr als drei Prozent schrumpfen wird, ist Chinas Wirtschaft in den ersten neun Monaten um 0,7 Prozent gewachsen. Und Europa?
"Für Europa wird in der Krise sehr deutlich, dass wir abgehängt werden, denn China wächst besser in der Krise als die USA, aber die USA kommen, jedenfalls wirtschaftlich gesehen, auch besser durch die Krise als die Eurozone. Diese Verschiebungen, die beschleunigen sich, und die haben sehr konkrete Auswirkungen auf die Architektur der Weltwirtschaftsordnung."
Einen enormen Schub bekam die globale Arbeitsteilung ab 1989, nach dem Ende des Systemwettbewerbs zwischen dem kapitalistischen Westen und den sozialistischen Planwirtschaften des Ostens. Weitere Verstärker waren die Erfindung des Internets und der Bau immer größerer Containerschiffe. Seitdem wurden die globalen Wertschöpfungsketten immer verästelter.
"Rein ökonomische Globalisierung gescheitert"
Kommt es nun, im Zuge der Coronakrise, zu einer Entkopplung der Wirtschaftsräume? Wird es künftig weniger globale Arbeitsteilung geben?
Das ist eine Möglichkeit, nicht nur wegen des sich verschärfenden Systemwettbewerbs, sondern weil es gleichzeitig auch gehörige Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer einseitig nach ökonomischen Kriterien organisierten Globalisierung gibt. Der Philosophieprofessor Markus Gabriel von der Universität Bonn:
"In der Tat glaube ich, dass das Modell einer rein ökonomischen Globalisierung gescheitert ist. Das heißt, der Gedanke, dass die globale Vernetzung der Menschheit im Hinblick auf Frieden, Fortschritt und so weiter, insgesamt eine humane Verbesserung – dieses Modell, wenn wir das reduzieren auf ökonomischen Austausch, also auf die reine Logik von Märkten, ist tatsächlich gescheitert. Spätestens 2020, aber eigentlich sozusagen in mehreren Schüben."
So ist die globale Arbeitsteilung mit einer gehörigen Ausbeutung von Menschen und Natur verbunden. Zudem verlangt der Kampf gegen den Klimawandel völlig neue Prioritäten für die Organisation der Weltwirtschaft. Es kann nicht mehr nur darum gehen, Waren möglichst billig herzustellen, sondern möglichst CO2-neutral.
Firmen lagern Produktionsprozess aus
Trotzdem: Noch hängt unser Wohlstand in Europa wesentlich am Tropf einer nach rein ökonomischen Kriterien organisierten globalen Arbeitsteilung. Im kapitalistischen Wirtschaftssystem setzen die Unternehmen von jeher auf die unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnisse an verschiedenen Orten, um ihr Kapital zu vermehren. Heute lagern sie deswegen die Produktion in Entwicklungs- und Schwellenländer aus und konzentrieren sich oft auf den Anfang und das Ende der Wertschöpfungskette, also die Entwicklung neuer Waren und Dienstleistungen und deren Vermarktung. Das ist eine wesentliche Ursache für den Wohlstand in den Industrieländern, sagt der Schweizer Ökonomie-Professor Mathias Binswanger.
"Ja, das klingt zunächst mal ein bisschen absurd." Viele Menschen seien erstaunt, "dass ein Land wie die Schweiz eigentlich deshalb vor allem ein so hoch entwickeltes Land ist mit so hohen Einkommen, weil es gerade nicht produziert. Das liegt daran, dass es bei der eigentlichen Produktion eine enorme globale Konkurrenz gibt, das heißt, da gibt es sehr viele Länder, die sich als Produktionsstandort anbieten und diese Konkurrenz, die treibt die Preise nach unten in der Produktion und damit auch die Wertschöpfung."
Das führt dazu, dass viele Unternehmen kaum oder gar nicht mehr selber Waren produzieren, sie lagern den Produktionsprozess aus. Adidas, H&M oder Apple gehören dazu. Andere Firmen wie Auto- oder Maschinenbauer beziehen einen immer höheren Anteil an Vorprodukten von Dritten.
Hinzu kommt: Nur wenige dieser Produktionsländer haben davon profitiert, dass ein Teil des verarbeitenden Gewerbes aus den großen Industriestaaten zu ihnen gekommen ist, weil sie eng in die Wertschöpfungsketten von Unternehmen aus Europa, den USA oder Japan integriert sind. Indien, Indonesien, Südkorea, Polen, Thailand und ganz besonders China gehören dazu.
Vom Produzenten zum Konkurrenten
Dessen Erfolg könnte die heutige Weltwirtschaftsordnung verändern. Erst avancierte China zur Werkbank der Welt und mauserte sich dann zum veritablen wirtschaftlichen Konkurrenten für die alten Industrieländer. So hat es etwa eigene Digitalriesen aufgebaut, die Google & Co. Paroli bieten können. Und die chinesischen Staatskonzerne expandieren weltweit, auch nach Europa.
So übernahm COSCO, eine der größten Reedereien der Welt, seit 2009 schrittweise den Betrieb des Hafens von Piräus. Ein weiterer Punkt auf der neuen Weltwirtschaftskarte, die China entworfen hat, mit sich im Zentrum. Aber darüber will Fu Chengqiu, der chinesische Hafendirektor, Anfang 2018 nicht reden:
"Wir sind Geschäftsleute und keine Politiker." Und sein griechischer Kollege ergänzt. "COSCO ist als Investor gekommen und nicht als Eroberer, wie viele anfangs dachten."
Aber das sehen viele Politiker und Wirtschaftsführer im Westen mittlerweile anders. Aus dem Handelspartner ist ein Konkurrent geworden, der global immer stärker seine Interessen durchsetzt. Prinzipiell handelt die Volksrepublik China nicht anders, als es der Westen jahrhundertelang getan hat. Die Regierung baut ihre Einflusssphäre aus und versucht ihre strategischen Interessen durchzusetzen, ob durch das Projekt der Neuen Seidenstraße, die Schaffung einer asiatischen Entwicklungsbank oder die weltgrößte Freihandelszone in Asien, RCEP.
China als Trittbrettfahrer der WTO
Aber China nutzt seine ökonomische Macht mittlerweile eben auch dazu, um Demokratien unter Druck zu setzen, aktuell zum Beispiel Australien. Weil dessen Regierung sich für eine unabhängige Untersuchung zur Entstehung der Corona-Pandemie ausgesprochen hatte, verhängte China Zölle.
Der Westen war überzeugt, dass sich China – eingebunden in die globale Arbeitsteilung – mit wachsendem Wohlstand wandeln würde, zu einem Geschäftspartner, der die Regeln akzeptiert. Deswegen befürworteten westliche Staaten 2001 die Aufnahme des Landes in die Welthandelsorganisation WTO. Aber die Chinesen nutzen einseitig die Vorteile des Regelwerks für ihre Unternehmen in der globalen Arbeitsteilung. Ist China ein Trittbrettfahrer der liberalen WTO?
"Das kann man vereinfacht sicherlich so sagen", sagt Max Zenglein, Chefökonom bei der Berliner Denkfabrik Mercator Institut für China-Studien. "China hat von offenen Märkten und Zugang zu Technologie immens profitiert. Damit hat die Offenheit von den anderen Industrienationen auch, Europa und den USA, in der Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas eine immense Rolle gehabt."
Die Volksrepublik China gewährt eine solche Offenheit Unternehmen aus anderen Ländern nicht im gleichen Umfang. Damit verstößt sie gegen den zentralen Grundsatz der WTO, dem zufolge Länder sich gegenseitig die gleichen Handelsbedingungen gewähren.
Der Irrtum "Wandel durch Handel"
Eine weitere Idee, die mit dem WTO-Beitritt Chinas verbunden war, erwies sich ebenfalls als Irrtum: Wandel durch Handel, von einer kommunistischen Einparteien-Diktatur hin zu einer Demokratie.
"Man muss akzeptieren, China ist ein großes Land, es hat einen globalen Anspruch, es wird sich nicht an dem westlichen System orientieren. Und es kommt eben jetzt mit einem Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, in der man der Welt seinen eigenen Stempel aufdrücken muss, und damit muss auch der Westen lernen umzugehen."
Die USA unter Präsident Donald Trump haben das versucht und setzen auf eine teilweise Entkopplung beider Volkswirtschaften. Sie legen China gezielt Steine in den Weg, indem sie etwa die Ausfuhr von eigener Hochtechnologie nach China kontrollieren, wie bei Halbleitern zum Beispiel. Ohne die winzigen Bauteile geht nichts in der modernen Produktion – sie stecken in Maschinen, Flugzeugen, Smartphones und selbst Waschmaschinen. Technologisch seien die "USA bereits in einem kalten Krieg mit China", sagt der US-Politologe Ian Bremmer. Und zumindest in diesem Punkt dürfte der neue Präsident Joe Biden die Politik seines Vorgängers beibehalten.
Und wie verhält sich Europa? Max Zenglein vom Mercator Institut für China-Studien: "In der Vergangenheit, da würde ich zustimmen, war aus Sicht Chinas die EU ein relativ leichter Partner, mit dem man machen konnte, was man wollte."
Die EU hat aber ebenfalls auf Chinas gestiegenes Selbstbewusstsein reagiert und spricht seit dem Jahr 2019 von einer systemischen Rivalität mit der Volksrepublik. Die härtere Linie gegenüber China stützt auch der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Lobbyverband sieht aber noch einige Schwächen. Stormy-Annika Mildner, Leiterin der Abteilung für Außenwirtschaftspolitik:
"Wo wir relativ schwach aufgestellt sind, ist bei der Frage der Antisubvention. Das Problem dabei ist, dass wir nicht sonderlich effektiv gegen Subventionen im Ausland vorgehen können. Wo wir auch schwach aufgestellt sind, ist bei der europäischen Wettbewerbspolitik, die uns auch nicht gut erlaubt, gegen subventionierte Übernahmen beispielsweise vorzugehen."
Handelsinteressen vs. Menschenrechte
Neue Fragen der Arbeitsteilung, Rivalitäten zwischen China und dem Westen: Wer wird in Zukunft die Standards für den Welthandel vorgeben? Ein Blick in die neue Freihandelszone RCEP, der 15 asiatische Staaten im pazifischen Raum inklusive China angehören, könnte zeigen, wohin die Reise geht. Hier geht es nur um Zölle und nicht um soziale oder ökologische Standards. Das ist ganz nach dem Geschmack von China, dass die Freihandelszone maßgeblich vorangetrieben hat.
Dagegen nutzen die Europäer Handelsverträge auch, um global Umweltschutz oder Menschenrechte voranzubringen. Ökonom Gabriel Felbermayr vom Kieler Institut für Weltwirtschaft: "In den letzten Jahren hat man, glaube, ich in Europa verstanden, dass wir Handelspolitik nicht in einem Silo betreiben können, sondern dass wir unsere anderen außenpolitischen Anliegen auch in der Handelspolitik abbilden müssen. Da geht es natürlich um Menschenrechte, da geht es auch um Umweltschutz und andere Fragen im sozial- und arbeitsrechtlichen Bereich."
Aber die Pandemie schwächt die EU. Die Wirtschaftsleistung schrumpft und ausgerechnet jetzt verliert sie mit Großbritannien auch noch eine ihrer großen Volkswirtschaften. Gabriel Felbermayr: "Je kleiner unser Binnenmarkt ist, im Sinne von weniger Konsumenten oder im Sinne von kleinerem Bruttoinlandsprodukt, umso weniger Macht haben wir als Europäer, unsere Standards weltweit durchzusetzen."
Folgen unseres Konsums "outgesourced"
Diese politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen spielen derzeit gegen Europa. Andererseits muss sich die Architektur der Weltwirtschaft gewaltig verändern, damit künftig nicht mehr Ressourcen verbraucht werden, als nachwachsen können, damit die Klimaerwärmung begrenzt wird und entlang der Wertschöpfungsketten niemand mehr ausgebeutet wird. Der Philosoph Markus Gabriel von der Universität Bonn:
"Die Dunkelheit unserer Zeit besteht darin, dass wir Systeme der Verdeckung haben, Propaganda, Illusionen, Manipulationen, Selbstbetrug. Die führen dazu, dass wir uns Dinge schönreden, die alles andere als schön sind. Man weiß zwar irgendwie, dass die Produkte, die man alltäglich konsumiert, dazu führen, dass irgendwie doch Kinder sterben, aber man ist selber nicht direkt verantwortlich für den Tod von Kindern, sondern das ist outgesourced eben in den komplexen globalen Verteilungsketten."
Als Sackgasse erwiesen hat sich die Vorstellung, die Märkte und ein grenzenloser Freihandel würden es schon richten. Der Schweizer Ökonom Mathias Binswanger: "Ich glaube, die Idee des totalen Freihandels, die lässt sich nicht vereinbaren mit der Idee, dass wir ja eben auch ein möglichst grünes Wachstum wollen, sondern da muss man auch den Mut haben, den Handel in gewissen Bereichen einzuschränken. Das machen wir zum Beispiel auch in der Landwirtschaft, wo wir sagen, wir wollen eine eigene Landwirtschaft erhalten, weil wir eine eigene Nahrungsmittelproduktion wollen. Und ich denke, dieses Denken kann man durchaus auch auf andere Bereiche ausdehnen, das heißt, es geht eben nicht mehr nur darum, wie in der Vergangenheit, dass man alles dort produziert, wo es am billigsten ist."
Grüner und sozialer Protektionismus kostet
Aber die Veränderung der Wirtschaftsordnung hin zu mehr Moral und Menschenrechten wird nur gelingen, wenn sich das für die Unternehmen rechnet. Beispielsweise werden Antibiotika-Grundstoffe vor allem deswegen in Asien produziert, weil dies dort wegen geringerer Umweltauflagen günstiger ist. Lohnkosten spielen bei dieser weitgehend automatisierten Produktion nur eine geringe Rolle. In Europa werden diese Substanzen erst dann wieder in größeren Mengen produziert, wenn dieses Manko ausgeglichen wird, etwa durch einen Zoll auf Antibiotika-Substanzen, bei deren Produktion geringere Umweltstandards gelten.
Über solch einen Zoll oder andere Instrumente denkt die EU gerade im Zusammenhang mit der Produktion von Stahl nach, der mit Wasserstoff statt Kohle erzeugt werden soll. Denn es macht keinen Sinn, mit viel Steuergeld eine ökologisch verträgliche Stahlproduktion in Europa aufzubauen, wenn gleichzeitig konventionell hergestellter Billigstahl aus dem Ausland weiter den europäischen Markt fluten würde.
Aber selbst wenn sich Europa für einen grünen oder sozialen Protektionismus entscheidet, wird dies etwas kosten. Gabriel Felbermayr: "Da braucht es einen gesellschaftlichen Konsens. Wie viel eigenen Wohlstand sind wir bereit aufzugeben, um einen Beitrag dafür zu leisten, das China seine Minderheiten besser behandelt? Wie viel Wohlstand sind wir bereit aufzugeben in Europa, um in Brasilien Anreize zu schaffen, dass der Regenwald erhalten wird? Das muss politisch ausgemessen werden, und ich sehe im europäischen Parlament zum Beispiel, dass diese Debatte voll im Gang ist, aber wie die Entscheidung am Ende des Tages aussehen wird, das ist noch sehr offen."
"Moralischen Fortschritt vorantreiben"
Was wäre also richtig und was falsch im Hinblick auf eine neue globale Arbeitsteilung?
Ökonomen argumentieren mit Blick auf die Arbeitsteilung oft mit den Vorteilen des Freihandels für alle Beteiligten, Politikberater mit Interessen und Macht der Akteure. Was ist aus Sicht der Philosophie geboten? Der Bonner Professor Markus Gabriel verweist auf Adam Smith, den schottischen Moraltheologen und Gründer der Nationalökonomie.
"Der ja argumentiert hat, dass die berühmte unsichtbare Hand, die invisible hand, nicht etwa darin besteht, dass die Märkte halt frei sind, also globaler Freihandel zum Beispiel auch zwischen Diktaturen, Stichwort China, und der EU. Sondern der Gedanke von Adam Smith war, dass wir moralischen Fortschritt vorantreiben müssen, damit sich dann der Freihandel in die richtige Richtung entwickelt, das hängt ja vom moralischen Bewusstsein der Akteure ab, in welcher Weise Freihandel nützlich oder schädlich ist für Menschen."