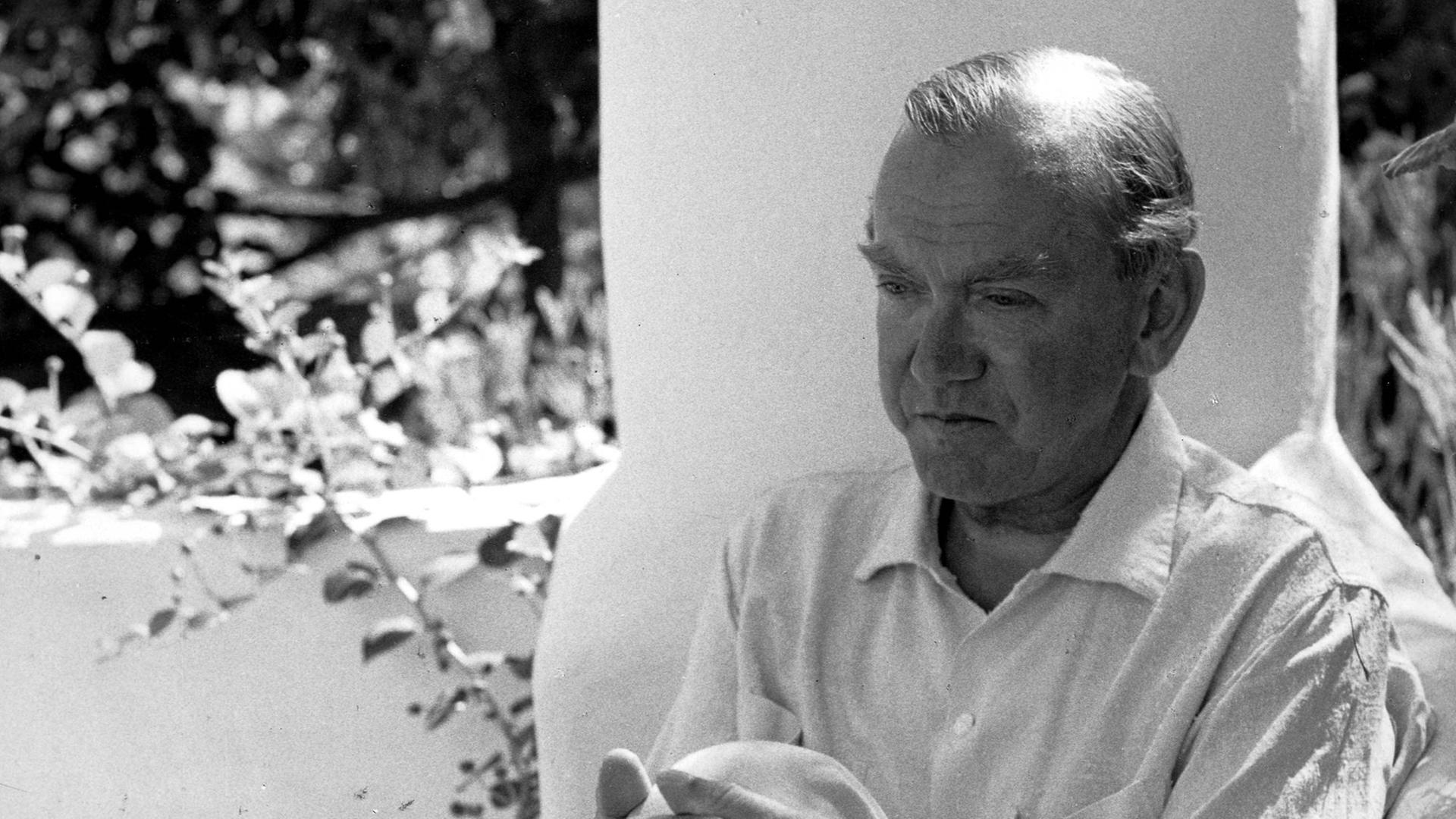
"Das Thema kam beim Frühstück erneut auf: die Pest in Dakar, Gelbfieber in Bathurst; entlang der französischen Küste wurden die Epidemien verschwiegen, an der liberianischen gar nicht erst gemeldet. Dem Thema der Fieberinfektionen konnte man schwer entkommen. Man konnte ein Gespräch über Religion, Bücher oder Politik beginnen, es endete unweigerlich mit Malaria, Pest und Gelbfieber."
Und doch war Graham Greene nicht von seinem Plan abzubringen, das liberianische Hinterland, für das damals keinerlei brauchbare Landkarten existierten, zu durchwandern. Er hatte "Herz der Finsternis" von Joseph Conrad gelesen und wusste, auch durch erfahrenere Afrikareisende, dass das Klischee von der Dschungelhölle, vom Seuchenherd, alles andere war als nur ein Klischee. Es sei eben nicht das vollkommen klare Bewusstsein, welches eine Reise nach Westafrika einer in die Schweiz vorziehe, heißt es zu Beginn von "Reise ohne Landkarten". Allein eine gewisse "Zwielichtigkeit" der Gegend, das Versprechen etwas - was auch immer - dort zu finden, habe ihn, schreibt Greene, angetrieben. Freilich plante er von vornherein, ein Buch über diese Reise zu verfassen. Mit dabei, warum auch immer, seine Cousine Barbara und, das mit gutem Grund, 25 einheimische Träger.
"Die Lastenstücke wurden in der Mitte des Dorfes ausgebreitet, und zum ersten Mal sah ich, wie viel Gepäck wir tatsächlich mitgenommen hatten: die sechs Kisten Nahrungsmittel, die beiden Betten und Sessel und Moskitonetze, drei Koffer, ein Zelt, das wir nie benutzen sollten, zwei Kisten mit verschiedenen Dingen, eine Badewanne, ein Bündel Decken, einen Klapptisch, eine Geldkiste, eine Hängematte. Ich konnte nicht anders, als mich ein wenig vor meinen Dienern zu schämen, von denen jeder einen kleinen flachen Koffer bei sich hatte."
Trotz der umfangreichen Ausstattung bleibt die Reise ein Wagnis. Die genaue Route ist völlig unklar, die Reisenden müssen sich von Dorf zu Dorf durchfragen und erhalten nicht selten die widersprechendsten Auskünfte. Immer wieder murren die Träger, weil ihnen einzelne Etappen zu weit erscheinen. Vier von ihnen sind allein dazu abgestellt, Barbara Greene in einer Hängematte durch den Dschungel zu tragen - auch deswegen wohl mutet ihr Bericht, der bereits 2008 auf Deutsch erschienen ist, etwas munterer an, als der ihres Vetters.
Graham Greene läuft die ganze Strecke auf eigenen Füßen, auch wenn sich gleich in einer der ersten Nächte ein schmerzhafter Sandfloh unter einen seiner Zehennägel bohrt. Unangenehm auch sind all die Kakerlaken, Falter und vor allem Ratten, die die liberianische Nacht bevölkern und sich sogar auf das Gesicht des Schlafenden setzen, um seinen Speichel zu schlecken.
Unbehagen an der Zivilisation
Doch bei allen Widrigkeiten treibt Greenes Neugier, sein Interesse an der fremdartige Kultur, die Reisegruppe voran. Vor allem die Figur des "liberianischen Teufels", der die jungen einheimischen Männer, als eine Art Initiationsritus, in den Wald entführt, hat es ihm angetan, wie überhaupt das einfache, aber würdevolle Leben der Einheimischen:
"Der Dörfer, in denen ich die Nacht verbrachte, wurde ich nie müde. Diese kleinen tapferen Gemeinschaften, die dort oberhalb der Waldeswüste vor sich hin vegetierten, eingepfercht zwischen einer Sonne, die zu grausam war, um unter ihr arbeiten zu können, und einer Dunkelheit voller böser Geister. Die Menschen waren zärtlich miteinander, auf eine behutsame, gedämpfte Art und Weise. Sie brüllten nicht und machten keinen Unfug, sie zeigten niemals das zerrüttete Nervenkostüm der europäischen Armen, die laut und schrill wurden und unvermittelt losschlugen. Ich hatte die ganze Zeit über den Eindruck eines hohen Niveaus an Höflichkeit, dem mich anzugleichen meine Pflicht war."
Steht das Bild vom "Herz der Finsternis" gemeinhin für eine Reise ins Unbewusste - und deutet auch Greene an, dass er sich auf einem solchen Weg wähnt - ist der Effekt bei ihm dann ein gänzlich überraschender: Mag er auch im Land des Unbewussten angekommen sein, schreckt es ihn doch keineswegs. Vielmehr habe er sich noch nie so frei und glücklich gefühlt. Mögen Hitze und Insektenreichtum auch eine Qual sein, das eigentliche Unbehagen löst die sogenannte Zivilisation aus und das, was sie in Afrika, an der Küste vor allem, angerichtet habe. Denn hier bedeute Zivilisation vor allem Ausbeutung. Entsprechend werde man nur an der Küste, nicht im Hinterland bestohlen.
Europa also ist es, das bestimmte Werte zerstört hat, wenn es sich auch selbst einredet, es hätte sie überhaupt erst entwickelt.
Unterwegs zur Wiege der Menschheit
Insofern ist Graham Greene nicht zuletzt unterwegs zu den wahren Ursprüngen, zur Wiege der Menschheit eben. Er findet sie dort, wohin die Kautschuk-Plantagen der Firma Firestone noch nicht vorgedrungen sind, wo nur ein verrückter englischer Schriftsteller mit seiner Cousine unterwegs ist, ein paar Missionare und ein wunderlicher Deutscher, dem er in der Grenzregion begegnet.
"Er war noch jung, trotz des Barts, und trotz seines Strandräuber-Aufzugs umgab ihn etwas Aristokratisches, und er war weiser und verständiger als wir alle. Er war der Einzige, der genau wusste, was er alles lernen wollte, und der genau wusste, was er alles nicht wusste. Er sprach Mende, er lernte gerade Buzie und beherrschte ein paar Brocken Pelle. All das benötigte Zeit. Aber er war ja auch erst seit zwei Jahren in Westafrika."
Gerne hätte man gewusst, wer dieser Deutsche gewesen ist, der hoffte, eines Tages eine Dissertation zu schreiben, um sie bei Professor Westermann an der Berliner Universität einzureichen. Überhaupt wäre ein kundiges Nachwort eine Bereicherung für diesen Band gewesen, denn auch über die Geschichte der Firestone-Plantagen hätte man gerne genaueres erfahren. Wobei man schon ahnt, dass sich in Sachen Ausbeutung der Rohstoffe durch westliche Konzerne in den letzten 80 Jahren ebenso wenig geändert hat wie im Hinblick auf die Gefährlichkeit so mancher Tropenkrankheit.
Graham Greene: "Reise ohne Landkarten"
Übersetzt von Michael Kleeberg. Liebeskind Verlag, München 2015. 368 Seiten, 22 Euro.
Übersetzt von Michael Kleeberg. Liebeskind Verlag, München 2015. 368 Seiten, 22 Euro.
