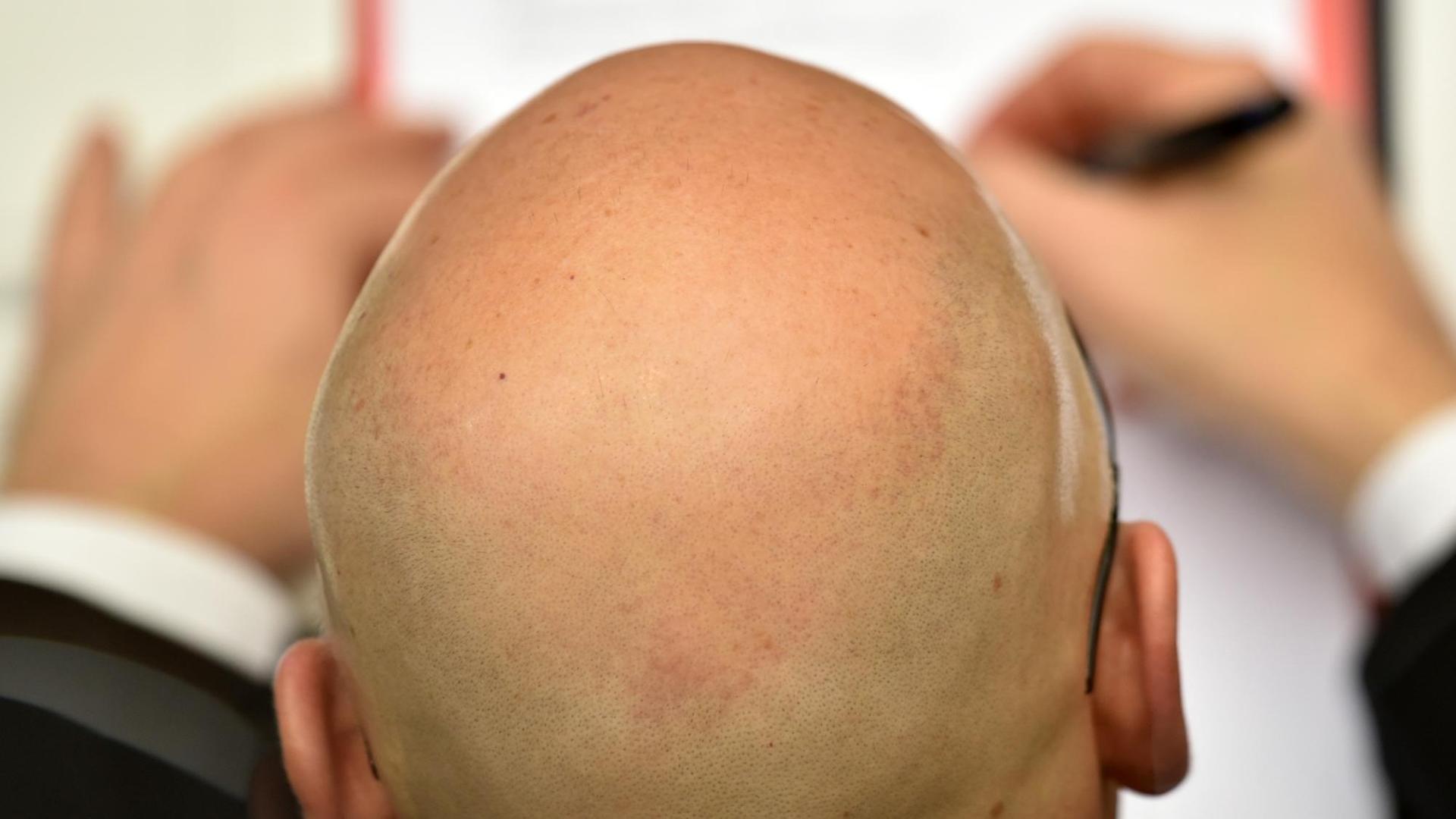
Schon seit den 1990er Jahren suchen Wissenschaftler am Institut für Humangenetik der Universität Bonn Stellen im Erbgut des Menschen, die bei Männern zu Glatzenbildung führen. Inzwischen haben sie über hundert Gene gefunden, die beim Haarausfall mitspielen. Und für den Laien überraschend stammen mehr davon von der Mutter als vom Vater, erklärt die Humangenetikerin Stefanie Heilmann-Heimbach.
"Da gibt es beim Haarausfall die Besonderheit, dass es Gene gibt die auf dem X-Chromosom liegen, auf dem Geschlechtschromosom. Dieses wird tatsächlich nur von der Mutter an die Söhne vererbt. Das heißt: Das mütterliche Erbgut leistet einen etwas größeren Beitrag als das des Vaters."
"Da gibt es beim Haarausfall die Besonderheit, dass es Gene gibt die auf dem X-Chromosom liegen, auf dem Geschlechtschromosom. Dieses wird tatsächlich nur von der Mutter an die Söhne vererbt. Das heißt: Das mütterliche Erbgut leistet einen etwas größeren Beitrag als das des Vaters."
Damit die Haare tatsächlich ausfallen, müssen viele genetische Faktoren zusammenkommen von Mutter und Vater.
"Letztendlich ist zu erwarten, dass diese Gene in bestimmten Signalwegen zusammenwirken. Die können in großen Netzwerken ganz viel miteinander agieren. So kann man sich das vorstellen. Es kann natürlich auch sein, dass einzelne Wege nebeneinander herlaufen, während andere mehr miteinander interagieren."
"Letztendlich ist zu erwarten, dass diese Gene in bestimmten Signalwegen zusammenwirken. Die können in großen Netzwerken ganz viel miteinander agieren. So kann man sich das vorstellen. Es kann natürlich auch sein, dass einzelne Wege nebeneinander herlaufen, während andere mehr miteinander interagieren."
Haarausfall ist ein vergleichsweise einfaches genetisches Merkmal
Statt um das Finden zuständiger Gene oder bestimmter Bereiche im Erbgut geht es in der aktuellen Forschung um das Verstehen der Signalwege und möglicher Netzwerke. Wer arbeitet wann, mit wem und wie zusammen. Erst wenn die Forscher dieses System im Detail verstehen, können sie Hinweise finden, wie es sich beeinflussen lässt – so dass die Haare vielleicht nicht ausfallen.
Dabei sind die einzelnen Systeme keinesfalls isoliert. So erforscht Stefanie Heilmann-Heimbach den Zusammenhang zwischen Haarausfall bei Männern und dem Risiko für Herzkreislauf-Erkrankungen. Epidemiologische Studien hatten ein Zusammenwirken nahegelegt. Die gleichen genetischen Netzwerke scheinen allerdings nicht am Werke zu sein, so zeigen es die ersten Ergebnisse.
"Wir sehen aber doch, dass es an einzelnen Genorten eine Überlappung gibt zu Risikofaktoren, die zu Herzkreislaufkrankheiten beitragen und eben auch zum Haarausfall."
"Wir sehen aber doch, dass es an einzelnen Genorten eine Überlappung gibt zu Risikofaktoren, die zu Herzkreislaufkrankheiten beitragen und eben auch zum Haarausfall."
Trotz der vielen beteiligten Gene ist Haarausfall ein vergleichsweise einfaches, rein genetisches Merkmal. Komplizierter wird es bei psychischen Erkrankungen. Hier wirken genetische Faktoren und Umweltfaktoren zusammen. Andreas Forstner erforscht als Oberarzt am Bonner Institut für Humangenetik die Genetik affektiver Störungen, wie der Depression oder der bipolaren Störung, früher auch manische Depression genannt.
Anlagen zur Schizophrenie haben wir von Homosapiens-Vorfahren übernommen
Bei der Gensuche im Erbgut von Betroffenen stießen er und sein Team auf Bereiche, die ursprünglich vom Neandertaler stammen. Sie gehören zu den zwei bis vier Prozent unseres Erbguts, die wir nach neuen Erkenntnissen vom Neandertaler übernommen haben.
"Erste Ergebnisse unserer Studien deuten darauf hin, dass solche Neandertal-Fragmente bei der bipolaren Störung beteiligt sind. Wir haben hier also eine signifikante Anreicherung dieser Fragmente nachgewiesen. Bei der Schizophrenie war es genau anders herum. Da war der Anteil der Neandertal-Fragmente, der zur Schizophrenie beiträgt, signifikant verringert", sagt Forstner.
Die Anlagen zur Schizophrenie haben wir also verstärkt von unseren Homosapiens-Vorfahren übernommen, während die bipolare Störung zu einem großen Anteil von unseren Neandertaler-Vorfahren stammt. Das wirft die Frage auf, ob so mancher Neandertaler bereits in der Steinzeit depressiv und ohne Tatendrang vor seiner Höhle saß.
"Das ist sicherlich sehr schwierig zu sagen, aber unsere Ergebnisse deuten schon darauf hin, dass es auch beim Neandertaler psychische Erkrankungen wie beispielsweise die bipolar affektive Störung gab."
"Das ist sicherlich sehr schwierig zu sagen, aber unsere Ergebnisse deuten schon darauf hin, dass es auch beim Neandertaler psychische Erkrankungen wie beispielsweise die bipolar affektive Störung gab."


