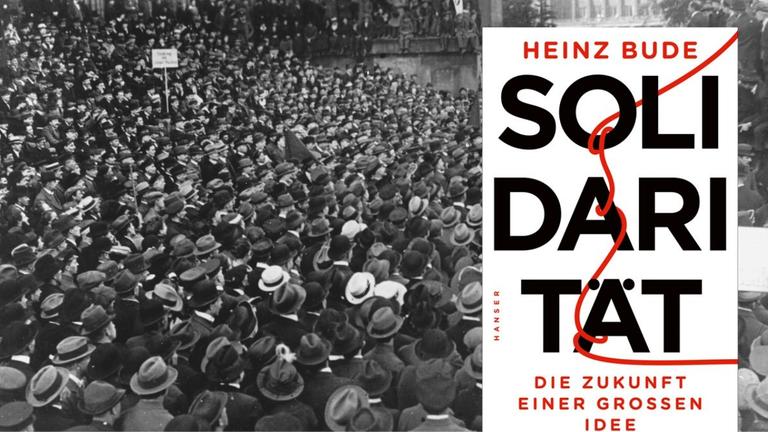
Solidarität kann mannigfache Formen annehmen, selbst in neoliberalen Zeiten. Zu diesem Ergebnis kommt der Soziologe Heinz Bude in seiner Studie, die quer durch die Geisteswissenschaften geht und das alte Konzept der Solidarität auf seine Zukunftstauglichkeit prüft.
"Verhalte ich mich tatsächlich solidarisch, wenn ich in meinem Handwerksbetrieb mit vier Beschäftigten einen unbegleiteten Flüchtling aus Syrien als Auszubildenden einstelle?"
Mit dieser Frage eröffnet Heinz Bude eine seiner "Mediationen über die große Idee der Solidarität" und sticht mitten ins Herz heutiger politischer Debatten. Seine Ausführungen, die bis in die Nikomachische Ethik des Aristoteles zurückreichen, machen deutlich, dass Solidarität immer mit Fragen der Differenz und Schuld einhergeht. Kurz zusammengefasst: Was schulden wir dem Anderen? Und in welchen wechselseitigen Beziehungen stehen Individuum und Kollektiv zueinander, das Ich und Wir. Die Antworten auf diese Fragen sind vielfältig und werden von Bude in adäquater Dichte und verteilt über verschiedene Themengebiete gegeben: Der Soziologe untersucht die Verstrickungen von Solidarität und Achtsamkeit, blickt auf die Arbeiterbewegung oder beschäftigt sich auch mit den "dunklen Seiten des Mitgefühls."
Solidarität als Exklusion
Deutlich wird, dass Solidarität kein Begriff ist, der ausschließlich positive Assoziationen hervorruft. Die aus der französischen Revolution hervorgegangene Lebensform der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit basiert auf "dem Empfinden von Schuld für die ungeheuerliche Tat des Vatermords", schreibt Bude, der Enthauptung des Königs. Totalitäre Systeme entscheiden wiederum darüber, wer gut genug ist, für die Solidarität zu leben und wer in ihrem Namen vernichtet werden muss. Aus diesen Betrachtungen resultiert, dass Solidarität zwangsläufig auch immer Exklusion bedeutet. Der Untertitel des Buches macht allerdings deutlich, dass Bude die Idee der Solidarität für zukunftsweisend erachtet, besonders in heutigen Zeiten neoliberaler Lebensentwürfe. In diesem Kontext führt er die Figur des Selbstbesorgten ein.
"Die Selbstbesorgten rücken von der Idee der Solidarität ab, weil sie darin eine Formel der Schwäche und der Abhängigkeit erkennen. Wer Solidarität fordert, kann oder will sich nicht selbst helfen."
Nur der Selfmademan, die sogenannte Ich-AG, sei dazu berechtigt, Solidarität einzufordern. Man muss sie sich verdienen, durch harte Arbeit und erbrachte Leistung. Menschen, die dies nicht erreicht haben, müssen zwangsläufig etwas falsch gemacht haben.
Ein neues "Wir-Gefühl"
Jedoch beobachtet Bude auch ein neues "Wir-Gefühl" in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus. In diesem Gefühl steckt der Wunsch, sich den Nebenwirkungen neoliberaler Selbstoptimierungssysteme zu entziehen und vergangene Fehlentscheidungen zu korrigieren. Man denke in diesem Zusammenhang etwa an die "Fridays for Future"-Schülerproteste, die im solidarischen Miteinander eine nachhaltige Umweltpolitik für eine bessere Zukunft fordern. Dazu passen auch Budes Reflexionen über die Verbindung von Solidarität und Ökologie, die zum Beispiel Gedanken des Soziologen Bruno Latour über die Erde aufgreifen. Laut Latour ist Solidarität auch eine Frage "der Beschaffenheit des Bodens, auf dem wir stehen". Für Heinz Bude impliziert das eine Auseinandersetzung mit der Erdgebundenheit des Menschen.
"Für jeden Menschen ergibt sich daraus allerdings die durchaus heikle Frage, welche anderen Wesen ich als Erdenbewohner für mein Überleben benötige."
Eine Frage, die heutzutage auch in populistischen Bewegungen virulent ist. Man denke nur an den Brexit oder die Gelbwesten-Proteste. Dennoch zeigt sich auch hier ein solidarisches Bestreben, versinnbildlicht in der Parole "Wir sind das Volk" und dem Wunsch, sich abzuschotten und nationale Schutzräume zu errichten, die den Anderen ausschließen und das Eigene in den Mittelpunkt rücken.
Eigeninteressen müssen zurückstehen
Progressive Solidarität könne aber - so Bude - nur durch ein Durchbrechen von Eigeninteressen erreicht werden. Wer solidarisch handelt, handelt selbstvergessen und erwartet nicht dafür entlohnt zu werden.
"In Konstellationen mit konkurrierenden Wir-Bezügen geht die empathische Parteinahme in aller Regel für das eigene Wir, nicht aber für das Wir der anderen aus."
Das bedeutet, dass ein Wir-Gefühl entwickelt werden muss, in dem der Andere in seiner Andersartigkeit akzeptiert wird und sie auch leben kann. Nur das bildet den Freiraum für eine "neue Identität für alle" und "für ein größeres Wir". In diesem Wir steckt für Heinz Bude der Kitt, der eine Gesellschaft der Zukunft vor dem Auseinanderbrechen schützen wird. Den Weg zu dieser neuen Gemeinschaft denkt der Soziologe allerdings über das Individuum selbst. Ein wichtiger Gedanke, der das Buch zu einer essentiellen Alltagsanalyse macht. Die Durchdringung des Lebens durch den Neoliberalismus macht es unmöglich, die Frage nach einem solidarischen Miteinander ohne den Umweg über das Ich zu stellen. Solidarisch zu sein bedeutet über das Verhältnis zum Anderen, sich selbst verstehen zu lernen und dabei die eigene Selbstachtung zu kultivieren. Es geht nicht darum zu geben, sondern zu teilen und gemeinsam am großen Ganzen zu arbeiten.
Heinz Bude: "Solidarität - Die Zukunft einer großen Idee",
Hanser Verlag, 176 Seiten, 19,00 Euro.
Hanser Verlag, 176 Seiten, 19,00 Euro.




