
Mona (*) ist Patientin im multiprofessionellen Stadtteil-Gesundheitszentrum in Neukölln, kurz GeKo – für Gesundheitskollektiv. Das GeKo in Neukölln ist das Erste in Berlin: „Und ich bin so begeistert", sagt die junge Frau, "ganz toll, weil es so eine emphatische und ganzheitliche Behandlung ist. Körper, aber auch Geist - die haben das Ganze im Blick. Und das ist ja so wichtig für die Gesundheit, dass alles miteinander funktioniert.“
Deshalb gibt es auch in einem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Kindl-Brauerei in Berlin alles unter einem Dach: Auf 500 Quadratmetern gibt es eine Hausarzt- und eine Kinderarztpraxis, es gibt Beratungsstellen für Familie, Gesundheit, Pflege und Soziales, und es gibt Angebote zur psychologischen Betreuung.
Auch aufsuchende Gesundheitsarbeit im Stadtteil
Eine weitere Besonderheit: Ein Mitarbeiter berät die Menschen im Kiez auch außerhalb des Zentrums in Vereinen oder an Treffpunkten in der Umgebung. Ein anderer macht Sportangebote. Insgesamt arbeitet hier im GeKo Gesundheitszentrum ein knappes Dutzend Menschen. Ein kleines Café gleich im Eingangsbereich hilft dabei, Nachbarn und Patienten aus der Umgebung in Kontakt zu bringen.
All das fördere die Gesundheit, erklärt Patricia Hänel, Ärztin und Koordinatorin des Zentrums - gerade in einem Kiez wie Nord-Neukölln, wo viele Migranten, viele arme, viele alte Menschen und viele Kinder leben. Prekäre Lebenssituationen machten krank, so Patricia Hänel. Das Zentrum kümmere sich daher nicht nur um die Symptome, sondern auch um die Ursachen:
„Das sind immer die gleichen. Das ist Miete, das ist Arbeit, das ist prekäre Finanzierungssituation, Probleme mit dem Jobcenter. Leute, die in schwierigen familiären Situationen sind, in zu kleinen Wohnungen mit haufenweise Kindern und viel Krach, Lärm und wenig Rückzugsmöglichkeiten. Viel geht es um Pflege, Pflege von Angehörigen. Dann hat man am Ende eben die typischen Symptome, dann hast du Rückenschmerzen, dann hast du Stress, dann hast du Kopfschmerzen. Viele Leute kommen in die Praxen und wissen gar nicht, dass sie, wenn sie ihre bettlägerige Mutti pflegen, dass sie dann das Recht auf Unterstützung haben und dass es ein ganz großes Netzwerk gibt. Und das ist ja wichtig, weil es den Leuten ja dann besser geht.“
"Hier habe ich nicht das Gefühl, hier sitzt die Zeit im Nacken"
Mona hat eine psychische Erkrankung, die sich auch körperlich auswirkt. Alleine mit Medikamenten sei ihr nicht geholfen – und das sehe ihre Ärztin hier im GeKo glücklicherweise genauso:
„Wir hatten jetzt zum Beispiel meine Familie mit eingebunden, was ein sehr empathisches Gespräch war mit der Frau Schubert, meiner Ärztin. Und was ich toll finde, ist dieses Kollektiv. Und es ist wirklich ganzheitlich: Wie sieht mein Alltag aus? Wie sieht mein Leben aus? Wie ist das soziale Umfeld? Und hier habe ich nicht das Gefühl, hier sitzt die Zeit im Nacken, sondern hier wird sich um mich gekümmert.“
Allgemeinärztin Kirsten Schubert hat das GeKo mitgegründet. Offiziell eröffnet wurde es im Februar. Die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier ist ihr wichtig. Es gibt regelmäßig Besprechungen und Austausch, die medizinischen Fachangestellten am Empfangstresen haben das gleiche Mitspracherecht wie Psychotherapeutinnen oder Sozialarbeiter und Ärzte.
„Weil wir daran glauben, dass man dann besser arbeitet im Team, wenn alle gemeinsam mitdenken auf Augenhöhe und dass (das) hier kein ärztedominiertes Zentrum ist, ärztinnendominiertes Zentrum.“
Antwort auf Ökonomisierung und Privatisierung
Ein halbes Dutzend solcher Projekte, die sich zum Teil noch im Aufbau befinden, hat sich in Deutschland im „Dachverband Poliklinik Syndikat“ zusammengeschlossen. Mit einem innovativen Konzept, das sich abgrenzt von herkömmlichen Zentren – dabei historische Bezüge neu interpretieren will.
Der Dachverband engagiere sich für den Aufbau und den Betrieb „solidarischer Gesundheitszentren“, heißt es auf der Homepage. Man verstehe sich als Antwort auf die Ökonomisierung und Privatisierung des Gesundheitssystems.
Der Dachverband orientiert sich dabei an ähnlichen Konzepten in Schweden und Kanada. Und auch in Deutschland gibt es bereits ein Vorbild: die Hamburger Poliklinik Veddel, die seit 5 Jahren als Stadtteilgesundheitszentrum in einer ebenfalls sozial schwachen Gegend erfolgreich arbeitet. Zu nennen sind auch ähnliche Projekte in Dresden, Köln und Leipzig.
Man wolle gesundheitlicher Ungleichheit entgegenwirken und für eine gerechte und solidarische Gesellschaft eintreten und kämpfen, so der Dachverband. Die Anspielung auf die Polikliniken der DDR sei dabei kein Zufall, sagt Patricia Hänel, Koordinatorin des Zentrums in Neukölln:
„Nicht umsonst heißt ja unser Dachverband das 'Poliklinik Syndikat'. Auch wenn wir kritisch sehen, dass das natürlich sehr ärztezentriert auch war. Aber natürlich, solange alle Berufsgruppen, alle relevanten Berufsgruppen zusammenarbeiten können und alle zu ihrem Recht kommen und alle ihre Kompetenz einbringen, dann ist es super.“
Poliklinik - ein Ansatz aus der Armenfürsorge seit 1810
Was Polikliniken von herkömmlichen Arztpraxen unterscheidet: Sie beherbergen für die ambulante Versorgung von Patienten mehrere Fachrichtungen unter einem Dach. Die ersten Polikliniken gab es jedoch nicht erst zu DDR-Zeiten, sondern bereits im 19. Jahrhundert. Es waren wohltätige Einrichtungen, „Armensprechstunden“. Gabriele Schlimper vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin, der das GeKo in Neukölln unterstützt:
„Polikliniken haben ja noch nicht mal die Kommunisten erfunden, sondern das war Christoph Wilhelm Hufeland, der 1810 in Berlin die erste Poliklinik für arme Kranke eröffnete. Und das war damals so ein Ansatz für Armenfürsorge. Und das wurde dann in Zeiten der DDR als ambulante Versorgungsstruktur gesehen. Es war ja in der DDR nicht so möglich, dass Ärzte sich privat niederlassen konnten.“
In der Nachkriegszeit setzte sich in der Bundesrepublik dann das System der freien niedergelassenen Ärzte mit einzelnen Praxen durch. In der DDR dagegen wurde das Gesundheitssystem verstaatlicht, wurden die Arztpraxen weitestgehend abgelöst durch Polikliniken. Kerstin Salin, die in der DDR aufgewachsen ist, erinnert sich.
„Ich hatte eine sehr seltsame Krankheit. Meine Mutter setzte mich dann aufs Fahrrad, schob mich zur nächsten Poliklinik, die ja nur ein paar Meter weg war und in der Poliklinik weiß ich noch, da waren einfach ganz viele verschiedene Fachbereiche, also man hatte einfach alles beisammen. Es war viel Personal immer da, es waren alle immer sehr freundlich.“
Im Wesentlichen arbeiteten dort Ärzte verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach, womöglich auch Physiotherapeuten. Eine sozialmedizinische Beratung gab es jedoch nicht.

Renaissance des Konzepts Poliklinik
Nach der Wende wollte die Koalition aus CDU/CSU und FDP, sowie die kassenärztlichen Vereinigungen das Gesundheitssystem in ganz Deutschland privatisieren. Und sie wollten die Polikliniken der DDR, in denen die Ärzte angestellt arbeiteten, abschaffen. Infolge der Gesundheitsreform von 2004 erleben sie heute jedoch eine Art Renaissance. Gabriele Schlimper vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin:
„Und dann entstanden zeitnah wieder sogenannte „Medizinische Versorgungszentren“. Das waren Häuser, in denen Ärzte in einem Haus ihre Leistung anboten. Waren aber dann oftmals auch noch privat, also eigenständig unterwegs. Bis es dann die neueren MVZ Ansätze gab, wo Ärzte dann wieder angestellt sind. Das ist auch ein sehr erfolgreiches Modell, weil viele Ärzte eben den Vorteil der ambulanten Arbeit sehen und gleichzeitig aber auch den Nachteil der wirtschaftlichen Risiken klein halten möchten. Das sind MVZ, das sind die Polikliniken, quasi. Da sind die klassischen Ärztehäuser, die es überall gibt.“
MVZ, also medizinisches Versorgungszentrum - Poliklinik, Ärztehaus, Ambulatorium … für die Verwendung all dieser Begriffe gibt es keine festen Regeln. Es können einzeln wirtschaftende Arztpraxen sein, die unter einem Dach arbeiten. Oder es können Ärzte sein, die bei einem übergeordneten Träger angestellt sind.
Rund 4.000 MVZ gibt es derzeit in Deutschland. Die meisten werden von Ärzten betrieben, wenige von Kommunen, einige von Krankenhäusern, und immer mehr von Aktiengesellschaften oder Finanzinvestoren, die Rendite für ihre Anleger erwirtschaften wollen.
"Mit Gesundheit soll keine Rendite erwirtschaftet werden"
Das GeKo-Gesundheitszentrum in Neukölln verfolgt dagegen einen komplett anderen Ansatz. Das Angebot, so Mitgründerin Patricia Hänel, sei umfassender und gesamtheitlich. Und: Das Zentrum strebe nicht nach Gewinn.
„Das, wofür wir uns natürlich stark machen, ist, dass eigentlich mit Gesundheit keine Rendite erwirtschaftet werden soll. Es spricht nichts dagegen, dass Menschen davon gut leben. Wir wollen keine Hungerlöhne bezahlen, und man soll jetzt nicht irgendwie darben. Aber dass quasi Renditen aus der Solidargemeinschaft abfließen, halten wir für total falsch.“
Träger des Zentrums ist der gemeinnützige Verein „Gesundheitskollektiv Berlin“. Ein gemeinnütziger Verein kann in Deutschland allerdings rechtlich betrachtet nicht Träger einer Arztpraxis sein. Und eine wirtschaftliche Verzahnung zwischen ärztlichen und anderen Gesundheits- und Beratungsangeboten, zwischen Ärzten, Sozialarbeitern oder Therapeuten sei ebenfalls ein Problem. So Tobias Schulze von der Linken in der rot-rot-grünen Berliner Regierungskoalition. Schulze hat das Projekt GeKo mit auf den Weg gebracht.
„Viele ärztliche Leistungen dürfen nur in einer Arztpraxis angeboten werden. Umgekehrt ist es bei Psychotherapie, Physiotherapie auch eine klare Trennung - und erst recht bei sozialen Angeboten, Sozialberatung, Mietenberatung, Schuldenberatung. Das sind alles unterschiedliche Regelungskreise, auch unterschiedliche Finanzierungskreise. Deshalb war die Organisation dieses Stadtteilgesundheitszentrums durchaus eine große Herausforderung, und es geht auch nicht ohne öffentliches Geld.“
Das Zentrum in Neukölln wirtschaftet also nach einer Art Patchwork-Prinzip: mit Geld von der Kassenärztlichen Vereinigung für die einzelnen Arztpraxen und Geld aus unterschiedlichen Töpfen für alle anderen Angebote: Geld von verschiedenen Stiftungen, vom Quartiersmanagement und vom Land Berlin.
Zwölf weitere Stadtteilgesundheitszentren in Berlin geplant
Weil die Berliner Landesregierung vom Konzept des GeKo-Gesundheitszentrums in Neukölln überzeugt ist, möchte sie - so die politische Absichtserklärung Anfang des Jahres - den Aufbau von zwölf weiteren Stadteilgesundheitszentren mit einem Landesprogramm für integrierte Gesundheitszentren fördern. Dort sollen medizinische Behandlung und soziale Beratung angeboten werden. Als Vorbild dienen der Koalition dabei zweierlei Projekte: Eines im Bezirk Lichtenberg, bei dem Sozialarbeiter Sprechstunden in Arztpraxen anbieten. Das andere ist das Stadtteil-Gesundheitszentrum Neukölln, eben das GeKo. Berlins grüne Gesundheitssenatorin Ulrike Gote:
„Also ich denke, ein Gesundheitszentrum in, sagen wir mal Charlottenburg, sähe anders aus als eins in Neukölln, aber wir können die überall brauchen. Und das hat verschiedene Gründe: Wir haben viele Menschen, die keine Hausärzt:innen mehr haben und gerade für diese müssen wir einen Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung finden. Das betrifft eher jetzt Stadtteile, wo Menschen mit weniger gutem wirtschaftlichen Hintergrund leben oder in weniger gefestigten sozialen Verhältnissen. Da haben wir tatsächlich den Bedarf ganz klar, auch diese Niederschwelligkeit zu haben. Wir haben aber in anderen Kiezen auch die Beobachtung, dass wir immer mehr alte Menschen haben, hochaltrige Menschen haben, die ganz unterschiedliche Bedarfe haben, die bisher von unserem Gesundheitssystem nicht so abgedeckt werden.“
Kommunale Versorungszentren auch im Koalitionsvertrag
Mit der Idee liegt Berlin auch im Bundestrend. Der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition sieht vor, die Gründung von kommunal getragenen „Medizinischen Versorgungszentren“ zu erleichtern - also Zentren, die nicht profitorientiert arbeiten.
Bei Freien Demokraten, Grünen, Sozialdemokraten und Linken hatten es Ideen zur Zukunft der ambulanten medizinischen Versorgung in integrierten Zentren bis in die Wahlprogramme geschafft.
Solche Medizinischen Versorgungszentren in kommunaler Trägerschaft sind in Deutschland aber immer noch selten. Laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse sind der Geldmangel der Kommunen und deren Sorge vor den finanziellen Risiken die Hauptgründe.
Das GeKo in Neukölln zum Beispiel hat eine halbe Million Euro Anschubfinanzierung vom Land Berlin bekommen. Außerdem zahlt der Senat Teile der Miete und des Personals. Die geplanten zukünftigen Zentren sollen sich aber nach Möglichkeit selbst tragen, meint Senatorin Ulrike Gote. Das Land will nur die sozialen oder psychosozialen Leistungen bezahlen, die es sonst anderswo auch anbieten würde.
„Also, in Neukölln ist es gelungen, es zu organisieren. Natürlich muss hier auch die Kassenärztliche Vereinigung mit ins Boot, um das mit zu organisieren.“
Kassenärztliche Vereinigung sieht auch Hindernisse
Prinzipiell sei man bereit - aber ganz so einfach sei das nicht, erwidert die Kassenärztliche Vereinigung. Freie Hausarztsitze, ohne die kein Arzt eine Praxis eröffnen darf und die auch ein integriertes Gesundheitszentrum benötigt, gebe es derzeit nur im ärztlich unterversorgten Berliner Osten, sagt Burkhard Ruppert von der KV. Und: Bezahlen könne die Kassenärztliche Vereinigung auch nur für medizinische Leistungen. Der Rest müsse von der öffentlichen Hand getragen werden. Allerdings:
„Grundsätzlich halten wir das medizinisch und auch versorgungstechnisch für einen guten Weg, weil es eben das Medizinische mit dem Sozialmedizinischen sehr gut verbindet.“
Auch Tobias Schulze von der Linken spricht sich für den neuen Ansatz aus. Über Gesundheit müsse langfristig grundsätzlich und anders nachgedacht werden. Gerade im armen Nord-Neukölln könne man Krankheiten verhindern, wenn man die sozialen Probleme der Menschen rechtzeitig angehe – mit allen Begrenztheiten und Herausforderungen, die damit einhergingen:
„Viele Erkrankungen, die dort auftauchen, haben unmittelbar mit der sozialen Situation der Menschen zu tun. Das muss die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens natürlich klären, inwieweit sie die Möglichkeiten hat, so etwas auch über die Krankenkassen zum Beispiel stärker zu fördern. Und wir haben natürlich vereinbart, dieser Versuch und dieses Modell wird wissenschaftlich begleitet. Und wir wollen daraus natürlich auch etwas lernen, inwieweit sich durch die interdisziplinäre Gesundheits- und Sozialversorgung dort auch eine Situation verbessern kann. Und das ist dann vielleicht auch wieder für die Krankenkassen und das Gesundheitssystem insgesamt interessant.“
"Dem Patienten kurze Wege sichern"
Das findet auch Rainer Schmidt von der AOK Nordost, die als einzige gesetzliche Krankenkasse in Deutschland ein eigenes Ärztehaus betreibt. Im „Centrum für Gesundheit“ im Berliner Wedding sind 14 Fachärzte, ein Institut für psychosomatische Medizin, Physiotherapie, Ernährungsberatung und ein Servicecenter für Fragen zur Kranken- und Pflegeversicherung unter einem Dach. Das Angebot, so Schubert, zahle sich für Patienten und Krankenkasse aus:
„Denken Sie an Diabetiker, die benötigen natürlich neben der reinen klassischen ärztlichen Behandlung auch noch weitere Ernährungstipps, Ernährungshinweise, und deshalb macht es aus unserer Sicht sehr großen Sinn, das auch gleich an einem Standort zu machen, um auch dem Patienten kurze Wege zu sichern. Das rechnet sich langfristig natürlich, wenn die Patienten befähigt werden, mit ihrer Krankheit besser umzugehen, dann ist das natürlich unter dem Strich eine win/win-Situation sowohl für die Krankenkasse als auch für den Patienten.“
Zeit für die Patienten - "nicht gegenfinanziert"
Im Stadtteil-Gesundheitszentrum Neukölln versucht die Allgemeinmedizinerin Kirsten Schubert allerdings erst einmal nur für ihre Patienten eine „win“-Situation möglich zu machen. Gerade eben hat eine erschöpft wirkende Frau ihre Praxis verlassen.
„Also, die hat ein massives chronisches Schmerzproblem schon seit Langem und hat eine psychische Grunderkrankung, die da sicherlich eine ganz große Rolle spielt und ist aber auch aus sehr einfacher Lebenssituation. Sehr prekär, muss man sagen, und jetzt zusätzlich auch noch akut von Schulden betroffen. Das ist sozusagen obendrauf auf ihre Lebenssituation, und ich habe ihr jetzt immer wieder angeboten, dass sie zu unserer Sozialberatung kann und dass die sie dabei unterstützt. Das wird sie wahrscheinlich auch wahrnehmen.“
Den Schmerzen auf die Spur kam Kirsten Schubert erst nach einem langen Gespräch. Denn Regel ist: Alle Patienten füllen erst einmal einen fünfseitigen Anamnesebogen aus, in dem es nicht nur um Allergien und Vorerkrankungen geht, sondern auch um Lebensumstände, Wohnung, Arbeit, Geld, Partnerschaft und Kinder:
„Und dann gehen wir den immer am Anfang einmal durch, das ist zeitintensiv. Und das ist auch eine Zeit, die nicht gegenfinanziert ist, also es wird ja Zeit bezahlt. Machen eigentlich eine umfangreichere bessere Versorgung, da bin ich mir ganz sicher, kriegen die aber nicht bezahlt.“
"Noch nie erlebt, dass man sich fast freut auf den Arzt"
Gerade erst hat das Land Berlin wegen Geldknappheit vorläufig das Budget für das Zentrum um knapp 25 Prozent reduziert. Das Angebot für die Patienten könne derzeit nur mit viel ehrenamtlicher Arbeit aufrecht erhalten werden, sagt Koordinatorin Patricia Hänel. Das multiprofessionelle Stadtteilgesundheitszentrum Neukölln sei komplett unterfinanziert. Trotzdem:
„Wir sind, glaube ich, wirklich etwas, was dem Gesundheitssystem auf Dauer guttut...“
Wie gut, das soll demnächst wissenschaftlich dokumentiert und untersucht werden, unter anderem anhand der Zahl von Krankenhauseinweisungen, Besuchen der Notaufnahme oder Facharzt-Überweisungen und dem jeweiligen Arbeitsaufwand. Aufgrund eigener Erfahrungen stellt Patientin Mona, die alle zwei Wochen zur Blutentnahme kommt, dem GeKo bereits heute ein gutes Zeugnis aus:
„Das habe ich noch nie erlebt, dass man sich fast freut auf den Arzt. Und da wird dann so etwas eigentlich Negatives zum fast schon schönen Start in die Woche. Und das hat bis jetzt noch niemand geschafft.“
(*) Anmerkung der Redaktion: Nachname der Redaktion bekannt.








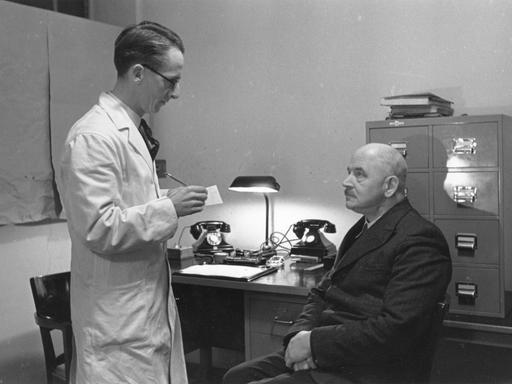









![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)


