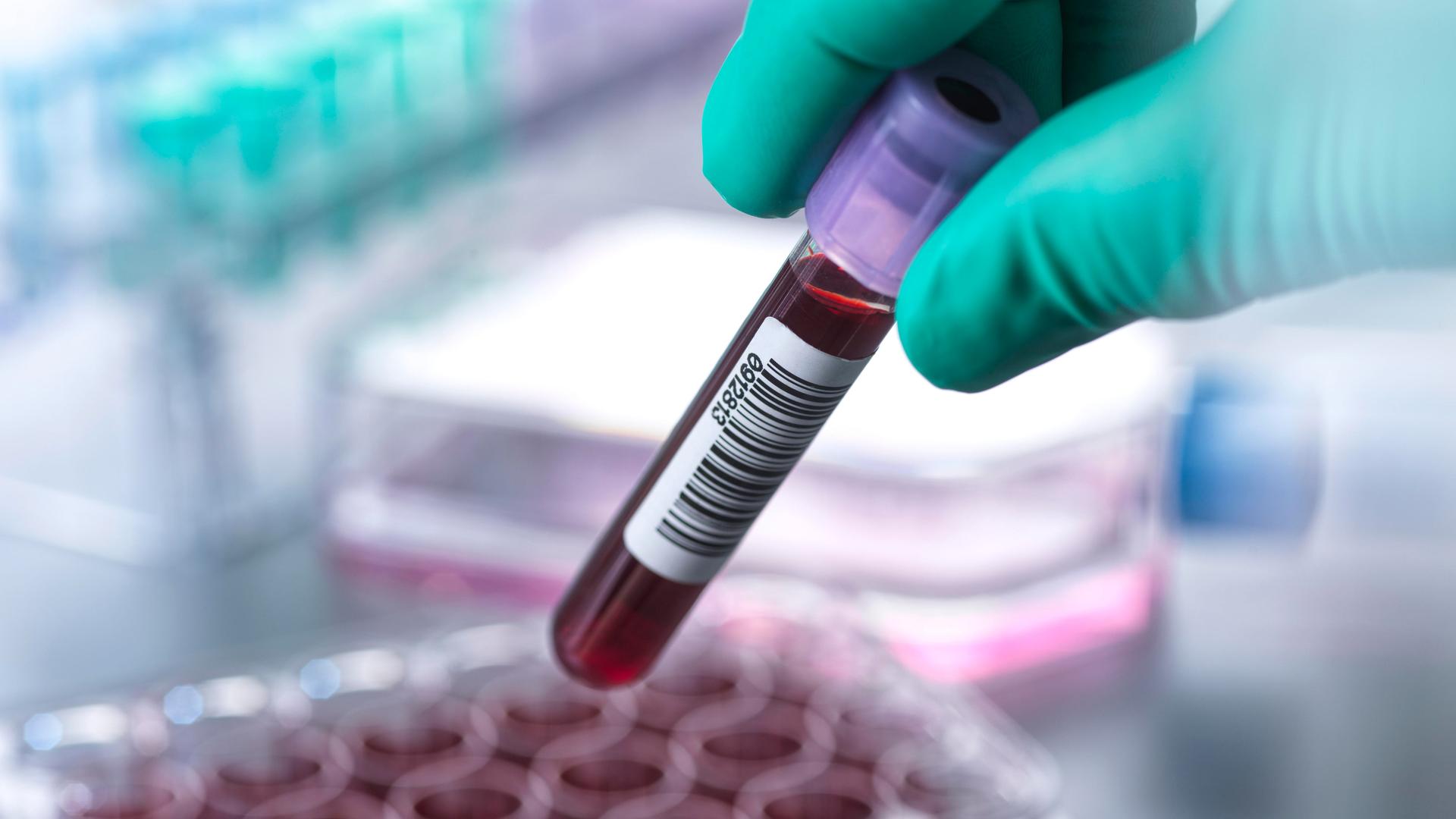
Bislang werden Verletzungen oder Krankheiten mit entzündungshemmenden Medikamenten behandelt - im ganzen Körper. Die Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass über die sogenannten regulatorischen T-Zellen eine zielgenaue Therapie einzelner Körperareale möglich ist.
In ihren Versuchen entdeckten die Forscher, dass eine Art weißer Blutkörperchen - die so genannte regulatorische T-Zelle - als eine einzige große Population von Zellen existiert, die sich ständig durch den Körper bewegen, um beschädigtes Gewebe zu suchen und zu reparieren. Bislang waren Mediziner davon ausgegangen, dass diese Zellen als mehrere spezialisierte Populationen existieren, die jeweils auf bestimmte Körperteile beschränkt sind.
Mit einem Medikament, das sie bereits entwickelt haben, konnten die Forscher bei Mäusen zeigen, dass es möglich ist, regulatorische T-Zellen an einen bestimmten Teil des Körpers zu locken, ihre Anzahl zu erhöhen und sie zu aktivieren, um die Immunantwort auszuschalten und die Heilung in nur einem Organ oder Gewebe zu fördern.
Dank ihrer neuen Erkenntnisse könnte es nach Angaben der Forscher künftig möglich sein, die Immunantwort des Körpers herunterzufahren und Schäden in einem bestimmten Teil des Körpers zu reparieren, ohne den Rest des Körpers zu beeinträchtigen. Das bedeutet, dass höhere, gezieltere Dosen von Medikamenten zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden könnten – möglicherweise mit schnelleren Ergebnissen.
Als Einsatzgebiete seien Muskelverletzungen denkbar, Multiple Sklerose, Diabetes oder sogar Haarausfall sowie Entzündungskrankheiten. Damit könnten auch Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantationen behandelt werden. "Der Gedanke, dass wir es bei einer so enormen Bandbreite von Krankheiten einsetzen könnten, ist fantastisch", sagte der leitende Autor der Studie, Professor Adrian Liston vom Department of Pathology der University of Cambridge.
Diese Nachricht wurde am 21.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
