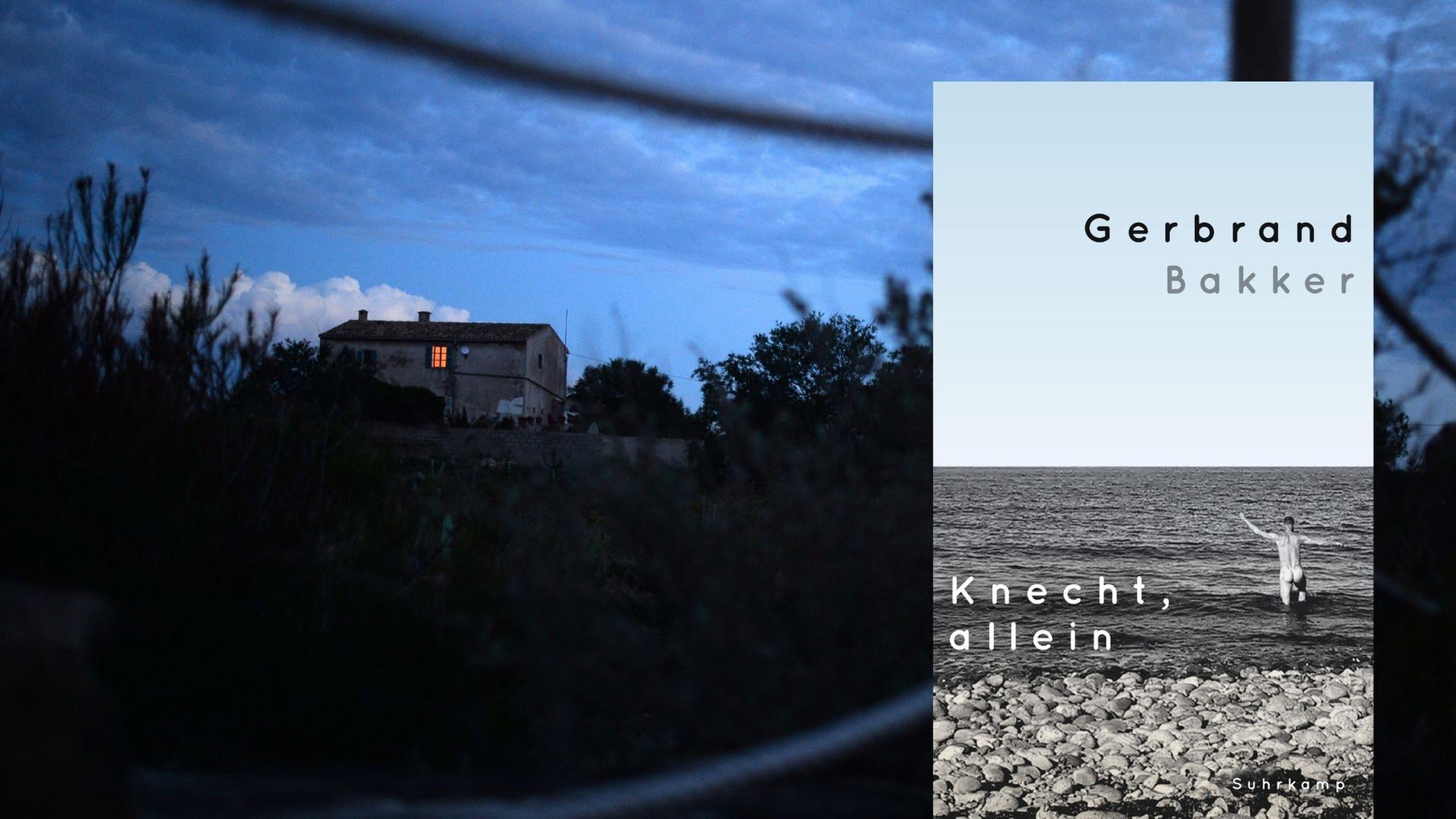
Es gibt diese Momente in Gerbrand Bakkers Leben, da scheint alles gut zu sein. Dann arbeitet der niederländische Schriftsteller im Garten seines Bauernhauses in der Eifel, kümmert sich um Pflanzen oder Bäume und kann sich der kleinen Dinge erfreuen. So wie an einem Vogel, der sich in sein Haus verirrt.
„Ein Rotkehlchen flog in den Hauswirtschaftsraum, und als ich es hinausjagen wollte, sah es die offenstehende Tür nicht und wollte durch eine Fensterscheibe ins Freie. Fast hätte ich es zu fassen bekommen, ich spürte seine Flügelchen, irgendwann sogar das wild klopfende Herzchen, aber dann begriff es, dass die Tür sperrangelweit offenstand. (…) Es war ein schöner Tag. Ein guter Tag. Alles lief mehr oder weniger so, wie es sein sollte. Bitte mehr solcher Tage.“
Dass sich der Schriftsteller mehr solcher Tage wünscht, liegt daran, dass viele andere von einer Depression bestimmt sind. An der leidet er und mit der hadert er, weil er nicht weiß, wo sie herkommt. Schließlich sei er doch in halbwegs behüteten Verhältnissen aufgewachsen und von größeren Traumata weitgehend verschont geblieben, schreibt Gerbrand Bakker und versucht seinen Zustand zugleich mit dem Handwerk zu fassen, das er am besten beherrscht, dem Schreiben. Das haben vor ihm andere sehr erfolgreich getan, man denke an „Der schwarze Hund“ des Australiers Les Murray, an Matt Haigs „Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben“ oder Thomas Melles „Die Welt im Rücken“. Hier nun also die niederländisch-nüchterne Variante, die sich schon darin ausdrückt, dass Gerbrand Bakker sehr darauf bedacht ist, jegliches Pathos zu vermeiden. Auf der Suche nach einem möglichst präzisen Sprachbild für die Krankheit findet er das schlichte „Niemandsland“, in dem er ein „Nichts“ sei. Jedoch ein „Nichts“, das im Alltag durchaus funktioniert.
„Fahrradfahren, essen, scheißen, pinkeln, reden, duschen, Zähneputzen, alles mit einem hohlen Gefühl, mit Angst, mit Zeit, die nicht mehr zählt, das ist eine Ungereimtheit, die sich nicht fassen lässt, und dann muss man schon ziemlich stabil sein, um nicht zu vergessen, dass nicht man selbst es ist, sondern etwas, das in einem ist.“
Über den Libidoverlust hinweghelfen
Man folgt Gerbrand Bakker in diesem Buch also auf zweierlei Wegen. Auf denen durch sein inneres „Niemandsland“ und auf denen durch die Wirklichkeit, die ihn umgibt. Die besteht nicht nur aus Haus und Garten, sondern auch aus Gesprächen mit Nachbarn, Reisen mit Freunden, aus Erinnerungen an die Kindheit, an den Erfolg seines Romans „Oben ist es still“ und an seinen verstorbenen Hund, den Protagonisten von „Jasper und sein Knecht“. Gerbrand Bakker vermisst ihn sehr und ist nun eben „Knecht, allein“, womit sich der Titel des vorliegenden Buches erklärt. Doch zu seinem Alleinsein fügt sich oft auch Einsamkeit. Denn, so stellt Gerbrand Bakker fest, viele Menschen würden zwar auf körperliche Leiden mit Verständnis reagieren, auf eine unsichtbare Depression aber eher mit Ratlosigkeit und Rückzug.
Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum in „Knecht, allein“ viele Tiere auftauchen, eine Wespe mitten im Februar, Elefanten im Amsterdamer Zoo und immer wieder Hunde. Tiere scheinen den Schriftsteller zu trösten. Mehr jedenfalls als sein Therapeut und eine Sexologin, die ihm über den mit den Antidepressiva einhergehenden Libidoverlust hinweghelfen wollen. Das alles ist recht launig verfasst, doch fragt man sich irgendwann, warum man sie lesen soll, die vielen Geschichten aus seinem Leben, dazu den Gossip der deutsch-niederländischen Literaturszene, der seine Wirkung nur entfaltet, wenn man die genannten Menschen kennt. Und als hätte er diese Frage schon geahnt, formuliert Gerbrand Bakker relativ früh im Buch die durchaus einleuchtende Antwort.
Tröstliche Lektüre
„Ein ganz gewöhnliches Buch über ganz gewöhnliche, alltägliche Dinge, selbst wenn es um eine Depression oder einen widerspenstigen Hund geht. Was für ein tolles Buch, was für eine Erleichterung! Der Mann, der es geschrieben hat kann nicht anders. ‚What you see is what you get‘, sagen die Briten. Ein Buch von einem, der der Welt nichts mitzuteilen hat.“
Das ist wiederum kokett, denn natürlich hat Gerbrand Bakker etwas mitzuteilen. Die Depression, die er als Betroffener, als ein „Nichts“, wahrnimmt, ist zugleich alles und hält ihn, den gefeierten Schriftsteller, davon ab, endlich wieder einem Roman zu schreiben. Eine existenzielle Notlage, aus der er sich rettet, indem er das Alltägliche, das vermeintlich Banale notiert, um sich selbst zu versichern, dass er überhaupt noch da ist. So muss man „Knecht, allein“ auch als Ergebnis eines Kraftaktes lesen, sich dem „Nichts“, dem „Niemandsland“ gerade nicht zu ergeben. Die damit verbundene widerständige und trotz allem lebensbejahende Haltung Gerbrand Bakkers ist bewundernswert und macht sein Buch zu einer tröstlichen Lektüre.
Gerbrand Bakker: „Knecht, allein“
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Suhrkamp Verlag, Berlin. 318 Seiten, 24 Euro.
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Suhrkamp Verlag, Berlin. 318 Seiten, 24 Euro.

